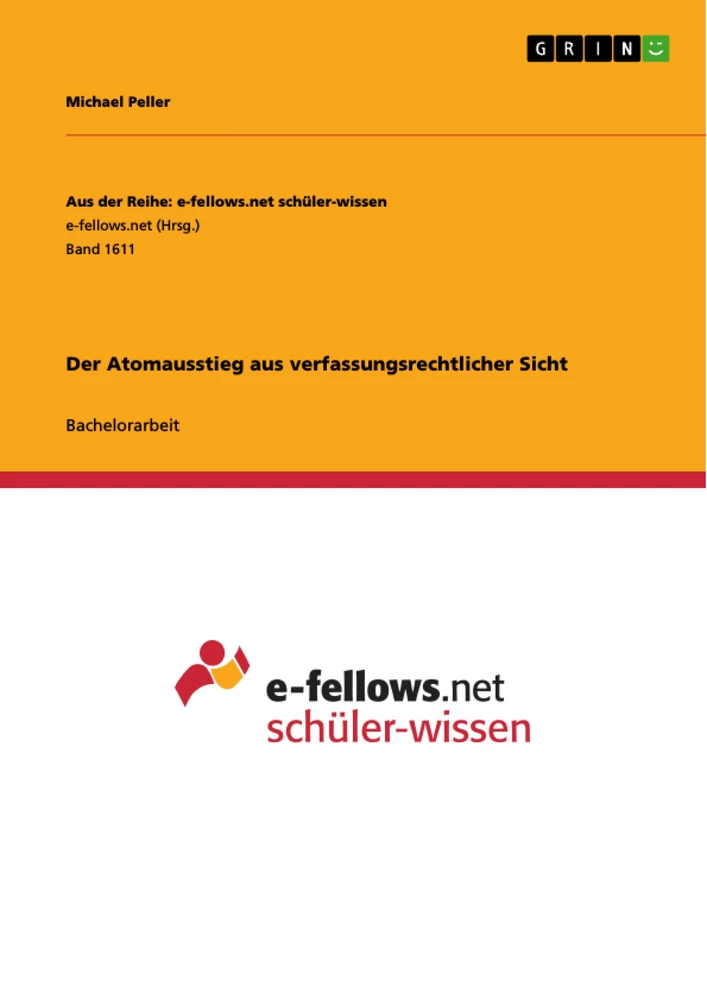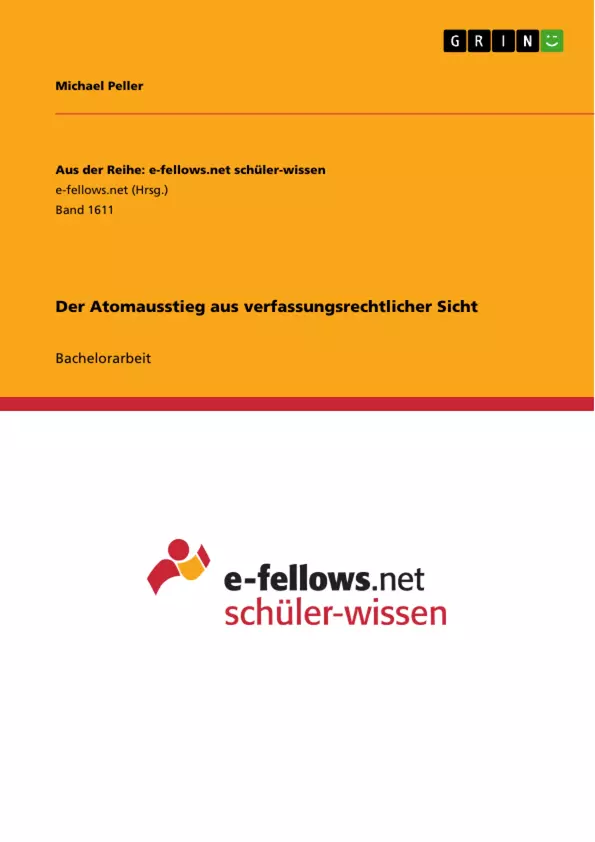Gegenstand dieser Arbeit ist die verfassungsrechtliche Beurteilung der Gesetzesnovellen, die den Atomausstieg regeln.
Kernenergie galt manchen einst als eine Lösung dieser Frage, jedenfalls als notwendiger Bestandteil des Energiemixes. Dass ihre Gefahren jedoch den Nutzen überwiegen, wurde 2011 durch die Katastrophe von Fukushima erneut deutlich. Jedenfalls ist das die derzeit überwiegende Kosten-Risiken-Nutzen-Wahrnehmung in Deutschland. Für den Gesetzgeber war diese Katastrophe daher Grund und Anlass zum erneuten, beschleunigten Atomausstieg.
Wir befinden uns mitten in einer Energiewende, deren eine Säule eben der Ausstieg aus der Kernenergie darstellt. Eine Wende stellt immer auch eine Abkehr vom „Alten“ dar und diejenigen, die für das „Alte“ stehen und in dieses investiert haben, sind die Verlierer der Wende, jedenfalls wenn sie diese verschlafen haben. Im Nachhinein fällt diese Beurteilung leicht. Fraglich ist, inwieweit das Vertrauen auf den Fortbestand des „Alten“ ex ante begründet, die Wende nicht absehbar war.
Bei der Energiewende gewinnt dieser – in der Wirtschaft immer wieder vorkommende – Sachverhalt eine verfassungsrechtliche Dimension. Dies hängt damit zusammen, dass die Energiewirtschaft im Allgemeinen und die Atomwirtschaft im Speziellen in besonderen Maße durch den Staat mit geprägt sind. Der Staat hat dabei einst die Kernenergie gefördert und damit den Kernkraftwerksbetreibern scheinbare Planungssicherheit gegeben, die diese auch benötigten, da es im Wesen der Kernenergie liegt, dass die hohen Investitions- und Entsorgungskosten während des vergleichsweise günstigen Betriebs erwirtschaftet werden müssen. Wenn der Staat nun sein Energiekonzept umwirft, so macht er die einstigen wirtschaftlichen Planungen zunichte.
Inwieweit er sich daher an den Investitions- und Entsorgungskosten beteiligen muss, ist nicht nur eine Frage de lege ferenda, sondern auch de lege lata mit Blick auf die Eigentumsgarantie (Art. 14 I GG). Diese Frage beschäftigt derzeit aufgrund von Verfassungsbeschwerden der Betreiber der deutschen Kernkraftwerke das Bundesverfassungsgericht. Verallgemeinert geht es für den Staat um die Frage, inwieweit er sich durch die gesetzliche Erlaubnis einer bestimmten Technologie selbst bindet und vice versa für Unternehmen, inwieweit sie auf den Fortbestand der Erlaubnis der Nutzung einer bestimmten Technologie vertrauen dürfen und ihre Investitionen insoweit geschützt sind.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- A. PROBLEMENTWICKLUNG
- B. FESTLEGUNG DES PRÜFUNGSGEGENSTANDES UND -MAẞSTABES
- C. GANG DER DARSTELLUNG
- DER ATOMAUSSTIEG AUS VERFASSUNGSRECHTLICHER SICHT
- A. RECHTSSTAND VOR DER ATOMAUSSTIEGSGESETZGEBUNG
- B. GESETZ ZUR GEORDNETEN BEENDIGUNG DER KERNENERGIENUTZUNG ZUR GEWERBLICHEN ERZEUGUNG VON ELEKTRIZITÄT VOM 22. APRIL 2002 (,,BEENDIGUNGSGESETZ\")
- I. GESETZLICHE REGELUNGEN
- II. FORMELLE VERFASSUNGSMÄBIGKEIT
- 1. Zustimmung des Bundesrates nach Art. 87c, 85, 73 I Nr. 14 GG, § 24 IS. 1 AtG
- a) Einführung einer neuen Verfahrensregelung
- b) Änderung des Gesetzeszwecks
- 2. Verstoß gegen Art. 20 I, II, III GG durch eine paktierte Gesetzgebung
- III. MATERIELLE VERFASSUNGSMÄBIGKEIT
- 1. Gebot zur friedlichen Nutzung der Kernenergie aus Art. 73 | Nr. 14(, 87c) GG?
- 2. Pflicht zur Sicherstellung der Energieversorgung und anderer wesentlicher Lebensgrundlagen (Art. 20 1, 28 1 S. 1 GG)
- a) Energieversorgung
- b) Weitere Lebensgrundlagen
- 3. Rechtsstaatsgarantie (Art. 20 III GG)
- 4. Eigentumsgarantie (Art. 14 I S. 1 1. Alt. GG)
- a) Schutzbereich
- (1) Persönlicher Schutzbereich
- (a) Begriff der „juristischen Person“
- (b) ,,Inländisch\" iSd Art. 19 III GG
- (c) Wesensmäßige Anwendbarkeit
- (d) Beteiligung der öffentlichen Hand
- (aa) Inländische staatliche Beteiligung
- (bb) Hundertprozentige ausländische staatlicher Beteiligung
- (2) Sachlicher Schutzbereich
- (a) Geschützte Rechtsposition
- (aa) Grund- und Anlageneigentum
- (bb) Aus dem Grund- und Anlageneigentum erwachsende Nutzungsbefugnisse
- (cc) Betriebsgenehmigung
- (dd) Kombination aus Grund- und Anlageneigentum und Betriebsgenehmigung
- (ee) Eingerichteter und ausgeübter Gewerbebetrieb
- (b) Konkurrenz
- b) Eingriff
- (1) Sichere Merkmale des Enteignungsbegriffs
- (2) Weitere Kriterien
- (a) Materielle Abgrenzungstheorien
- (b) Ausnahme für Gefahrenabwehrregelungen
- (c) Güterbeschaffungsvorgang
- (d) Keine generelle Neugestaltung eines Rechtsgebietes / Regelung, die die abstrakte Eigentumsordnung ändert
- (3) Zwischenergebnis
- c) Rechtfertigung
- (1) Verhältnismäßigkeit
- (a) Geeignetheit zur Verfolgung eines legitimen Zwecks
- (b) Erforderlichkeit
- (c) Verhältnismäßigkeit i.e.S.
- C. DIE 11. ATOMGESETZ-NOVELLE VOM 8. DEZEMBER 2010 (,,LAUFZEITVERLÄNGERUNGSGESETZ\")
- I. GESETZLICHE REGELUNGEN
- II. FORMELLE VERFASSUNGSMÄẞIGKEIT - ZUSTIMMUNG DES BUNDESRATES NACH ART. 87c, 85, 73 I NR. 14 GG, § 24 IS. 1 ATG
- III. MATERIELLE VERFASSUNGSMÄBIGKEIT
- D. DIE 13. ATOMGESETZ-NOVELLE VOM 31. JULI 2011 (,,BESCHLEUNIGTER AUSSTIEG\")
- I. GESETZLICHE REGELUNGEN
- II. FORMELLE VERFASSUNGSMÄBIGKEIT
- III. MATERIELLE VERFASSUNGSMÄBIGKEIT
- Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit des Atomausstiegs
- Die Einhaltung des Grundgesetzes bei der Gesetzgebung zum Atomausstieg
- Die Auswirkungen des Atomausstiegs auf die Energieversorgung und andere Lebensgrundlagen
- Die Rolle der Eigentumsgarantie im Kontext des Atomausstiegs
- Die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit bei der Umsetzung des Atomausstiegs
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit „Der Atomausstieg aus verfassungsrechtlicher Sicht“ untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen und die verfassungsrechtliche Zulässigkeit des Atomausstiegs in Deutschland. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Gesetzesänderungen, die zur Beendigung der Kernenergiegewinnung geführt haben, und beleuchtet die verfassungsrechtlichen Aspekte dieser Entwicklung.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Gegenstand der Untersuchung, die methodische Vorgehensweise und die Struktur der Arbeit erläutert. Im ersten Kapitel wird der Rechtsstand vor der Atomausstiegsgesetzgebung dargestellt, um den Ausgangspunkt der rechtlichen Entwicklung zu beleuchten. Das zweite Kapitel analysiert das „Beendi- gungsgesetz“ von 2002, welches die geordnete Beendigung der Kernenergiegewinnung zum Ziel hatte. Dabei wird die gesetzliche Regelung, die formelle und die materielle Verfassungsmäßigkeit dieses Gesetzes untersucht. Im dritten Kapitel wird die 11. Atomgesetz-Novelle von 2010, das „Laufzeitverlängerungsgesetz“, analysiert. Hier wird die gesetzliche Regelung, die formelle Verfassungsmäßigkeit und die materielle Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes beleuchtet.
Schlüsselwörter
Atomausstieg, Kernenergie, Verfassungsmäßigkeit, Grundgesetz, Energieversorgung, Eigentumsgarantie, Rechtsstaatlichkeit, Gesetzgebung, Beendi- gungsgesetz, Laufzeitverlängerungsgesetz, Atomgesetz-Novelle.
- Citation du texte
- Michael Peller (Auteur), 2016, Der Atomausstieg aus verfassungsrechtlicher Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339091