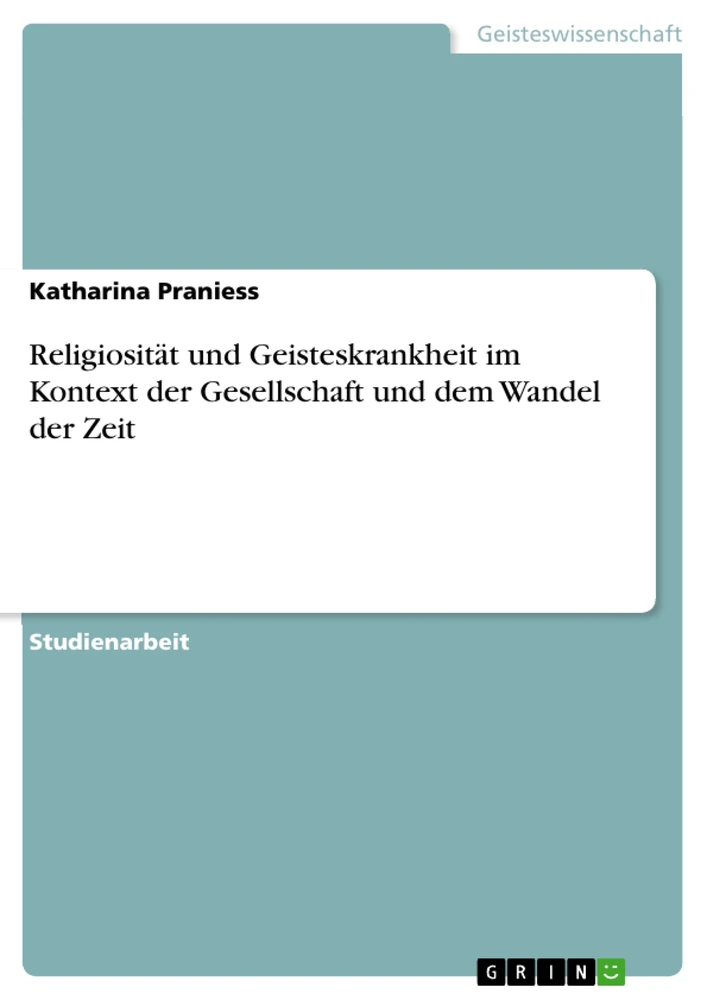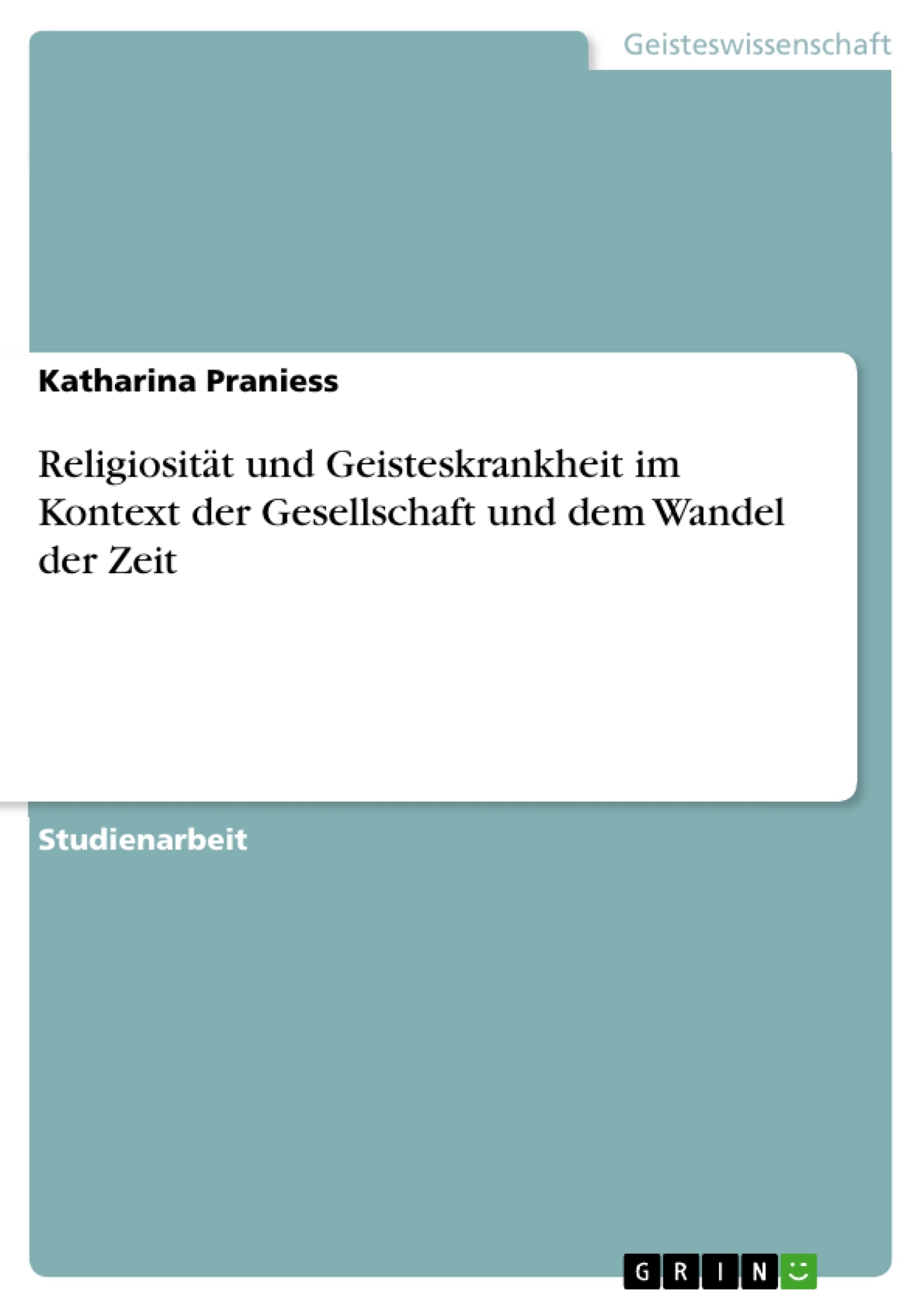Diese Arbeit behandelt die Geschichte der Geisteskrankheit in Europa. Es ist zu beachten, dass sich die so genannte „Geisteskrankheit“ in Europa sowohl geschichtlich als auch im gesellschaftlichen, heutigen Umgang mit psychisch kranken Menschen stark vom Rest der Welt unterscheidet. So werden Menschen mit psychischen Störungen heute in Europa und einigen anderen Ländern nicht als krank oder auch als heilbar angesehen. Trotzdem gibt es in der heutigen Gesellschaft immer noch eine Stigmatisierung psychisch kranker Menschen. So ist die Angst vor dem Umgang mit Betroffenen immer noch in weiten Teilen der Bevölkerung gegeben. Es bedarf hier jedenfalls noch viel Aufklärungsarbeit in der Auseinandersetzung mit psychisch Kranken. Trotzdem sei gesagt, dass Europa im Umgang mit der Geisteskrankheit im Gegensatz zu vielen anderen Ländern fortschrittlich ist. In Indonesien zum Beispiel, geht es psychisch Kranken heutzutage noch sehr schlecht – sie werden zum Teil angekettet und vergessen.
Um den Begriff Geisteskrankheit bestmöglich verstehen zu können, ist es nötig in die Geschichte und Entstehung dieser Konnotation einzutauchen. Hierzu wird diese Arbeit verschiedene Quellen analysieren und versuchen die Entstehung und Form der verschiedenen Paradigmen zum Thema zu klären. Hierbei geht es besonders um die Frage inwieweit sich die Sicht der Gesellschaft auf die Geisteskrankheit verändert hat.
Anhand von Foucaults Werk „Wahnsinn und Gesellschaft“ soll die Entwicklung seiner so genannten Begriffe des „Andersartigen“, „Geisteskranken“ und „Irren“ im Überblick dargestellt werden, um die Veränderungen der verschiedenen Sichtweisen zu veranschaulichen. Mithilfe Bourdieus Werk „Sozialer Sinn“ und insbesondere des Kapitels „Glaube und Leib“ soll dann erklärt werden wie die Gesellschaft Regeln und Normen entwickelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geisteskrankheit im Laufe der Geschichte
- Gesellschaft und Geisteskrankheit
- Gesund oder krank aus gesellschaftlicher Sicht
- Conclusio und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die historische Entwicklung des Verständnisses von Geisteskrankheit und deren gesellschaftliche Konnotation. Sie analysiert die Paradigmenwechsel in der Betrachtung psychischer Erkrankungen und beleuchtet den Einfluss gesellschaftlicher Normen und Vorurteile auf die Behandlung und Wahrnehmung von psychisch kranken Menschen.
- Historische Entwicklung des Begriffs „Geisteskrankheit“
- Gesellschaftliche Stigmatisierung psychisch Kranker
- Der Einfluss von Foucault und Bourdieu auf das Verständnis von Geisteskrankheit
- Vergleichende Betrachtung des Umgangs mit Geisteskrankheit in verschiedenen Kulturen
- Paradigmenwechsel in der Psychiatrie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Umfang und die Ziele der Arbeit. Sie betont die Notwendigkeit, die historische Entwicklung des Begriffs "Geisteskrankheit" zu verstehen, um die heutige gesellschaftliche Wahrnehmung zu beleuchten. Die Arbeit wird verschiedene Quellen analysieren und die Entstehung verschiedener Paradigmen klären, wobei der Fokus auf dem Wandel der gesellschaftlichen Sichtweise liegt. Foucaults Werk "Wahnsinn und Gesellschaft" und Bourdieus "Sozialer Sinn" werden als theoretische Grundlagen herangezogen, um die Entwicklung des Verständnisses von Geisteskrankheit und die Rolle gesellschaftlicher Normen zu analysieren. Der europäische Kontext wird hervorgehoben, mit dem Hinweis auf Unterschiede im Umgang mit psychischen Erkrankungen im Vergleich zu anderen Weltregionen.
Geisteskrankheit im Laufe der Geschichte: Dieses Kapitel verfolgt die historische Entwicklung des Begriffs "Geisteskrankheit" vom Altertum bis zur Gegenwart. Es zeigt, wie sich Definition und Umgang mit psychischen Erkrankungen im Laufe der Zeit verändert haben, eng verknüpft mit gesellschaftlichen, sozialen und wissenschaftlichen Entwicklungen. Das Kapitel beschreibt antike griechische Sichtweisen, die sowohl negative als auch positive Formen des Wahnsinns kannten, und die ersten medizinischen Ansätze zur Behandlung von Geisteskrankheiten. Es verfolgt die Entwicklung von Hippokrates über Celsus bis hin zu den mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Auffassungen, die oft von Ausgrenzung und Stigmatisierung geprägt waren.
Gesellschaft und Geisteskrankheit: Dieses Kapitel analysiert die gesellschaftliche Konstruktion von "Geisteskrankheit". Es beleuchtet den Einfluss von gesellschaftlichen Normen und Vorurteilen auf die Wahrnehmung und Behandlung psychisch Kranker. Die Arbeit von Michel Foucault wird hierbei zentral verwendet, um die Prozesse der Ausgrenzung und Institutionalisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu untersuchen, beginnend mit dem Mittelalter und der Entwicklung von Irrenanstalten. Das Kapitel thematisiert die Angst vor Ansteckung, die Rolle von Narrenschiffen und die Schaustellung von Geisteskranken als Unterhaltung. Die gesellschaftliche Reaktion auf psychische Erkrankungen wird als ein komplexes Zusammenspiel von medizinischen, sozialen und moralischen Faktoren dargestellt.
Schlüsselwörter
Geisteskrankheit, Wahnsinn, Gesellschaft, Stigmatisierung, Geschichte der Psychiatrie, Foucault, Bourdieu, Paradigmenwechsel, soziale Normen, psychische Erkrankung, Ausgrenzung, Institutionalisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Geisteskrankheit und Gesellschaft
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die historische Entwicklung des Verständnisses von Geisteskrankheit und deren gesellschaftliche Konnotation. Sie analysiert Paradigmenwechsel in der Betrachtung psychischer Erkrankungen und den Einfluss gesellschaftlicher Normen und Vorurteile auf deren Behandlung und Wahrnehmung.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Begriffs „Geisteskrankheit“, die gesellschaftliche Stigmatisierung psychisch Kranker, den Einfluss von Foucault und Bourdieu auf das Verständnis von Geisteskrankheit, einen Vergleich des Umgangs mit Geisteskrankheit in verschiedenen Kulturen und Paradigmenwechsel in der Psychiatrie.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Geisteskrankheit im Laufe der Geschichte, ein Kapitel zu Gesellschaft und Geisteskrankheit und eine Conclusio mit Ausblick. Die Einleitung beschreibt Umfang und Ziele der Arbeit und die theoretischen Grundlagen (Foucault, Bourdieu). Das zweite Kapitel verfolgt die historische Entwicklung des Begriffs „Geisteskrankheit“ von der Antike bis zur Gegenwart. Das dritte Kapitel analysiert die gesellschaftliche Konstruktion von „Geisteskrankheit“ und den Einfluss gesellschaftlicher Normen und Vorurteile.
Welche theoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Werke von Michel Foucault ("Wahnsinn und Gesellschaft") und Pierre Bourdieu ("Sozialer Sinn"), um die Entwicklung des Verständnisses von Geisteskrankheit und die Rolle gesellschaftlicher Normen zu analysieren.
Welche Zeiträume werden in der Seminararbeit betrachtet?
Die Seminararbeit betrachtet die Entwicklung des Verständnisses von Geisteskrankheit vom Altertum bis zur Gegenwart.
Welche Aspekte der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Geisteskrankheit werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die gesellschaftliche Stigmatisierung, Ausgrenzung, Institutionalisierung (z.B. Irrenanstalten), die Rolle von gesellschaftlichen Normen und Vorurteilen sowie die Angst vor Ansteckung im Kontext der Wahrnehmung und Behandlung psychisch Kranker.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Geisteskrankheit, Wahnsinn, Gesellschaft, Stigmatisierung, Geschichte der Psychiatrie, Foucault, Bourdieu, Paradigmenwechsel, soziale Normen, psychische Erkrankung, Ausgrenzung, Institutionalisierung.
Gibt es einen europäischen Fokus?
Ja, die Arbeit hebt den europäischen Kontext hervor, erwähnt aber auch Unterschiede im Umgang mit psychischen Erkrankungen in anderen Weltregionen.
- Citar trabajo
- Katharina Praniess (Autor), 2013, Religiosität und Geisteskrankheit im Kontext der Gesellschaft und dem Wandel der Zeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339223