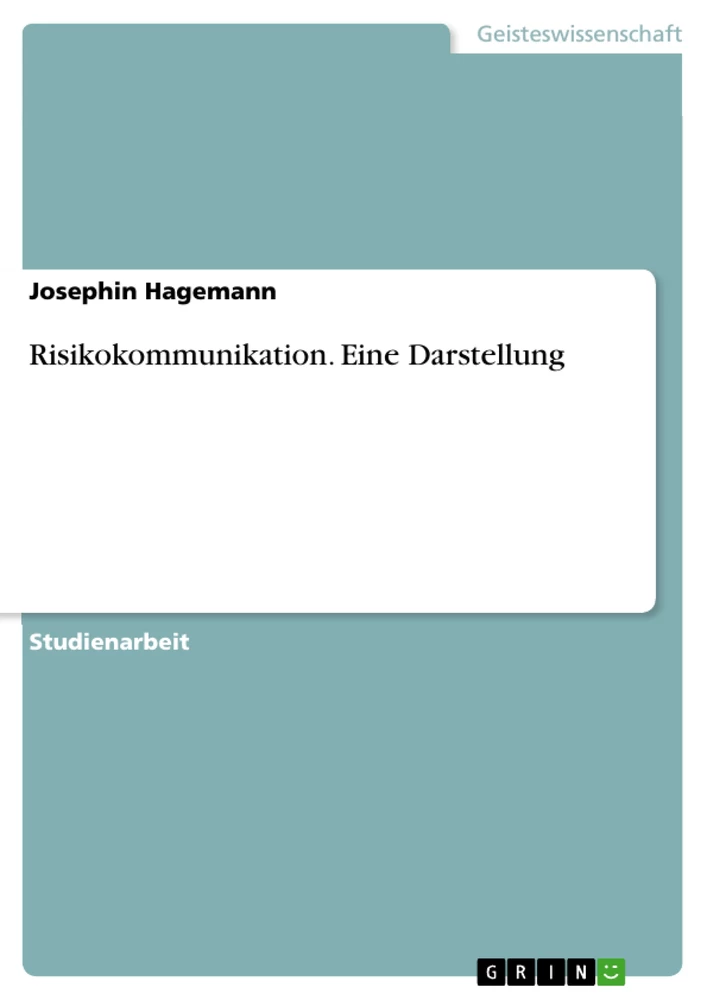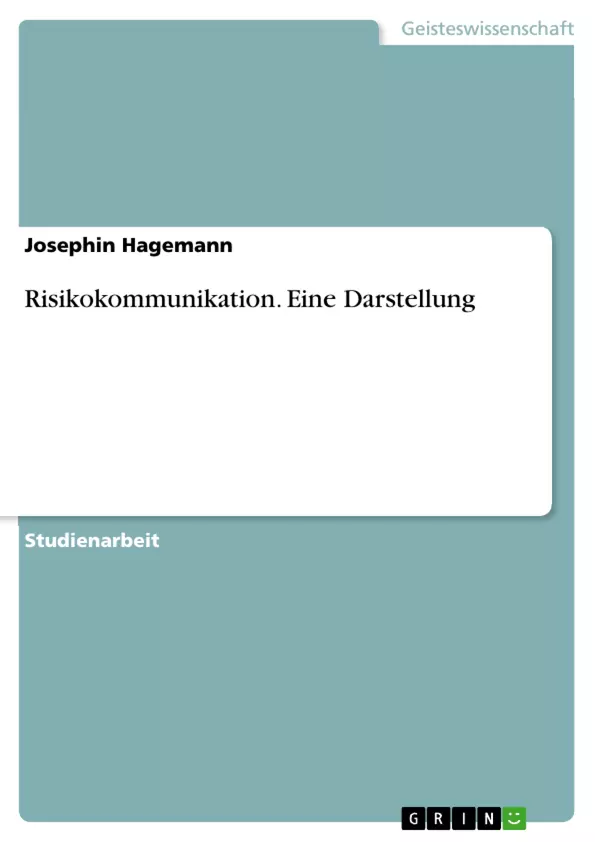Das Thema Risikokommunikation nimmt in der heutigen Gesellschaft eine zunehmend größer werdende Rolle ein. Dies bestätigt unter anderem Bechmann (1993), der es auf die Folgen und Risiken technischer Entwicklungen zurückführt. Luhmann (1991) wiederum führt das steigende Interesse darauf zurück, dass die Menschen eine neue Einstellung zu ihrer Zukunft gewinnen und ihnen bewusst wird, dass Entscheidungen, die die Zukunft betreffen, bereits heute gefällt werden müssen. Und diese veränderte Einstellung ist auf eine neue Qualität der Risiken zurückzuführen, wie Jungermann, Rohrmann und Wiedemann (1990) durch Beispiele aufzeigen. Diese können Nicht-Wahrnehmbarkeit von Strahlung oder Langfristigkeit von Folgen sein, die vorher nicht abzuschätzen sind. Gemeint ist die Schwierigkeit, Wahrscheinlichkeitsaussagen zu treffen, die die Risikokommunikation immer heftiger und schwieriger werden lässt. Jungermann und Slovic (1993b) haben über die Reichweite der Risikokommunikation geschrieben, „Risiko-Kommunikation findet natürlich dauernd statt – über Gesundheitsrisiken, wie sie etwa in Saccharin, Asbest, Rauchen oder Autofahren ohne Sicherheitsgurt verbunden sind, oder Umweltrisiken, die durch Pestizide, Dioxin, Kohlekraftwerke oder petrochemische Anlagen entstehen. Sie reicht von Beipackzetteln zu Medikamenten bis zu im Fernsehen übertragenen öffentlichen Anhörungen von Experten zu Aids.“ (S.197) .
In den nun folgenden Punkten handelt es sich zunächst um eine Definition des Gegenstandsbereichs Risikokommunikation mit Erläuterung derer Bestandteile, Ziele und Strategien. Um allerdings über Risiken kommunizieren zu können, ist es notwendig, dass sie auch wahrgenommen werden. Wobei es nennenswerte und erklärungsbedürftige Wahrnehmungsunterschiede zwischen Laien und Experten gibt. Und aus diesen Wahrnehmungsunterschieden können wiederum Kommunikationsprobleme entstehen. Da derartige Probleme nicht unerheblich sind, sollen sie näher erläutert, und Möglichkeiten zu deren Reduzierung bzw. Vermeidung aufgezeigt werden. Am „heißen“ Thema der Kernenergie sollen die Argumentationen anschließend veranschaulicht werden. Im Schlussteil der Hausarbeit folgt eine kurze Zusammenfassung, um die wichtigsten Elemente nochmals hervorzuheben. Nun beginne ich die Darstellung der Risikokommunikation mit deren Definition.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition Risikokommunikation
- 2.1. Bestandteile von Risikokommunikation
- 2.2. Ziele von Risikokommunikation
- 2.2.1. Strategien zur Zielerreichung
- 3. Risikowahrnehmung als Voraussetzung für Risikokommunikation
- 4. Wahrnehmungsunterschiede zwischen Laien und Experten
- 5. Kommunikationsprobleme, die aus solchen Wahrnehmungsunterschieden entstehen können
- 6. Möglichkeiten der Vermeidung bzw. Minderung von Kommunikationsproblemen zur Optimierung von Risikokommunikation
- 7. Veranschaulichung von Risikokommunikation am Beispiel der Kernenergie
- 8. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Risikokommunikation, ihre Definition, Bestandteile und Herausforderungen. Sie beleuchtet die Unterschiede in der Risikowahrnehmung zwischen Laien und Experten und analysiert daraus resultierende Kommunikationsprobleme. Die Arbeit zeigt Wege zur Verbesserung der Risikokommunikation auf und veranschaulicht diese am Beispiel der Kernenergie.
- Definition und Bestandteile der Risikokommunikation
- Unterschiede in der Risikowahrnehmung zwischen Laien und Experten
- Kommunikationsprobleme aufgrund unterschiedlicher Wahrnehmungen
- Strategien zur Optimierung der Risikokommunikation
- Risikokommunikation im Kontext der Kernenergie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Risikokommunikation ein und betont deren wachsende Bedeutung in der heutigen Gesellschaft. Sie verweist auf die Folgen technischer Entwicklungen und die veränderte Einstellung der Menschen gegenüber zukünftigen Risiken, insbesondere im Hinblick auf die Schwierigkeit, Wahrscheinlichkeitsaussagen zu treffen. Es wird ein Überblick über die Struktur der Arbeit gegeben, welche die Definition, Bestandteile und Herausforderungen der Risikokommunikation beleuchtet und diese am Beispiel der Kernenergie veranschaulicht.
2. Definition Risikokommunikation: Dieses Kapitel bietet verschiedene Definitionen von Risikokommunikation, u.a. von der Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales (1996) und Jungermann, Rohrmann und Wiedemann (1990). Es wird hervorgehoben, dass Risikokommunikation nicht nur die Vermittlung objektiver Risiken umfasst, sondern auch die Berücksichtigung der Wahrnehmung, Einstellungen und Einschätzungen der Laien erfordert. Der Staat und Unternehmen sind als Akteure in den Prozess der Risikokommunikation eingebunden, wobei Aufklärungspflichten im Vordergrund stehen.
2.1. Bestandteile von Risikokommunikation: Dieser Abschnitt beschreibt die dreidimensionale Problemstruktur der Risikokommunikation nach Jungermann, Rohrmann und Wiedemann (1990), die verschiedene Risikothemen, Technikbereiche und Akteure umfasst. Es werden verschiedene Formen öffentlicher Risikokommunikation unterschieden (Aufklärungs-, Legitimations- und Krisenkommunikation) und anhand von Beispielen veranschaulicht. Der Abschnitt betont die unterschiedlichen Weltbilder und Stimmungen in der Gesellschaft, die die Risikokommunikation beeinflussen.
Schlüsselwörter
Risikokommunikation, Risikowahrnehmung, Experten, Laien, Kommunikationsprobleme, Wahrnehmungsunterschiede, Kernenergie, Aufklärung, Krisenkommunikation, Gesundheitsrisiken, Umweltrisiken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Risikokommunikation - Eine umfassende Übersicht
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Übersicht über das Thema Risikokommunikation. Sie definiert Risikokommunikation, untersucht ihre Bestandteile und Herausforderungen, beleuchtet die Unterschiede in der Risikowahrnehmung zwischen Laien und Experten und analysiert daraus resultierende Kommunikationsprobleme. Die Arbeit zeigt Wege zur Verbesserung der Risikokommunikation auf und veranschaulicht diese am Beispiel der Kernenergie. Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Definition Risikokommunikation (inklusive Bestandteile und Ziele), Risikowahrnehmung als Voraussetzung für Risikokommunikation, Wahrnehmungsunterschiede zwischen Laien und Experten, daraus resultierende Kommunikationsprobleme, Möglichkeiten zur Vermeidung/Minderung von Kommunikationsproblemen, Veranschaulichung am Beispiel der Kernenergie und Schlussfolgerungen.
Wie wird Risikokommunikation definiert?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Definitionen von Risikokommunikation, unter anderem von der Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales (1996) und Jungermann, Rohrmann und Wiedemann (1990). Es wird betont, dass Risikokommunikation nicht nur die Vermittlung objektiver Risiken umfasst, sondern auch die Berücksichtigung der Wahrnehmung, Einstellungen und Einschätzungen der Bevölkerung. Der Staat und Unternehmen sind als Akteure in den Prozess eingebunden, wobei Aufklärungspflichten im Vordergrund stehen.
Welche Bestandteile der Risikokommunikation werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt die dreidimensionale Problemstruktur der Risikokommunikation nach Jungermann, Rohrmann und Wiedemann (1990), die verschiedene Risikothemen, Technikbereiche und Akteure umfasst. Verschiedene Formen öffentlicher Risikokommunikation (Aufklärungs-, Legitimations- und Krisenkommunikation) werden unterschieden und anhand von Beispielen erläutert. Der Einfluss unterschiedlicher Weltbilder und Stimmungen in der Gesellschaft auf die Risikokommunikation wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielt die Risikowahrnehmung?
Die Arbeit betont die zentrale Rolle der Risikowahrnehmung. Sie analysiert die Unterschiede in der Risikowahrnehmung zwischen Laien und Experten und untersucht, welche Kommunikationsprobleme aus diesen Unterschieden entstehen können. Die Arbeit unterstreicht die Notwendigkeit, die subjektive Wahrnehmung von Risiken in der Kommunikation zu berücksichtigen.
Wie können Kommunikationsprobleme in der Risikokommunikation vermieden oder gemindert werden?
Die Arbeit beleuchtet Strategien und Möglichkeiten zur Verbesserung der Risikokommunikation, um die Kommunikationsprobleme, die aus unterschiedlichen Wahrnehmungen entstehen, zu vermeiden oder zu mindern. Konkrete Ansätze werden jedoch nicht detailliert beschrieben.
Welches Beispiel wird zur Veranschaulichung verwendet?
Die Arbeit veranschaulicht die Prinzipien und Herausforderungen der Risikokommunikation anhand des Beispiels der Kernenergie.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Risikokommunikation, Risikowahrnehmung, Experten, Laien, Kommunikationsprobleme, Wahrnehmungsunterschiede, Kernenergie, Aufklärung, Krisenkommunikation, Gesundheitsrisiken, Umweltrisiken.
- Quote paper
- Josephin Hagemann (Author), 2004, Risikokommunikation. Eine Darstellung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33926