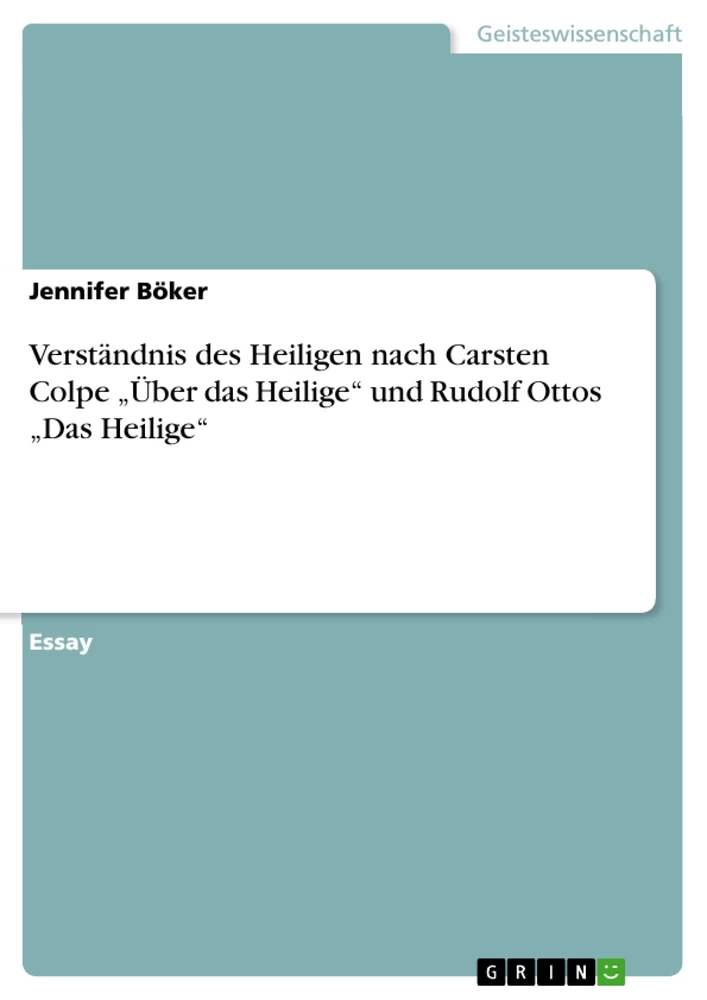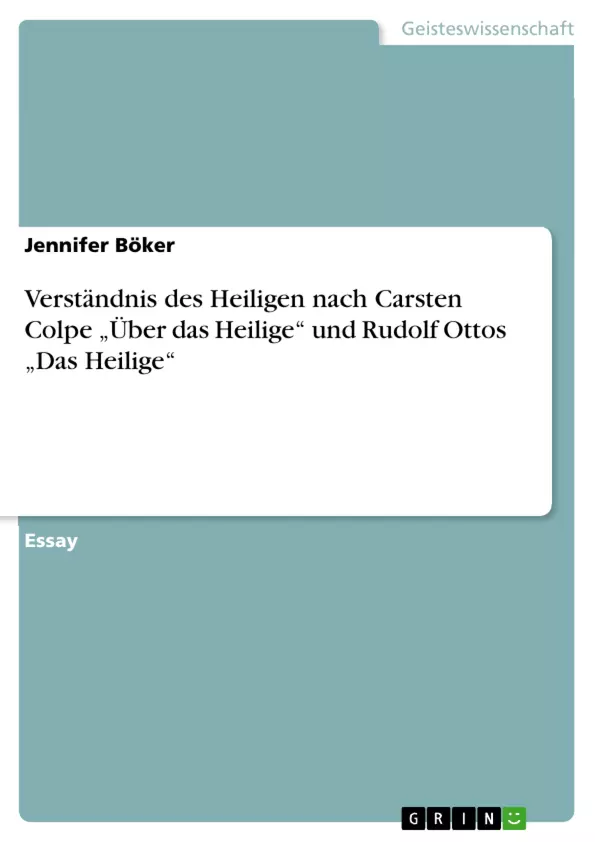Das „Heilige“ war bisher nie ein Punkt über den ich mir lange Gedanken gemacht habe. Es ist einfach da und Bestandteil meines Glaubens. Immer wieder in Gottesdiensten, in Liedern oder einfach im Sprachgebrauch wird das Wort „heilig“ verwendet ohne das sich jedes Mal darüber Gedanken gemacht wird, woher die Bezeichnung kommt oder was Heiligkeit eigentlich bedeutet. Im folgenden werde ich mit zwei Herangehensweisen auseinander setzten, der von Carsten Colpe und der von Rudolf Otto.
Inhaltsverzeichnis
- Colpe hält es für wichtiger sich zunächst darüber klar zu werden was früher als heilig bezeichnet wurde und wer es getan hat und damit verbunden zu versuchen es nachzuvollziehen, als nach einem Beweis für die Existenz der Heiligkeit zu suchen.
- Eine Verallgemeinerung des Heiligkeitsbegriffes ist nicht möglich, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass unter heilig immer dasselbe verstanden worden ist oder ob es Abweichungen gibt.
- Colpes Werk beinhaltet einige Schriften von Theologen. Einer von diesen ist Walter Baetke, der betont, dass es zwei Arten der Definition des „Heiligen“ gibt: Die Fremddefinition durch Sachdiskussion und die Selbstdefinition, in dem man mit „heilig“ übersetzte Worte analysiert.
- Darüber hinaus fehlen urgeschichtliche Quellen um nachvollziehen zu können, wie es damals war. Es kann nur rückgeschlossen werden, da es sprachliche Verständigungsschwierigkeiten gab und nichts schriftlich festgehalten wurde.
- Colpe nennt drei Beispiele, bei denen das Wort „heilig“ verwendet, doch Unterschiedliches damit gemeint wird.
- Zu überlegen ist auch ob es das „Heilige“ immer schon gab oder ob es ein Symbol ist und aus den Taten der früheren Menschen entstanden ist.
- Wahrscheinlich wurde das „Heilige“ in eine Art Form eingeordnet, die prägend für das Leben war. Doch nennt Colpe dafür zwei Voraussetzungen: Zunächst ist die „empirische Natürlichkeit“ des Menschen in eine „Nicht-mehr oder Mehr-als-Natürlichkeit“ übergegangen, so dass es möglich ist Erfahrungen zu wiederholen, sie zu bedenken, zu verbessern und auszudrücken.
- Colpe bezieht sich in seinen Büchern noch auf einige andere Theologen außer Baetke. Vor Baetke noch auf Jakob Friedrich Fries, der das aus der Bibel überlieferte Heilige als religiöse, innerliche Erfahrung und als ihre Voraussetzung, und Inhalt bezeichnet.
- Als nächstes benennt Colpe Ernst Cassirer, der der Meinung ist, das jeder, der das „Heilige“ nicht verstehen oder begreifen kann, sich überlegt ob er in alten Sprachen bezeugt wurde und wenn er dies nicht leugnet das „Heilige“ in den Mythen erfahren kann.
- Fustel de Coulanges betonte das Problem des „Heiligen“ in der archaischen Gesellschaft und begann damit die Debatte über den Stellenwert des „Heiligen“ in der Religion, vorausgesetzt, dass das „Heilige“ Grundlage, Ursprung oder Wesen der Religion ist oder sie verkörpern kann.
- In der Antike gab es im Ahnenkult den Ausgangspunkt für die Entstehung der Religion, wobei Colpe betont, dass es sich hierbei noch nicht um Religion handelte.
- Emile Durkheim vertritt den Ansatz der Zweiteilung der Welt in die „heiligen“ und die profanen Dinge.
- Für den Anfang des Heiligen und Profanen beziehungsweise die Reihenfolge der Entstehung gibt es drei Ansätze.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit dem Verständnis des Heiligen nach Carsten Colpe und Rudolf Otto. Er analysiert Colpes Position, die sich auf die historische Entwicklung des Heiligkeitsbegriffes konzentriert, und stellt diese dann Ottos "Das Heilige" gegenüber. Die Arbeit untersucht, wie beide Autoren das Heilige definieren und welche Ansätze sie für die Erforschung des Heiligen vorschlagen.
- Historische Entwicklung des Heiligkeitsbegriffes
- Definition des Heiligen nach Colpe und Otto
- Ansätze für die Erforschung des Heiligen
- Vergleich der Positionen von Colpe und Otto
- Relevanz des Heiligkeitsbegriffes für die Religionswissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit einer persönlichen Einführung in das Thema "Heiligkeit", die die eigene Auseinandersetzung mit dem Begriff und die Motivation für die Arbeit verdeutlicht. Anschließend erläutert der Essay die Position von Carsten Colpe, der die historische Entwicklung des Heiligkeitsbegriffes untersucht. Colpe argumentiert, dass es unmöglich ist, den Begriff des Heiligen zu verallgemeinern, da er in verschiedenen Epochen und Kulturen unterschiedliche Bedeutungen hatte. Er analysiert verschiedene Texte, um die Vielfältigkeit des Heiligkeitsbegriffes zu verdeutlichen. Colpe stellt auch die Frage, ob das Heilige ein Symbol ist, das aus den Taten der Menschen entstanden ist, oder ob es etwas objektiv Gegebenes ist.
Schlüsselwörter
Heiligkeit, Religionswissenschaft, Carsten Colpe, Rudolf Otto, Historische Entwicklung, Heiligkeitsbegriff, Fremddefinition, Selbstdefinition, Urgeschichtliche Quellen, Pantheismus, Empirische Natürlichkeit, Anthropologische Verifizierung, Archaische Gesellschaft, Zweiteilung der Welt, Profanes, Entheiligung, Profanisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Rudolf Ottos Werk "Das Heilige"?
Otto definiert das Heilige als das "Numinose" – eine Erfahrung des "Mysterium tremendum et fascinans", das den Menschen zugleich erschreckt und fasziniert.
Wie nähert sich Carsten Colpe dem Begriff des Heiligen?
Colpe setzt auf einen historischen und sprachwissenschaftlichen Ansatz; er untersucht, was früher als heilig bezeichnet wurde und wie sich der Begriff gewandelt hat.
Was ist der Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Profanen?
Nach Emile Durkheim ist die Welt zweigeteilt: Das Heilige ist das Besondere, Abgegrenzte, während das Profane das Alltägliche und Gewöhnliche darstellt.
Gibt es eine allgemeingültige Definition von "Heiligkeit"?
Laut Colpe ist eine Verallgemeinerung schwierig, da der Begriff in verschiedenen Kulturen und Epochen unterschiedliche Bedeutungen und Abweichungen aufweist.
Was bedeutet "Fremddefinition" nach Walter Baetke?
Es ist die Definition des Heiligen durch eine sachliche Diskussion von außen, im Gegensatz zur Selbstdefinition durch die Analyse religiöser Quellbegriffe.
Welche Rolle spielt der Ahnenkult für die Entstehung der Religion?
In der Antike galt der Ahnenkult oft als Ausgangspunkt, wobei Colpe betont, dass dies zwar prägend war, aber noch nicht der vollendeten Form von Religion entsprach.
- Quote paper
- Jennifer Böker (Author), 2012, Verständnis des Heiligen nach Carsten Colpe „Über das Heilige“ und Rudolf Ottos „Das Heilige“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339322