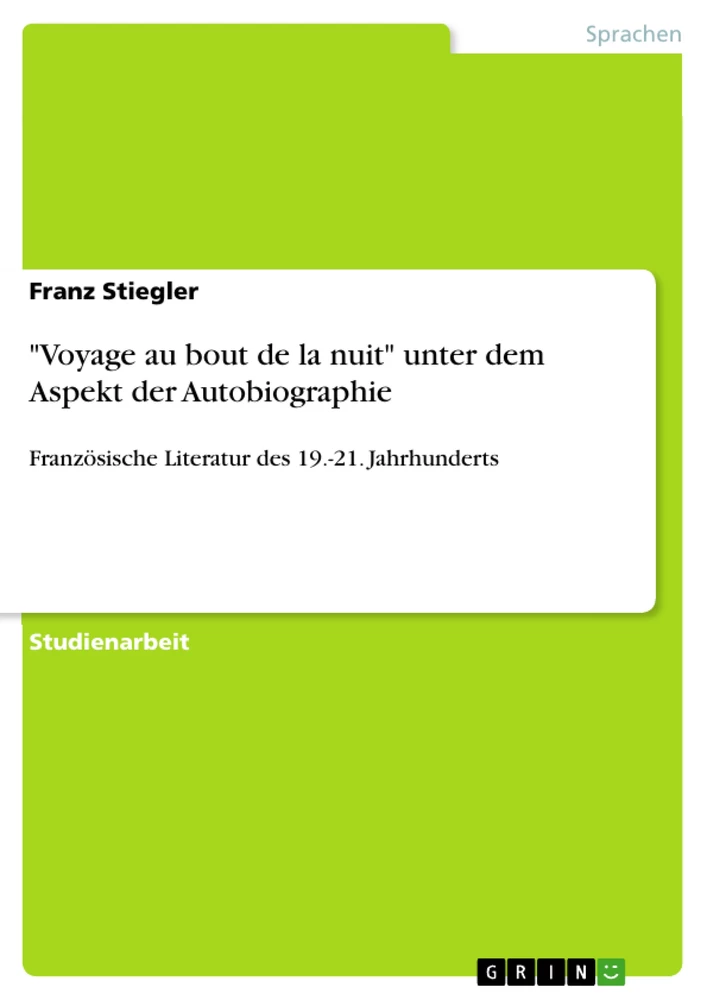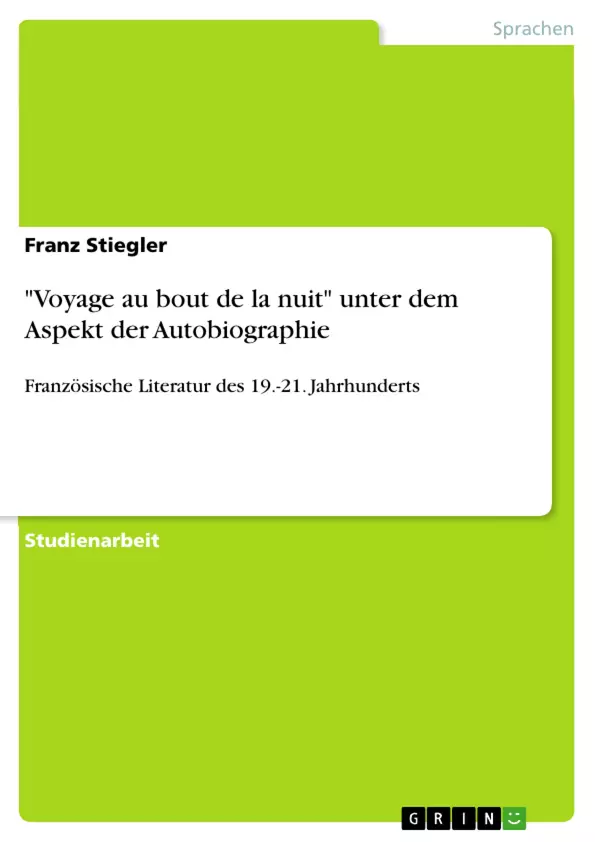Wenn man das Leben Célines mit der Reise Bardamus vergleicht fallen einige Ähnlichkeiten auf, wodurch die Reise keinen „rein erfundenen” Eindruck mehr macht. Diese Parallelen zwischen Schriftsteller und Protagonisten erwecken viel mehr den Eindruck, als dass das Werk eine Ausformulierung Célines Gedanken und Taten ist, geschrieben durch ihn selbst – also eine Autobiographie. Ob diese Feststellung richtig ist, oder ob es doch einige Unterschiede gibt, welche dieser Aussage widersprechen und somit doch auf Fiktion hinweisen, soll diese Arbeit klären.
Hierfür wird der Roman zunächst gattungsspezifisch eingeordnet, indem das Werk anhand einer Auswahl an Romangattungen analysiert wird. Durch diese Untersuchung soll geklärt werden, ob das Werk "Voyage au bout de la nuit" eindeutig zuzuordnen ist, oder ob dessen Charakter auf mehrere Gattungen zutrifft. Anschließend überprüft eine Gegenüberstellung von Schriftsteller und Protagonisten, wie stark sich deren Leben überschneiden und in welchem Maß der Roman demzufolge als Autobiographie bezeichnet werden kann. Zu diesem Zweck wird zunächst Bardamus Leben in Europa, danach dessen Erfahrungen in Afrika mit Célines Aufzeichnungen verglichen. Die auftretenden Parallelen, sowie die Unterschiede, werden anhand von Textstellen aus "Voyager au bout de la nuit" aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gattungsspezifische Einordnung von Voyage au bout de la nuit
- Historischer Roman
- Entwicklungsroman
- Schelmen-/ Pikaroroman
- Autobiographischer Roman
- Unterschiede zwischen den Vergangenheiten von Céline und Bardamu
- Vergleich 1: Bardamu und Céline zur Zeit des 1. Weltkrieges
- Vergleich 2: Bardamu und Céline in Kolonialafrika
- Conclusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert den Roman Voyage au bout de la nuit (1932) von Louis-Ferdinand Céline unter dem Aspekt der Autobiographie. Ziel ist es, die gattungsspezifische Einordnung des Werkes zu untersuchen und die Parallelen und Unterschiede zwischen dem Leben des Autors und den Erlebnissen seines Protagonisten, Ferdinand Bardamu, zu beleuchten.
- Gattungsspezifische Einordnung des Romans
- Vergleich der Lebenswege von Céline und Bardamu
- Analyse der autobiographischen Elemente in Voyage au bout de la nuit
- Der Einfluss des 1. Weltkriegs und der Kolonialzeit auf die Handlung
- Die Rolle des Antihelden Bardamu in der Darstellung der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Roman Voyage au bout de la nuit vor und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Sie beleuchtet den ambivalenten Empfang des Werkes und die Frage nach seinem autobiographischen Charakter.
Das zweite Kapitel widmet sich der gattungsspezifischen Einordnung des Romans. Es untersucht, inwieweit Voyage au bout de la nuit als historischer Roman, Entwicklungsroman, Schelmenroman und autobiographischer Roman zu betrachten ist.
Das dritte Kapitel vergleicht die Lebenswege von Céline und Bardamu, insbesondere in Bezug auf ihre Erfahrungen im 1. Weltkrieg und in Kolonialafrika. Es analysiert die Parallelen und Unterschiede zwischen ihren Erlebnissen und wie diese im Roman dargestellt werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Autobiographie, literarische Gattungen, historischer Roman, Entwicklungsroman, Schelmenroman, Antiheld, 1. Weltkrieg, Kolonialismus, soziale Kritik, Louis-Ferdinand Céline, Ferdinand Bardamu, Voyage au bout de la nuit.
Häufig gestellte Fragen
Ist "Reise ans Ende der Nacht" eine Autobiographie?
Die Arbeit untersucht, inwieweit der Roman autobiographische Züge trägt. Während es starke Parallelen zwischen dem Autor Céline und dem Protagonisten Bardamu gibt, finden sich auch fiktive Elemente.
In welche literarischen Gattungen lässt sich der Roman einordnen?
Das Werk weist Merkmale des historischen Romans, des Entwicklungsromans, des Schelmenromans (Pikaroroman) und des autobiographischen Romans auf.
Welche Parallelen gibt es zwischen Céline und Bardamu im 1. Weltkrieg?
Die Arbeit vergleicht Célines eigene Kriegserfahrungen und Aufzeichnungen mit den Erlebnissen Bardamus in Europa während des Ersten Weltkriegs.
Wie wird Kolonialafrika im Roman dargestellt?
Der Roman beleuchtet Bardamus Erfahrungen in Afrika, die ebenfalls mit Célines realen Aufzeichnungen aus der Kolonialzeit verglichen werden, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen.
Wer ist der Protagonist Ferdinand Bardamu?
Ferdinand Bardamu ist der Antiheld des Romans, dessen Reise durch Krieg, Kolonialismus und soziale Abgründe eine scharfe Kritik an der damaligen Gesellschaft darstellt.
- Quote paper
- Franz Stiegler (Author), 2016, "Voyage au bout de la nuit" unter dem Aspekt der Autobiographie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339372