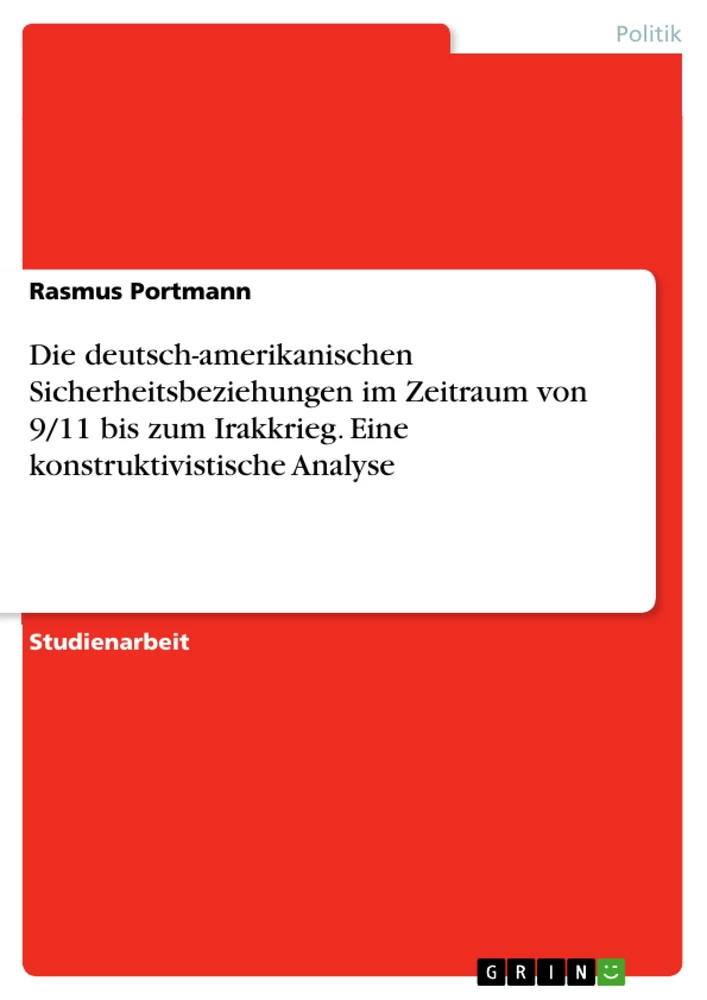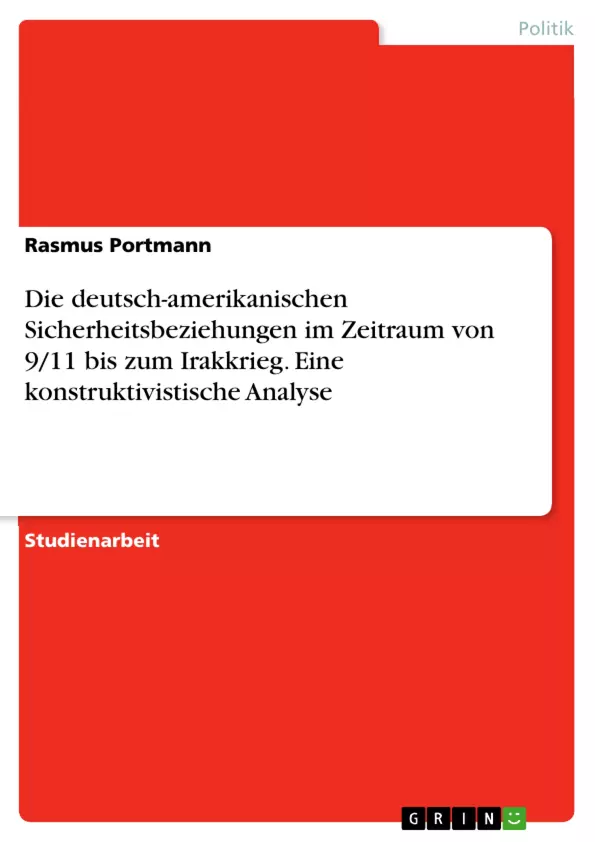Das Thema dieser Seminararbeit sind die deutsch-amerikanischen Sicherheitsbeziehungen ab den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 bis zum Beginn des Irakkrieges. Die durch die zahlreichen Konflikte und Umwälzungen im Internationalen System entstandene Interaktionsnotwendigkeit zwischen den Akteuren des Internationalen Systems, vor allem zwischen Deutschland und den USA, lassen konstruktivistische Ansätze hier am geeignetsten erscheinen.
Neben der dem strukturellen Ansatz von Wendt soll vor allem in Bezug auf die Eigenwahrnehmung Deutschlands ein rollentheoretischer, akteursbezogener Ansatz nach Kirste und Maull angewendet werden. Dies scheint geeignet um sowohl die systemrelevanten als auch die akteursrelevanten Aspekte des Konstruktivismus zu umfassen und zu berücksichtigen. Um dem in dieser Arbeit zugrundeliegenden Konstruktivismusverständnis gerecht zu werden und die Konstituierung von Akteur und Struktur sinnvoll zu ergänzen ist es daher wichtig beide Ebenen, die des Akteurs und die der Struktur, zu beschreiben.
Die Frage die in dieser Seminararbeit beantwortet werden soll, ist, wieso sich das Verhältnis zwischen diesen beiden Staaten innerhalb einer Zeitspanne von knapp 2 Jahren so dramatisch verändert hat. Wie ist die Abkühlung des Verhältnisses zu erklären? Auf beiden Seiten des Atlantiks wurde eingesehen, dass die Beziehungen zwischen beiden Staaten so kühl sind wie sie lange nicht mehr waren. „The winter of 2002/2003 was the coldest ever experienced in the most successful transatlantic relationship since the days of the Mayflower“ (Künhardt 2004:1). Auf beiden Seiten wurde rhetorisch nicht mit Superlative (im negativen Sinne) gespart. Es wurde von einem Ende der transatlantischen Partnerschaft gesprochen oder gar vom Ende der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Dem Grund solcher verbalen Entgleisungen und den daraus folgenden Reaktionen soll diese Arbeit nun nachgehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die strukturellen Veränderungen des Internationalen System nach 1989/1990
- Der Sozialkonstruktivismus nach Wendt (struktureller Ansatz)
- Prämissen des Sozialkonstruktivismus
- Staaten sind die Hauptakteur
- Identitäten und Interessen entstehen durch Interaktion
- Interaktionen münden in Institutionen
- Die Struktur des internationalen System besteht aus intersubjektiv geteiltem Wissen
- Das internationale System unterliegt ständigen Tranformationsprozessen
- Akteur-Struktur-Problem
- Prämissen des Sozialkonstruktivismus
- Der rollentheoretische Ansatz (akteursbezogene Ansatz)
- Definition der Rollentheorie
- Zivilmacht als Rollenkonzept
- Rollenkonzeption Deutschlands
- Implikationen für die deutsch-amerikanischen Beziehungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die deutsch-amerikanischen Sicherheitsbeziehungen im Zeitraum von 9/11 bis zum Irakkrieg. Sie analysiert die Abkühlung des Verhältnisses zwischen beiden Staaten in dieser Zeitspanne und versucht, die Gründe für diese Entwicklung zu erklären. Die Arbeit basiert auf konstruktivistischen Ansätzen und greift sowohl den strukturellen Ansatz von Wendt als auch den rollentheoretischen, akteursbezogenen Ansatz von Kirste und Maull auf.
- Die strukturellen Veränderungen des Internationalen Systems nach dem Ende des Kalten Krieges
- Die Rolle des Sozialkonstruktivismus in der Analyse internationaler Beziehungen
- Die Bedeutung von Identitätsbildung und Interessenkonvergenz in der deutsch-amerikanischen Beziehung
- Die Anwendung des rollentheoretischen Ansatzes auf Deutschland und seine Rolle in der internationalen Politik
- Die Auswirkungen des 11. September 2001 und des Irakkriegs auf die deutsch-amerikanische Beziehung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der deutsch-amerikanischen Sicherheitsbeziehungen im Kontext der Ereignisse von 9/11 und des Irakkriegs ein. Es stellt die Relevanz konstruktivistischer Ansätze für die Analyse dieser Beziehungen dar und erläutert die beiden in der Arbeit verwendeten Ansätze. Das zweite Kapitel untersucht die strukturellen Veränderungen des Internationalen Systems nach dem Ende des Kalten Krieges und deren Bedeutung für die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Das dritte Kapitel stellt die Prämissen und Grundannahmen des Sozialkonstruktivismus nach Wendt dar und beleuchtet das Akteur-Struktur-Problem. Das vierte Kapitel widmet sich dem rollentheoretischen Ansatz von Kirste und Maull und erläutert die Bedeutung von Rollenkonzepten für die Analyse von Staatenverhalten. Schließlich werden im fünften Kapitel die beiden Theorieansätze auf das deutsch-amerikanische Verhältnis angewandt und die Gründe für die Abkühlung der Beziehung diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den deutsch-amerikanischen Sicherheitsbeziehungen, dem Sozialkonstruktivismus, dem rollentheoretischen Ansatz, dem internationalen System, Identitätsbildung, Interessenkonvergenz, 9/11, Irakkrieg, und dem Akteur-Struktur-Problem.
Häufig gestellte Fragen
Welcher Zeitraum wird in der Analyse der deutsch-amerikanischen Beziehungen untersucht?
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Sicherheitsbeziehungen zwischen den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und dem Beginn des Irakkrieges 2003.
Welche theoretischen Ansätze werden in der Arbeit verwendet?
Es werden konstruktivistische Ansätze genutzt, insbesondere der strukturelle Ansatz von Alexander Wendt sowie der rollentheoretische, akteursbezogene Ansatz nach Kirste und Maull.
Was ist die Kernfrage der Seminararbeit?
Die Arbeit fragt, warum sich das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA innerhalb von nur zwei Jahren so dramatisch verschlechterte und wie diese „Abkühlung“ zu erklären ist.
Was besagt der Sozialkonstruktivismus nach Wendt?
Nach Wendt entstehen Identitäten und Interessen von Staaten durch Interaktion, und die Struktur des internationalen Systems besteht aus intersubjektiv geteiltem Wissen.
Was bedeutet das Rollenkonzept der „Zivilmacht“ für Deutschland?
Das Konzept der Zivilmacht beschreibt Deutschlands außenpolitische Identität, die stark auf Multilateralismus und völkerrechtliche Bindung setzt, was im Konflikt um den Irakkrieg relevant wurde.
Welche Rolle spielt das Akteur-Struktur-Problem in der Analyse?
Es wird untersucht, wie sowohl die Struktur des internationalen Systems als auch das spezifische Verhalten der Akteure (Deutschland/USA) die gegenseitigen Beziehungen konstituieren.
- Arbeit zitieren
- Rasmus Portmann (Autor:in), 2014, Die deutsch-amerikanischen Sicherheitsbeziehungen im Zeitraum von 9/11 bis zum Irakkrieg. Eine konstruktivistische Analyse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339480