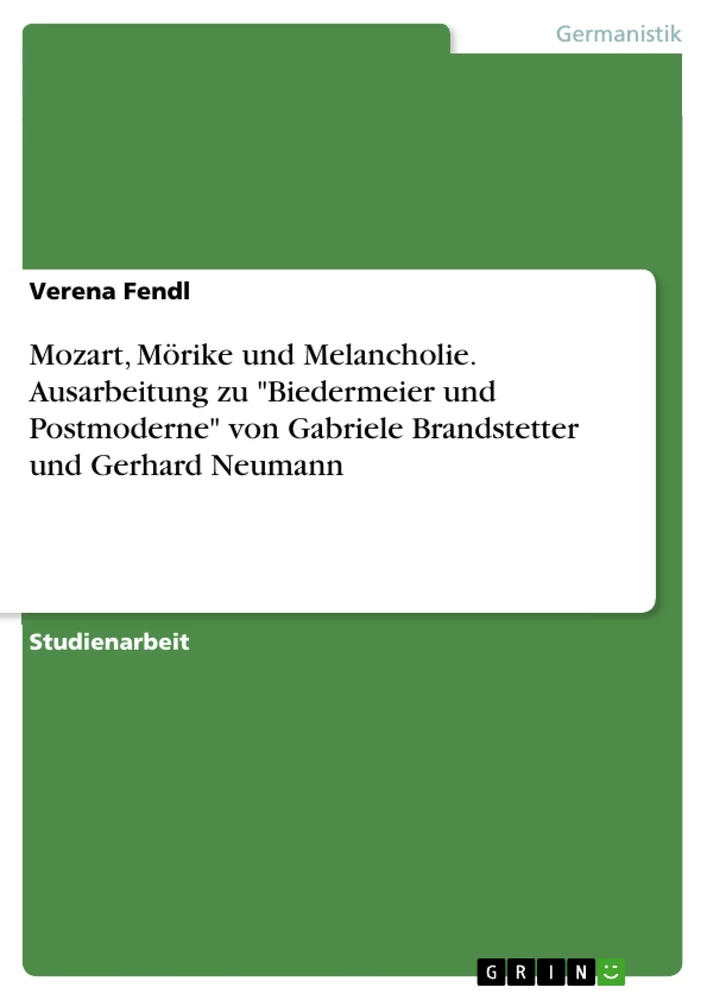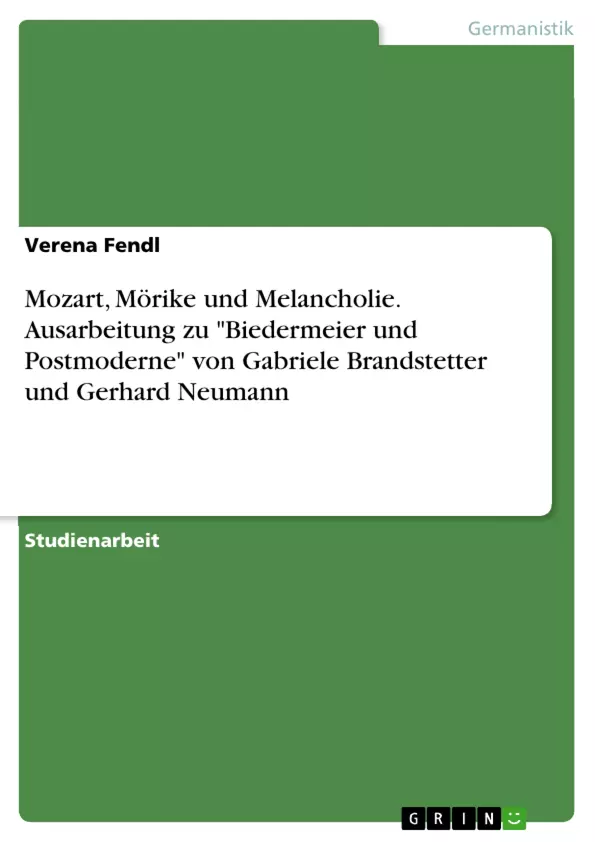Die vorliegende Ausarbeitung fasst den Inhalt von "Biedermeier und Postmoderne: zur Melancholie des schöpferischen Augenblicks"; Mörikes Novelle "Mozart auf der Reise nach Prag" und Shaffers "Amadeus" von Gabriele Brandstetter und Gerhard Neumann zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung des Inhalts
- I.
- Mörikes Novelle und der Mythos Mozart
- Die Verfasstheit des Subjekts im postrevolutionären Europa
- Die Positionierung Mörikes zwischen Goethe und Kafka
- II.
- Der "Mythos Mozart" im 19. und 20. Jahrhundert
- Mozart als Verkörperung des Wunderkinds
- Die Ambivalenz des Naturkörpers
- Die Frage nach der Herkunft schöpferischer Kraft
- Die tragische Angewiesenheit des Genies
- III.
- Die Grundfrage der Novelle: Integration des schöpferischen Subjekts
- Die Schlüsselszene des Schöpfungsaugenblicks
- Die labile Identität des schöpferischen Subjekts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung befasst sich mit Eduard Mörikes Novelle "Mozart auf der Reise nach Prag" und analysiert diese im Kontext der "Melancholie des schöpferischen Augenblicks" in Verbindung mit dem "Mythos Mozart". Ziel ist es, die Positionierung Mörikes innerhalb der kulturgeschichtlichen Entwicklung des schöpferischen Subjekts zwischen Goethe und Kafka zu beleuchten sowie die relevanten Aspekte des "Mythos Mozart" im 19. und 20. Jahrhundert zu untersuchen.
- Die Verfasstheit des Subjekts im postrevolutionären Europa
- Die Integration des Außerordentlichen in die bürgerliche Lebenswelt
- Die Problematik der schöpferischen Phantasie in einer normierten Gesellschaft
- Die Ambivalenz des Naturkörpers in Bezug auf schöpferische Kraft
- Die Frage nach der Herkunft und Beglaubigung schöpferischer Kraft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Zusammenfassung des Inhalts skizziert die Handlung der Novelle, die einen Tag im Leben Mozarts auf seiner Reise nach Prag schildert. Im ersten Kapitel wird die Bedeutung des Mottos aus Oulibicheffs Mozart-Biographie für die Novelle erläutert und die Positionierung Mörikes innerhalb der Entwicklung des schöpferischen Subjekts zwischen Goethe und Kafka beleuchtet. Das zweite Kapitel analysiert den "Mythos Mozart" im 19. und 20. Jahrhundert und identifiziert vier zentrale Aspekte, die den Mythos prägen: Mozart als Verkörperung des Wunderkinds, die Ambivalenz des Naturkörpers, die Frage nach der Herkunft schöpferischer Kraft und die tragische Angewiesenheit des Genies. Das dritte Kapitel fokussiert auf die Grundfrage der Novelle, nämlich die Integration des schöpferischen Subjekts in die soziale Welt, und analysiert die Schlüsselszene des Schöpfungsaugenblicks sowie die labile Identität des schöpferischen Subjekts.
Schlüsselwörter
Die Ausarbeitung befasst sich mit zentralen Themen wie dem "Mythos Mozart", dem schöpferischen Subjekt, der Melancholie des schöpferischen Augenblicks, der Integration des Außerordentlichen in die bürgerliche Lebenswelt, der Ambivalenz des Naturkörpers, der Frage nach der Herkunft schöpferischer Kraft und der tragischen Angewiesenheit des Genies. Darüber hinaus werden Aspekte wie die Verfasstheit des Subjekts im postrevolutionären Europa, die Positionierung Mörikes zwischen Goethe und Kafka sowie die Schlüsselszene des Schöpfungsaugenblicks in der Novelle behandelt.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Mörikes Novelle „Mozart auf der Reise nach Prag“?
Die Novelle schildert einen fiktiven Tag im Leben Mozarts auf seiner Reise nach Prag. Sie thematisiert die Melancholie des schöpferischen Augenblicks und die Fragilität des Genies.
Was versteht man unter dem „Mythos Mozart“ im 19. Jahrhundert?
Der Mythos umfasst Aspekte wie die Verkörperung des Wunderkinds, die tragische Angewiesenheit des Genies und die Ambivalenz zwischen seiner übermenschlichen schöpferischen Kraft und seiner menschlichen Labilität.
Wie positioniert sich Mörike zwischen Goethe und Kafka?
Mörike steht an einer kulturgeschichtlichen Schwelle: Er reflektiert die Verfasstheit des Subjekts im postrevolutionären Europa, wobei er sich von Goethes klassischer Harmonie entfernt und bereits die moderne Entfremdung vorwegnimmt.
Was ist die zentrale Problemstellung der Novelle laut Brandstetter und Neumann?
Die Kernfrage ist die Integration des schöpferischen, außerordentlichen Subjekts in die bürgerliche, normierte Lebenswelt und die damit einhergehende Melancholie.
Welche Rolle spielt die Melancholie in der Novelle?
Die Melancholie ist eng mit dem schöpferischen Augenblick verbunden. Sie resultiert aus der Erkenntnis der Vergänglichkeit und der labilen Identität des Künstlers, der zwischen göttlicher Inspiration und menschlichem Verfall steht.
- Quote paper
- Verena Fendl (Author), 2012, Mozart, Mörike und Melancholie. Ausarbeitung zu "Biedermeier und Postmoderne" von Gabriele Brandstetter und Gerhard Neumann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339493