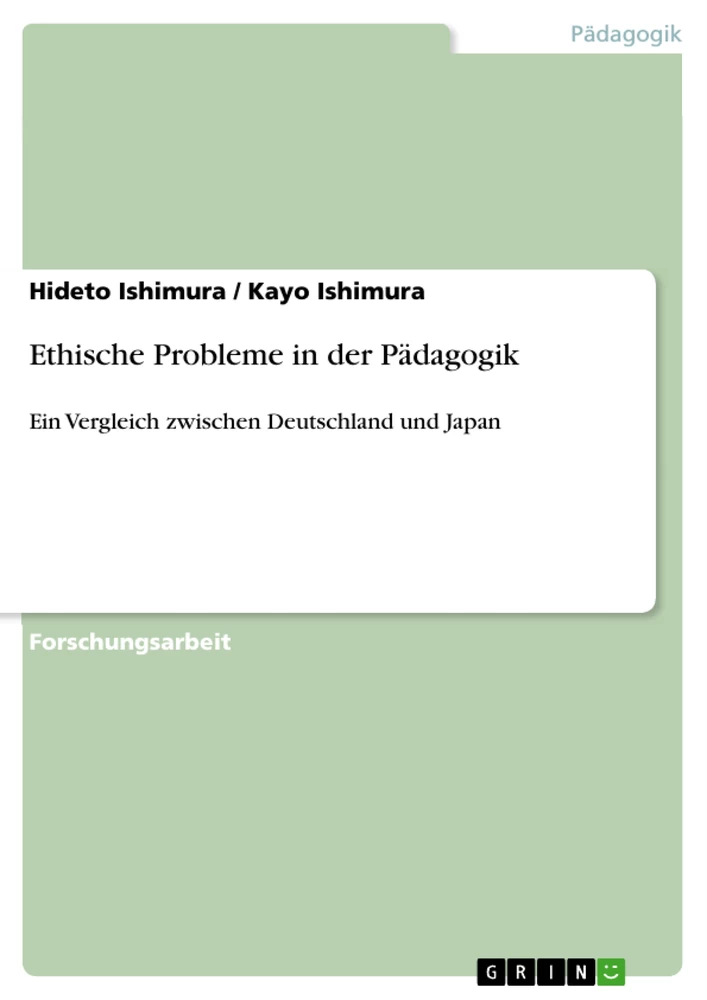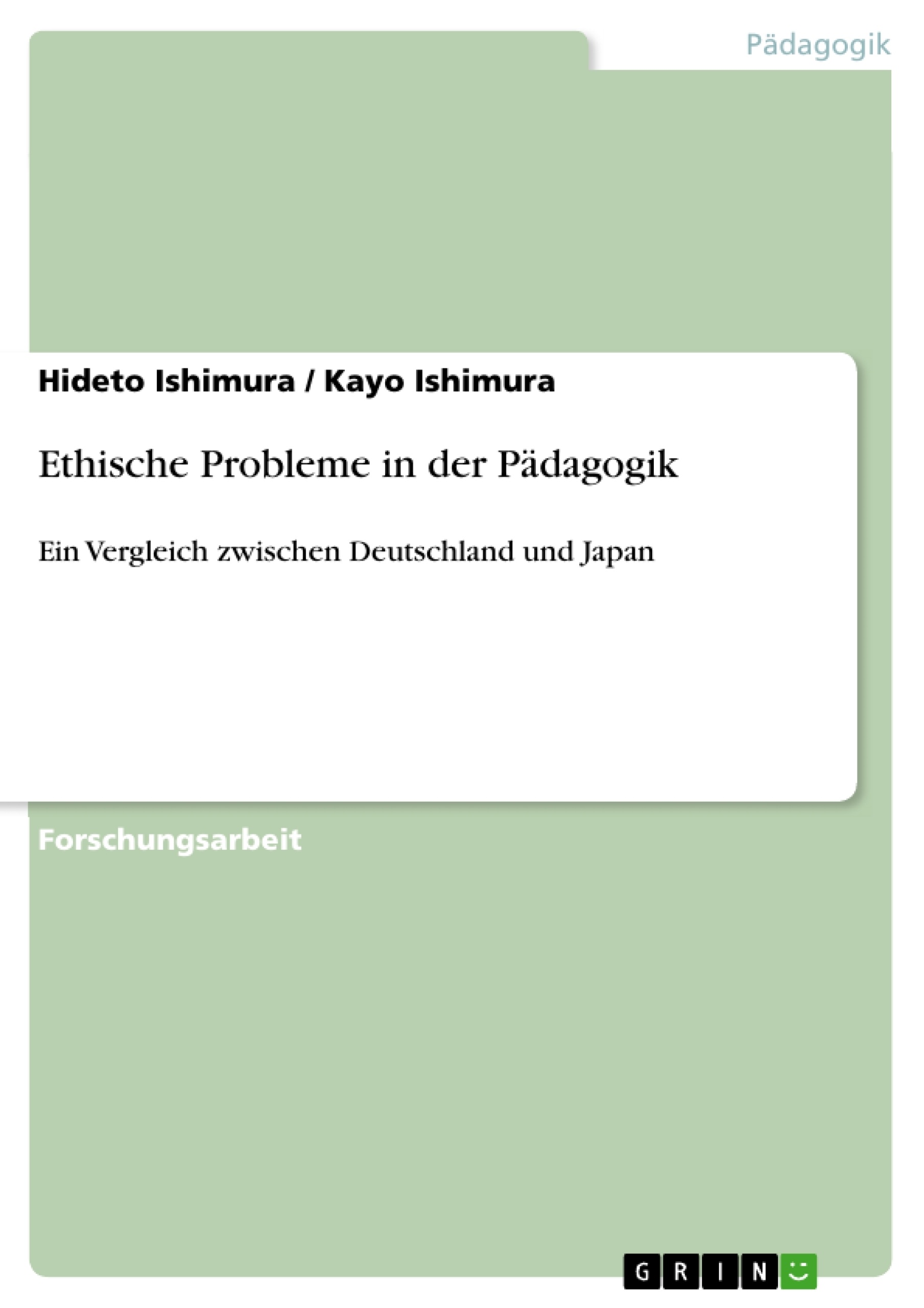In diesem Text wird das Thema „Ethische Probleme in der Pädagogik“ behandelt und es werden das traditionelle und moderne Denken der Moral sowie der konkrete Moralunterricht in der Schule zwischen Deutschland und Japan in einer kulturell vergleichenden Betrachtung behandelt.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- 1 Die Frage von Platon und die Ethik von Aristoteles
- 1.1 Sokrates und Platon
- 1.2 Ob die Tugend gelehrt werden kann?
- 1.3 Die höchste Idee: das Gute
- 1.4 Die Nikomachische Ethik von Aristoteles
- 1.5 Unterschied zwischen sokratischen, platonischen und aristotelischen Gedanken
- 2 Bildung der Gewohnheiten (1)
- 2.1 Was bedeutet Charaktererziehung?
- 2.2 Warum wird Charaktererziehung unterstützt?
- 2.3 Die Theorie der Charaktererziehung
- 2.4 Die Praktiken der Charaktererziehung
- 2.5 Vorteile und Nachteile der Charaktererziehung
- 3 Bildung der Gewohnheiten (2)
- 3.1 Der Gedanke Bollnows
- 3.2 Das Wesen der Übung
- 4 Utilitarismus
- 4.1 Lust ist immer gut
- 4.2 Trolley-Problem
- 4.3 Berechnung der Vergnügen und das Maximumprinzip
- 4.4 Ist das Glück messbar?
- 5 Die Ethik Kants
- 5.1 Kant und seine Philosophie
- 5.2 Die Moral Kants
- 5.3 Moralische Bildungstheorie Kants
- 6 Theorien Piagets und Kohlbergs über die Moralentwicklung
- 6.1 Die Theorie Piagets
- 6.2 Die Theorie Kohlbergs
- 7 Moral und ihre religiösen Hintergründe
- 7.1 Buddhismus
- 7.2 Shintoismus
- 7.3 Religion in Harmonie
- 7.4 Moralische Haltung und religiöse Hintergründe in Japan
- 8 Schulsystem in Japan
- 8.1 Geschichte der japanischen Bildung
- 8.2 Das Bildungswesen
- 8.3 Der Stundenplan
- 8.4 Das Lehrbuch
- 8.5 Die Schulleistung
- 9 Moralerziehung und Moralunterricht in Japan
- 9.1 Geschichte der Moralerziehung in Japan
- 9.2 Moralerziehung und Moralunterricht im japanischen Bildungsplan
- 9.3 Moralunterricht in der Schule
- 9.4 Analysen eines japanischen Lernmaterials
- Ergänzung: Eigenschaften des Japanischen und der Japaner
- 10 Individualismus oder Kollektivismus?
- 10.1 Kollektivistisches Denken der Moral in Japan
- 10.2 Individualismus und Kollektivismus
- 10.3 Gemeinschaftsnachhaltige Sittlichkeit
- 10.4 Schwierigkeiten im europäischen und japanischen Denken der Moral
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Buch untersucht ethische Probleme in der Pädagogik im Vergleich zwischen Deutschland und Japan. Ziel ist es, das traditionelle und moderne moralische Denken sowie den konkreten Moralunterricht in beiden Ländern kulturell vergleichend zu betrachten. Die Arbeit basiert auf einem Seminar, in dem durch Gruppenarbeit ethische Fragen diskutiert wurden.
- Vergleichende Analyse des moralischen Denkens in Deutschland und Japan
- Untersuchung des Einflusses von Philosophie (Platon, Aristoteles, Kant) auf die Moral
- Rolle der Charaktererziehung und Gewohnheitsbildung in der moralischen Entwicklung
- Der Einfluss religiöser Hintergründe auf die Moral
- Analyse des Moralunterrichts in den Schulsystemen beider Länder
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und betont die Notwendigkeit, Kinder zu einem ethisch ausgezeichneten Leben anzuleiten. Sie hebt die Schwierigkeit hervor, Moral zu lehren, im Gegensatz zu Fächern mit klar definierten Inhalten wie Mathematik oder Biologie. Die "Goldene Regel" wird als Beispiel für einen relativ klaren moralischen Inhalt genannt, unterstreicht aber gleichzeitig die Komplexität der Moralvermittlung.
1 Die Frage von Platon und die Ethik von Aristoteles: Dieses Kapitel untersucht die philosophischen Grundlagen ethischen Denkens bei Platon und Aristoteles. Es beleuchtet die sokratische Methode, die Frage nach der Lehrbarkeit der Tugend und die platonische Vorstellung des Guten. Der Vergleich mit der Nikomachischen Ethik von Aristoteles zeigt unterschiedliche Herangehensweisen an ethische Fragen und die Entwicklung des ethischen Denkens von der sokratischen bis zur aristotelischen Philosophie. Die Bedeutung dieser Philosophen für das Verständnis heutiger ethischer Probleme in der Pädagogik wird erörtert.
2 Bildung der Gewohnheiten (1): Dieses Kapitel befasst sich mit Theorien und Praktiken der Charaktererziehung. Es definiert den Begriff der Charaktererziehung und untersucht die Gründe für ihre Unterstützung. Die verschiedenen Theorien und Praktiken werden vorgestellt und kritisch bewertet. Vor- und Nachteile der Charaktererziehung werden diskutiert, um ein umfassendes Bild dieser wichtigen pädagogischen Methode zu geben. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Gewohnheitsbildung für die Entwicklung moralischer Handlungsfähigkeit.
3 Bildung der Gewohnheiten (2): Hier wird Bollnows Überlegung über das Üben im Kontext der Charaktererziehung vertieft. Der Gedanke Bollnows wird ausführlich erklärt und in Beziehung zu den in Kapitel 2 diskutierten Theorien gesetzt. Das Wesen der Übung als Methode der Charaktererziehung wird analysiert, und die Bedeutung von Übung und Wiederholung für die Festigung moralischen Verhaltens wird hervorgehoben. Der Bezug zu den praktischen Aspekten der Charaktererziehung wird hergestellt.
4 Utilitarismus: Dieses Kapitel untersucht den Utilitarismus als ethische Theorie. Es werden die zentralen Prinzipien des Utilitarismus erläutert, wie die Maxime des größten Glücks und die Messbarkeit von Glück. Das Trolley-Problem dient als Beispiel für die Anwendung und die Schwierigkeiten des utilitaristischen Denkens. Die Anwendung des Utilitarismus auf die Pädagogik wird diskutiert, einschließlich der Frage, ob Glück messbar ist und wie sich dies auf die moralische Erziehung auswirkt.
5 Die Ethik Kants: Dieses Kapitel widmet sich der Ethik Immanuel Kants. Es werden Kants Philosophie, seine Moraltheorie und seine moralische Bildungstheorie vorgestellt und analysiert. Die Kapitel erläutern Kants kategorischen Imperativ und seine Bedeutung für die moralische Handlung. Es wird diskutiert, wie Kants Ideen in der pädagogischen Praxis umgesetzt werden können und welche Herausforderungen sich dabei stellen.
6 Theorien Piagets und Kohlbergs über die Moralentwicklung: In diesem Kapitel werden die Theorien von Piaget und Kohlberg zur Moralentwicklung verglichen und kontrastiert. Die kognitiven Entwicklungsstufen der Moral nach Piaget werden ebenso detailliert beschrieben, wie Kohlbergs Stufenmodell der moralischen Entwicklung. Die Relevanz beider Theorien für das Verständnis der moralischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird hervorgehoben und deren Anwendungsmöglichkeiten in der pädagogischen Praxis besprochen.
7 Moral und ihre religiösen Hintergründe: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss religiöser Hintergründe auf die Moral. Es werden Buddhismus und Shintoismus als Beispiele für religiöse Traditionen mit unterschiedlichen moralischen Implikationen näher beleuchtet. Die Bedeutung der Harmonie und der moralischen Haltung im Kontext der japanischen Religion wird erörtert. Der Einfluss der Religion auf die Moralentwicklung und das moralische Handeln wird analysiert.
8 Schulsystem in Japan: Dieses Kapitel beschreibt das japanische Schulsystem, seine Geschichte und Struktur. Es werden der Stundenplan, die Lehrbücher und die Schulleistungen beleuchtet und in Relation zu den vorherigen Kapiteln zur Moralentwicklung gesetzt. Die Struktur des Schulsystems und seine Einflüsse auf die moralische Bildung der Schüler werden detailliert untersucht.
9 Moralerziehung und Moralunterricht in Japan: Dieses Kapitel analysiert die Geschichte und den aktuellen Stand der Moralerziehung und des Moralunterrichts in Japan. Es beleuchtet den Stellenwert der Moral im japanischen Bildungsplan und analysiert ein konkretes japanisches Lernmaterial. Der Vergleich mit dem deutschen System wird angedeutet, jedoch nicht explizit ausgeführt.
10 Individualismus oder Kollektivismus?: Das Kapitel befasst sich mit dem Gegensatz von individualistischem und kollektivistischem moralischem Denken, insbesondere im Kontext des japanischen und europäischen Denkens. Es werden die Herausforderungen für das Verständnis und die Vermittlung von Moral in beiden kulturellen Kontexten diskutiert. Der Begriff der „Gemeinschaftsnachhaltigen Sittlichkeit“ wird eingeführt und erklärt.
Schlüsselwörter
Ethische Probleme, Pädagogik, Deutschland, Japan, Moralentwicklung, Charaktererziehung, Utilitarismus, Kant, Piaget, Kohlberg, Religion, Schulsystem, Individualismus, Kollektivismus, Kultureller Vergleich.
Häufig gestellte Fragen zu: Ethische Probleme in der Pädagogik - Ein Vergleich zwischen Deutschland und Japan
Was ist der Inhalt des Buches "Ethische Probleme in der Pädagogik - Ein Vergleich zwischen Deutschland und Japan"?
Das Buch bietet einen umfassenden Vergleich der ethischen Pädagogik in Deutschland und Japan. Es untersucht traditionelle und moderne moralische Denkweisen und den konkreten Moralunterricht in beiden Ländern. Der Fokus liegt auf einer kulturell vergleichenden Betrachtung, basierend auf Seminardiskussionen zu ethischen Fragen.
Welche philosophischen Grundlagen werden behandelt?
Das Buch untersucht die philosophischen Grundlagen ethischen Denkens bei Platon und Aristoteles (Sokratische Methode, Lehrbarkeit der Tugend, das Gute), den Utilitarismus (Lustprinzip, Trolley-Problem, Messbarkeit von Glück) und die Ethik Kants (kategorischer Imperativ, moralische Bildungstheorie). Die Relevanz dieser Philosophen für heutige ethische Probleme in der Pädagogik wird erörtert.
Welche Rolle spielen Charaktererziehung und Gewohnheitsbildung?
Charaktererziehung und Gewohnheitsbildung werden als zentrale Aspekte der moralischen Entwicklung behandelt. Das Buch untersucht Theorien und Praktiken der Charaktererziehung, beleuchtet Bollnows Überlegungen zum Üben und diskutiert Vor- und Nachteile dieser pädagogischen Methode.
Wie werden die Theorien von Piaget und Kohlberg behandelt?
Die Theorien von Piaget und Kohlberg zur moralischen Entwicklung werden verglichen und kontrastiert. Die kognitiven Entwicklungsstufen der Moral nach Piaget und Kohlbergs Stufenmodell werden detailliert beschrieben und ihre Relevanz für die pädagogische Praxis hervorgehoben.
Welchen Einfluss haben religiöse Hintergründe auf die Moral?
Der Einfluss religiöser Hintergründe auf die Moral wird untersucht, wobei Buddhismus und Shintoismus als Beispiele dienen. Die Bedeutung von Harmonie und moralischer Haltung im Kontext japanischer Religionen wird erörtert.
Wie wird das japanische Schulsystem beschrieben?
Das Buch beschreibt das japanische Schulsystem, seine Geschichte und Struktur, inklusive Stundenplan, Lehrbücher und Schulleistungen. Der Zusammenhang zwischen Schulsystem und moralischer Bildung wird analysiert.
Wie wird Moralerziehung und Moralunterricht in Japan behandelt?
Die Geschichte und der aktuelle Stand der Moralerziehung und des Moralunterrichts in Japan werden analysiert, inklusive des Stellenwerts der Moral im japanischen Bildungsplan und der Analyse eines konkreten Lernmaterials. Ein Vergleich mit dem deutschen System wird angedeutet.
Wie wird der Gegensatz von Individualismus und Kollektivismus behandelt?
Das Buch diskutiert den Gegensatz von individualistischem und kollektivistischem moralischem Denken, insbesondere im japanischen und europäischen Kontext. Die Herausforderungen für das Verständnis und die Vermittlung von Moral in beiden Kulturen werden erörtert, wobei der Begriff der „Gemeinschaftsnachhaltigen Sittlichkeit“ eingeführt wird.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Buchinhalt?
Schlüsselwörter sind: Ethische Probleme, Pädagogik, Deutschland, Japan, Moralentwicklung, Charaktererziehung, Utilitarismus, Kant, Piaget, Kohlberg, Religion, Schulsystem, Individualismus, Kollektivismus, Kultureller Vergleich.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, das Buch enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die behandelten Themen und Kernaussagen prägnant zusammenfasst.
- Arbeit zitieren
- Hideto Ishimura (Autor:in), Kayo Ishimura (Autor:in), 2016, Ethische Probleme in der Pädagogik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339530