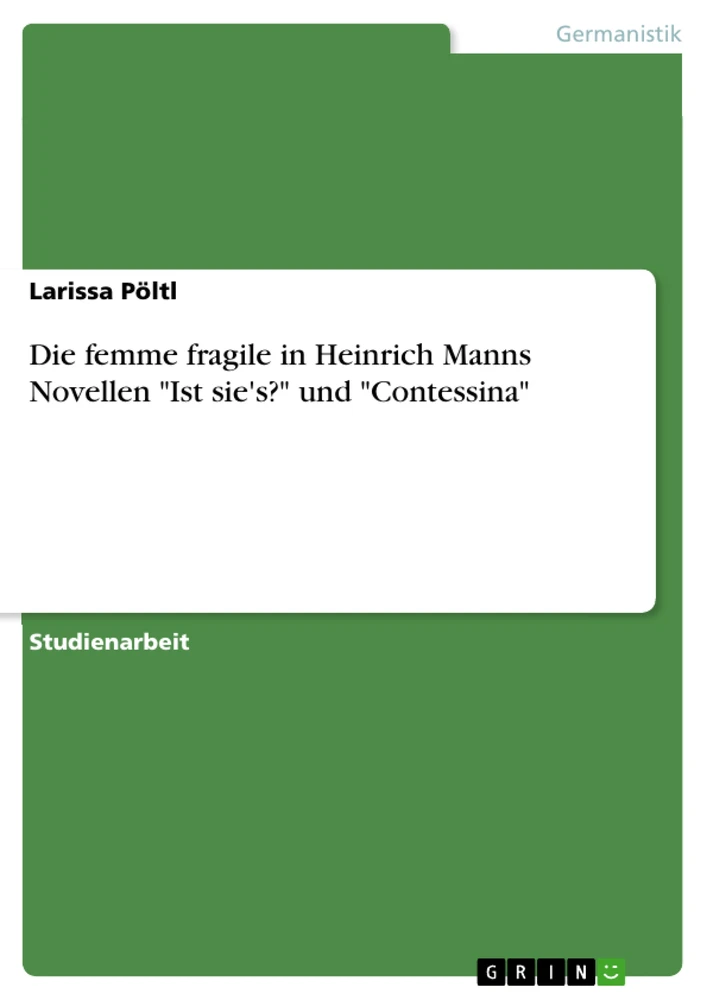Heinrich Mann verwendet in seinen beiden Novellen "Ist sie’s?" und "Contessina" das Motiv der „femme fragile“. Dieser Frauencharakter, der zumeist auf eine blasse, magere und kranke Frau hinweist, ist typisch für die Jahrhundertwende.
In der Novelle "Ist sie’s?" geht es vermehrt um das Thema der Wiedergeburt; der Ich-Erzähler lernt eine verheiratete Frau kennen, zu der er sich stark hingezogen fühlt, verliert sie jedoch aus den Augen. Jahre später glaubt er, sie wiederzusehen, es ist aber ihre Tochter, in der er die Seele der Mutter zu erkennen scheint. Letztere ist bei der Geburt gestorben. Sowohl Mutter als auch Tochter verkörpern die „femme fragile“.
In der Novelle "Contessina" lernt ein junges Mädchen die Sonnenseiten des Lebens kennen, als ein Bildhauer sie in ihrem zuvor einsamen Zuhause besucht. Er zeigt ihr, dass es auch ein Leben außerhalb Contessinas Umfeld gibt. Das junge Mädchen wird so stark von Sehnsucht geplagt, dass es sich am Ende das Leben nimmt. Auch hier verkörpert die Protagonistin die „femme fragile“.
In der folgenden Arbeit wird bearbeitet, inwiefern sich die Charaktere der beiden Novellen in Bezug auf den Typus „femme fragile“ ähneln und unterscheiden. Es soll außerdem herausgearbeitet werden, welche Rolle der Mann in den Erzählungen spielt. Beide Protagonistinnen sind von Männern abhängig. Die These hierzu lautet, dass beide von einem Mann zum Leben erweckt werden, dieses Erwecken aber gleichzeitig auch zu ihrem Tode führt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die „femme fragile“
- Die „femme fragile“ in Ist sie's?
- Die „femme fragile“ in Contessina
- Der männliche Beschützer
- Das Erwecken
- Ein Vergleich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Heinrich Manns Darstellung der „femme fragile“ in seinen Novellen „Ist sie's?“ und „Contessina“. Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der weiblichen Protagonistinnen im Hinblick auf diesen Charaktertyp zu analysieren und die Rolle des Mannes in beiden Erzählungen zu beleuchten. Die These lautet, dass die Protagonistinnen durch männliche Figuren „erweckt“ werden, was gleichzeitig ihren Untergang bedeutet.
- Die Charakterisierung der „femme fragile“ in der Literatur um 1900
- Vergleichende Analyse der weiblichen Protagonistinnen in „Ist sie's?“ und „Contessina“
- Die Rolle des Mannes als „Beschützer“ und „Verführer“
- Das Motiv der Wiedergeburt und des Todes
- Die soziale Stellung der Frau um die Jahrhundertwende
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der „femme fragile“ in Heinrich Manns Novellen „Ist sie's?“ und „Contessina“ ein. Sie stellt die Forschungsfrage nach den Gemeinsamkeiten und Unterschieden der weiblichen Protagonistinnen in Bezug auf diesen Charaktertyp und die Rolle des Mannes in den Erzählungen. Die zentrale These der Arbeit, dass die Protagonistinnen durch männliche Figuren zum Leben erweckt, aber gleichzeitig auch in den Tod geführt werden, wird formuliert. Die methodische Vorgehensweise, die zunächst den Typus der „femme fragile“ allgemein und in den beiden Novellen untersucht, bevor ein Vergleich mit besonderem Fokus auf die Rolle des Mannes erfolgt, wird skizziert.
Die „femme fragile“: Dieses Kapitel beschreibt den Charakter der „femme fragile“ als typischen Frauentypus der Jahrhundertwende. Es werden charakteristische Adjektive wie „blass“, „kindlich“, „kränklich“ und „zerbrechlich“ genannt, wobei die Farbe Weiß und eine „aufgeworfene Nase“ als besondere Merkmale hervorgehoben werden. Die „femme fragile“ wird oft auf ihr Äußeres reduziert, was ihre gesellschaftliche Unterdrückung und ihren Objektcharakter symbolisiert. Ihre Krankheit macht sie sexuell ungefährlich und unnahbar, im Gegensatz zur „femme fatale“. Die Krankheit wird als eng mit dem Tod verbunden dargestellt, wobei Schönheit und Tod miteinander verknüpft werden. Die „femme fragile“ wird oft der Aristokratie zugeordnet.
Die „femme fragile“ in Ist sie’s?: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung der „femme fragile“ in der Novelle „Ist sie’s?“. Jeanne, die Protagonistin, wird als kranke, fragile Frau beschrieben, die Pflege benötigt. Ihre körperliche Beschreibung unterstreicht ihre Zerbrechlichkeit. Die Verwechslung der Erzählerfigur zwischen Jeanne und ihrer Tochter unterstreicht das Thema der Wiedergeburt und des Todes, die beide Frauen verkörpern. Der Ich-Erzähler spielt eine zentrale Rolle, indem er Jeanne rettet und ihr ein Abenteuerleben ermöglicht, das jedoch letztendlich ihren Tod zur Folge hat.
Schlüsselwörter
Femme fragile, Heinrich Mann, Ist sie's?, Contessina, Jahrhundertwende, Weiblichkeitsbilder, Männerrolle, Wiedergeburt, Tod, Krankheit, soziale Stellung der Frau, Abhängigkeit.
Häufig gestellte Fragen zu Heinrich Manns „Ist sie's?“ und „Contessina“: Eine Analyse der „femme fragile“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Heinrich Manns Darstellung der „femme fragile“ in seinen Novellen „Ist sie's?“ und „Contessina“. Im Mittelpunkt steht ein Vergleich der weiblichen Protagonistinnen hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede als Vertreterinnen dieses Frauentyps und die Rolle der männlichen Figuren in beiden Erzählungen.
Welche These wird vertreten?
Die zentrale These besagt, dass die weiblichen Protagonistinnen durch männliche Figuren „erweckt“ werden, was gleichzeitig ihren Untergang bedeutet. Dies wird durch eine vergleichende Analyse der beiden Novellen untersucht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Charakterisierung der „femme fragile“ um 1900, eine vergleichende Analyse der weiblichen Protagonistinnen in „Ist sie's?“ und „Contessina“, die Rolle des Mannes als „Beschützer“ und „Verführer“, das Motiv von Wiedergeburt und Tod, und die soziale Stellung der Frau um die Jahrhundertwende.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur „femme fragile“ im Allgemeinen, Kapitel zur „femme fragile“ in „Ist sie's?“ und „Contessina“, ein Kapitel zum Vergleich der beiden Novellen und ein Fazit (implizit). Die Einleitung beschreibt die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise. Die Kapitel untersuchen den Typus der „femme fragile“, analysieren die weiblichen Protagonistinnen und deren Interaktion mit den männlichen Figuren.
Wie wird die „femme fragile“ charakterisiert?
Die „femme fragile“ wird als typischer Frauentypus der Jahrhundertwende beschrieben, charakterisiert durch Adjektive wie „blass“, „kindlich“, „kränklich“ und „zerbrechlich“. Weiß als Farbe und eine „aufgeworfene Nase“ werden als besondere Merkmale genannt. Ihre Krankheit wird als eng mit dem Tod verbunden dargestellt, wobei Schönheit und Tod miteinander verknüpft werden. Oft wird sie der Aristokratie zugeordnet.
Welche Rolle spielen die männlichen Figuren?
Die männlichen Figuren spielen die Rolle des „Beschützers“ und des „Verführers“. Sie „erwecken“ die „femme fragile“ zum Leben, führen sie aber gleichzeitig in den Tod. Ihre Rolle wird in der Arbeit im Detail analysiert und im Vergleich zwischen den beiden Novellen betrachtet.
Wie werden die weiblichen Protagonistinnen in „Ist sie's?“ und „Contessina“ dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Darstellung der weiblichen Protagonistinnen in beiden Novellen im Detail. Es wird gezeigt, wie sie als „femme fragile“ charakterisiert sind, welche Rolle sie in der jeweiligen Erzählung spielen und wie ihr Schicksal mit der Interaktion mit männlichen Figuren verbunden ist.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Femme fragile, Heinrich Mann, Ist sie's?, Contessina, Jahrhundertwende, Weiblichkeitsbilder, Männerrolle, Wiedergeburt, Tod, Krankheit, soziale Stellung der Frau, Abhängigkeit.
- Quote paper
- Larissa Pöltl (Author), 2013, Die femme fragile in Heinrich Manns Novellen "Ist sie's?" und "Contessina", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339557