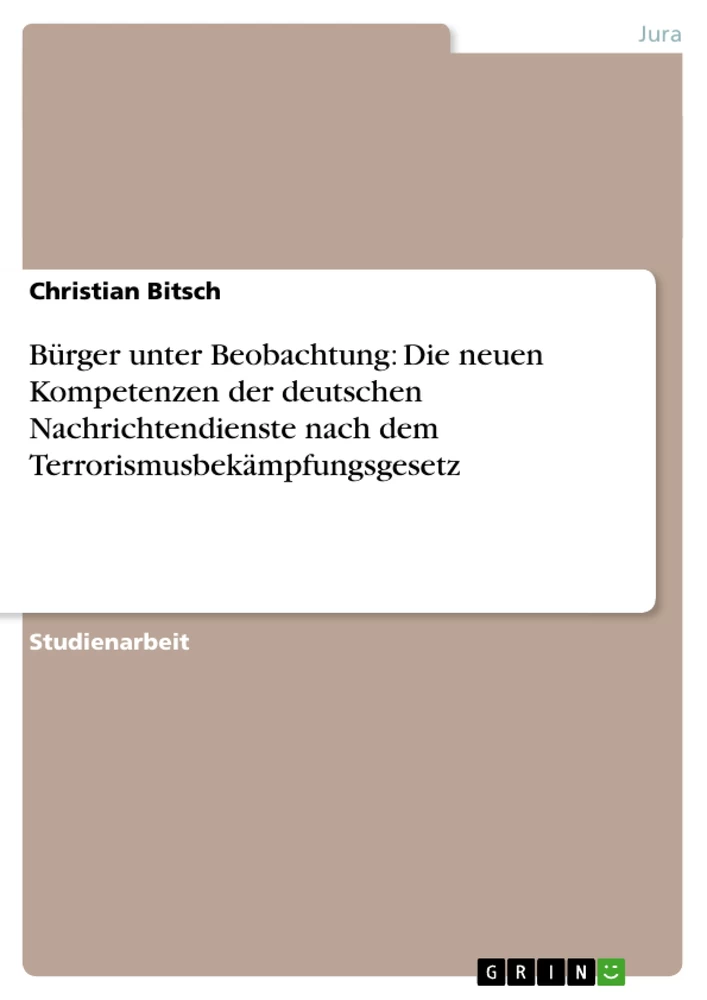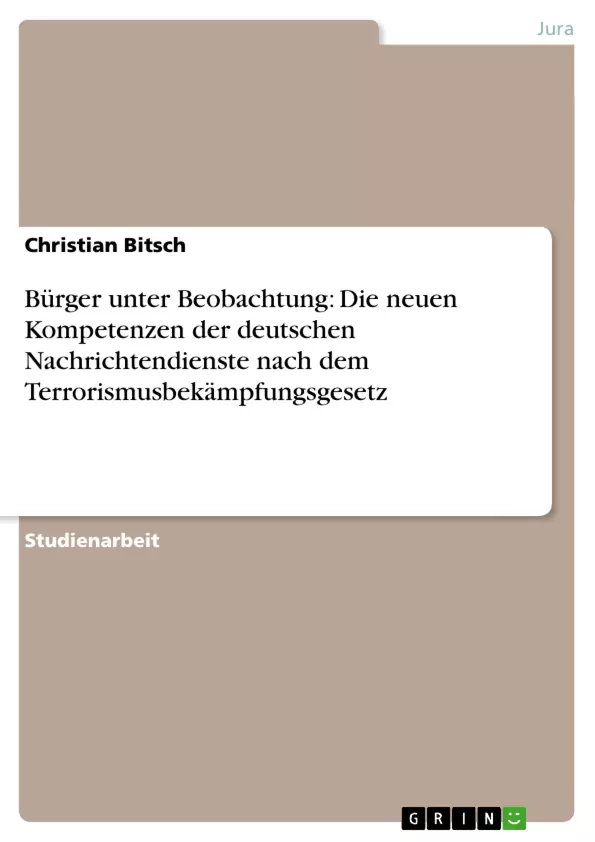Die Terroranschläge vom 11.September 2001 stellten Sicherheitspolitik und –Strategie der meisten westlichen Staaten in vielfacher Hinsicht vor neue Herausforderungen1. Nie zuvor hatten es die Sicherheitsbehörden mit derart gut organisierten terroristischen Strukturen zu tun. Bislang war es ihr Auftrag, sichtbare und vereinzelte, jedenfalls überschaubare Personengruppen strafrechtlich zu verfolgen. Jetzt bekommt sie es plötzlich mit einem weltweit operierenden Netzwerk zu tun, das vor Selbstzerstörung nicht zurückschreckt. Nicht mehr abschätzbar ist das Verhalten eines Gegners, der sein eigenes Leben nicht nur zur Disposition stellt, sondern vielmehr seinen Tod bewusst in Kauf nimmt. Dabei handelt es sich bei den Tätern um gut ausgebildete – zuvor polizeilich nie in Erscheinung getretene – Personen, die jahr zehntelang unauffällig unter ihren Mitbürgern leben, mitunter Ausbildungen an Hochschulen durchlaufen und dann zum tödlichen Werkzeug eines terroristischen Netzwerks werden. Die Polizei bekommt es also mit unüberschaubaren und unberechenbaren Gegnern zu tun. Dass diesem Sicherheitsproblem mit der hergebrachten polizeilichen Arbeit nicht beizukommen ist, liegt beinahe auf der Hand. Der rechtsstaatliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der jedes staatliches Handeln bestimmt und der die Grundrechte der betroffenen Bürger soweit als möglich schonen soll, scheint in dieser Situation gegenüber einem zum Selbstmord bereiteten Täter sein Ziel zu verfehlen2.
Vor diesem Hintergrund verwundern die Reaktionen der westlichen Staaten nach dem 11.September 2001 nicht. Nach militärischen und polizeilichen Sofortmaßnahmen (verstärkte Luftraumüberwachung, intensivere Überprüfung von Personen, Rasterfahndung etc.) folgte in der Bundesrepublik bereits nach wenigen Wochen das „Erste Anti-Terror-Paket“. Am 14. Dezember 2001 verabschiedete dann der Bundestag das „Zweite Anti-Terror-Paket“ (auch: Terrorismusbekämpfungsgesetz oder Zweites Sicherheitspaket). Wenig später stimmte der Bundesrat den Neuregelungen zu. Dieses – auf fünf Jahre begrenzte4 – Terrorismusbekämpfungsgesetz (TerrorBekG, BGBl. I, 2002, S. 361) soll Gegenstand dieser Arbeit sein. Sein Inkrafttreten am 9.Januar 2002 führte zu Änderungen zahlreicher Gesetze: u.a. des Passgesetzes, des Vereinsrechts, sowie des Ausländer- und Asylrechts.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Die dt. Nachrichtendienste und das Terrorismusbekämpfungsgesetz.
- I. Ein Überblick (Geschichte, Rechtsgrundlagen und Befugnisse).
- 1. das Bundesamt und die Landesämter für Verfassungsschutz
- a. Geschichte und Rechtsgrundlage.
- b. Aufgaben, Befugnisse und Kompetenzen vor und nach der Novellierung des BVerfSchG.
- aa. Aufgaben des Verfassungsschutzes
- bb. Kompetenzen des Verfassungsschutzes
- 2. Der Bundesnachrichtendienst
- a. Aufgaben des BND
- b. Befugnisse und Kompetenzen
- 3. Der Militärische Abschirmdienst.
- a. Aufgaben des MAD
- b. Befugnisse und Kompetenzen
- II. Kontrolle der Dienste.
- 1. Kontrolle der Nachrichtendienste vor dem 01.01.2002
- 2. Erweiterung und Ergänzung der Kontrolle durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz
- C. Das Terrorismusbekämpfungsgesetz und die Grundrechte.
- I. Schutzbereich
- 1. Freizügigkeit (Art. 11 GG)
- 2. Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG)
- 3. Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG)
- 4. Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 i.V.m. 1 GG).
- II. Rechtfertigung der Eingriffe
- 1. Grundrechtsschranken und Gesetzesvorbehalt
- a. Art. 10 GG
- b. Art. 13 GG
- c. informationelle Selbstbestimmung
- d. Zunächst: Übereinstimmung mit den Grundrechtsschranken
- 2. Verfassungsmäßigkeit des TerrorBekG im Übrigen
- a. Gesetzgebungsbefugnis des Bundes
- b. das Gebot der Normenklarheit.
- c. verfassungskonforme Auslegung?
- D. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Auswirkungen des Terrorismusbekämpfungsgesetzes auf die Kompetenzen der deutschen Nachrichtendienste. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, inwiefern die neuen Befugnisse der Dienste mit dem Schutz der Grundrechte in Einklang zu bringen sind.
- Verfassungsmäßigkeit des Terrorismusbekämpfungsgesetzes
- Eingriffe in Grundrechte durch die neuen Befugnisse der Nachrichtendienste
- Rechtliche Kontrolle der Nachrichtendienste
- Geschichte und Rechtsgrundlagen der deutschen Nachrichtendienste
- Auswirkungen des Terrorismusbekämpfungsgesetzes auf die Aufgaben und Befugnisse der Dienste
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel A: Einleitung
- Kapitel B: Die dt. Nachrichtendienste und das Terrorismusbekämpfungsgesetz.
- Kapitel C: Das Terrorismusbekämpfungsgesetz und die Grundrechte.
Die Einleitung führt in die Thematik der Seminararbeit ein und erläutert die Relevanz des Terrorismusbekämpfungsgesetzes für die deutsche Sicherheitsarchitektur.
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die deutschen Nachrichtendienste, ihre Geschichte, Rechtsgrundlagen und Befugnisse vor und nach dem Inkrafttreten des Terrorismusbekämpfungsgesetzes.
Dieses Kapitel untersucht, inwieweit das Terrorismusbekämpfungsgesetz die Grundrechte des Einzelnen einschränkt. Es werden insbesondere die Schutzbereiche der Freizügigkeit, des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses, der Unverletzlichkeit der Wohnung sowie das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie dem Terrorismusbekämpfungsgesetz, den deutschen Nachrichtendiensten, Grundrechten, Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst, Militärischem Abschirmdienst, Kontrolle, Rechtsgrundlagen, Befugnisse und Kompetenzen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Zweite Anti-Terror-Paket"?
Es handelt sich um das Terrorismusbekämpfungsgesetz (TerrorBekG) von 2002, das als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September die Befugnisse der Sicherheitsbehörden erweiterte.
Welche Nachrichtendienste sind von den Neuregelungen betroffen?
Betroffen sind das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), der Bundesnachrichtendienst (BND) und der Militärische Abschirmdienst (MAD).
Welche Grundrechte werden durch das Gesetz eingeschränkt?
Eingriffe erfolgen insbesondere in das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG), die Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG) und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
Wie wird die Arbeit der Nachrichtendienste kontrolliert?
Die Arbeit untersucht die bestehenden Kontrollmechanismen und wie diese durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz ergänzt oder erweitert wurden.
Was bedeutet der "rechtsstaatliche Grundsatz der Verhältnismäßigkeit"?
Er besagt, dass staatliche Eingriffe in Grundrechte nur dann zulässig sind, wenn sie einen legitimen Zweck verfolgen, geeignet, erforderlich und angemessen sind.
War das Terrorismusbekämpfungsgesetz zeitlich begrenzt?
Ja, das ursprüngliche Gesetz von 2002 war auf eine Laufzeit von fünf Jahren begrenzt, um eine spätere Evaluierung der Maßnahmen zu ermöglichen.
- Citar trabajo
- Christian Bitsch (Autor), 2004, Bürger unter Beobachtung: Die neuen Kompetenzen der deutschen Nachrichtendienste nach dem Terrorismusbekämpfungsgesetz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33960