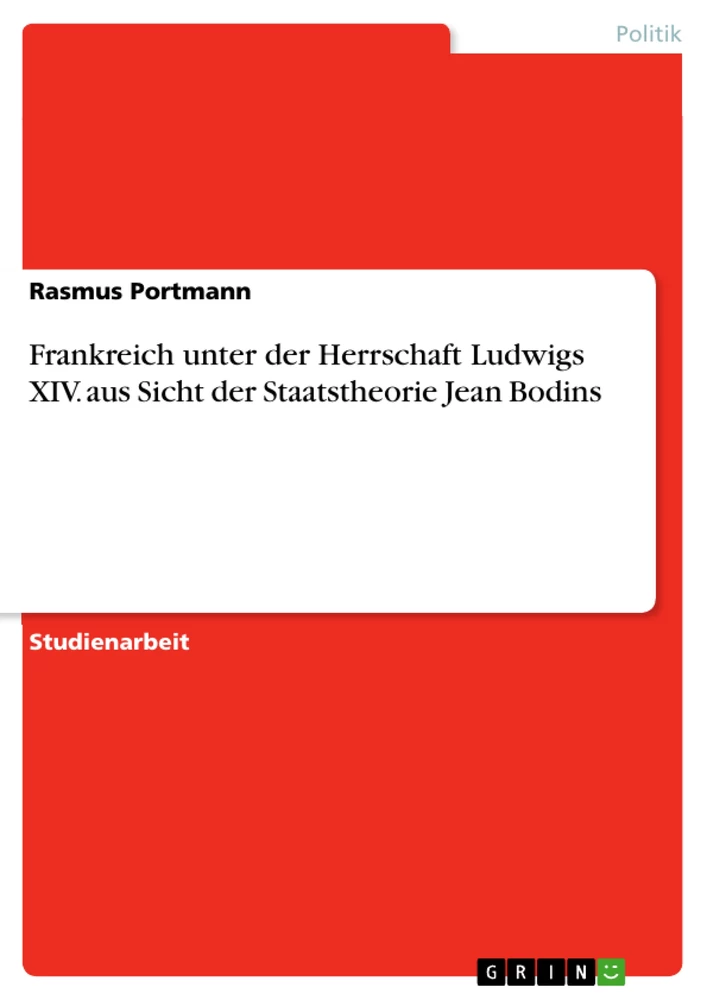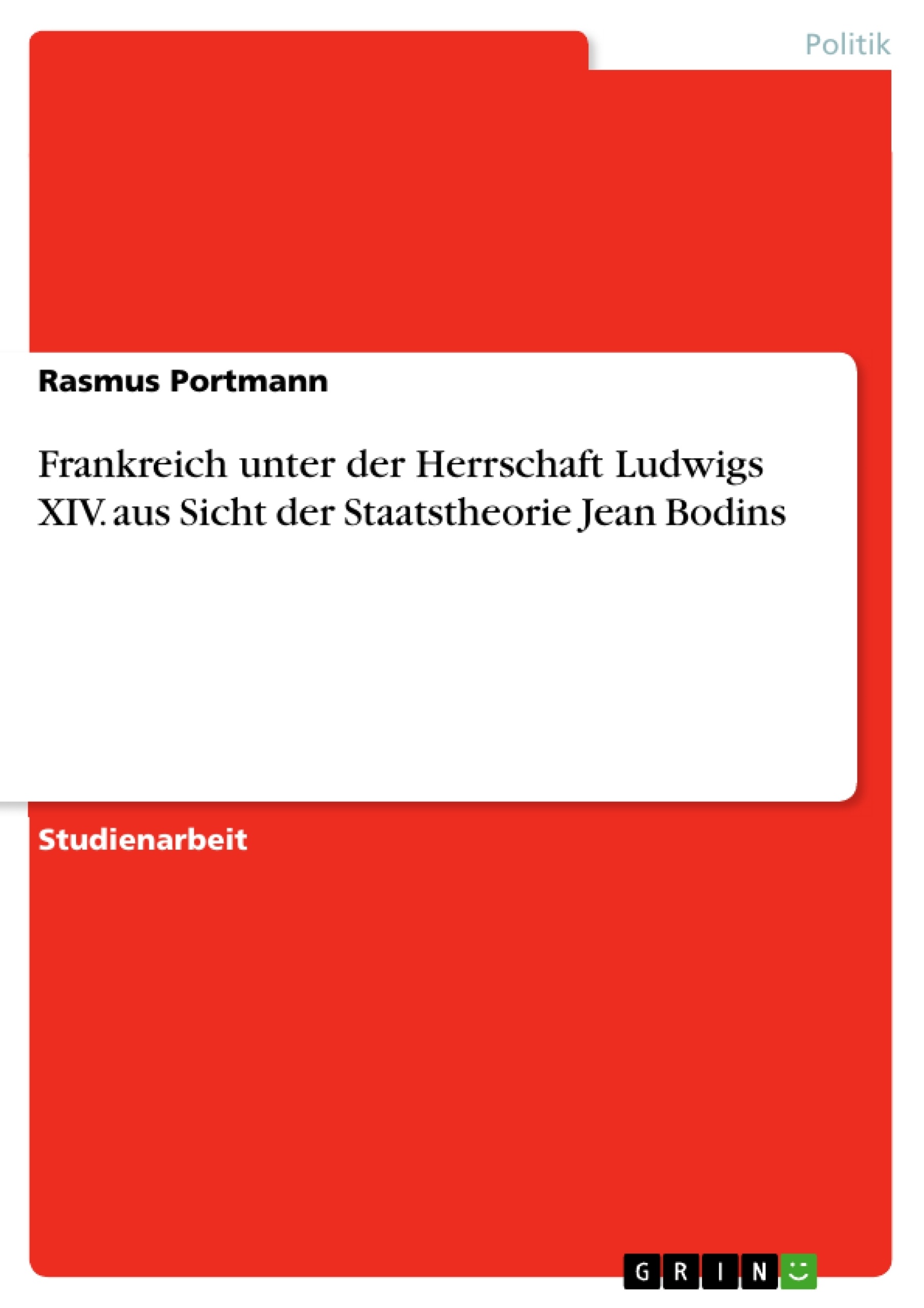Jean Bodin gilt als einer der einflussreichsten Staatstheoretiker des 16. Jahrhunderts und auch darüber hinaus. Seine Idee der Souveränität gilt als Grundidee des Absolutismus, der besonders in Frankreich das Merkmal des höfischen Lebens und der Staatsform wurde. Seine Idee der Souveränität gibt dem neuzeitlichen Denken eine neue Komponente. Sein Werk „Sechs Bücher über den Staat“ gilt als sein wichtigstes. Bodin konzipiert hier eine Idee, die das politische Dilemma im vom Bürgerkrieg geplagten Frankreich lösen soll. Die religiösen Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten, genauer den Hugenotten, konnten vom französischen König ob ihres Umfanges und ihrer Brutalität nicht ignoriert werden. Die daraus folgende Krise des Königtums versuchte Bodin dann durch seine Theorie der höchsten Gewalt wieder in geordnete Bahnen zu lenken.
In dieser Arbeit soll nun die Staatsidee Bodins auf die Herrschaft von Louis XIV. übersetzt werden. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage wie die Staatstheorie von Bodin auf die Herrschaft Louis XIV. umgesetzt wurde? Wie versuchte Louis XIV. seine absolutistische Macht zu etablieren und in welchem Maße war dies mit Bodins Staatstheorie in Einklang zu bringen ist?
Im ersten Teil soll die Staatstheorie von Bodin erläutert werden. Hierbei wird zuerst auf den historischen Kontext Bezug genommen und die politischen und gesellschaftlichen Umstände in Frankreich erläutert. Danach werden seine Staatsauffassung und sein Souveränitätsbegriff beschrieben der die Grundessenz für den im späteren Verlauf der Arbeit aufkommenden Absolutismus Louis XIV. ist. Neben der Erläuterung des Souveränitätsbegriffs soll auch auf die Beschränkung des Souveräns eingegangen werden die Bodin in seinem Werk „Sechs Bücher über den Staat“ einbringt. Hier ist zu untersuchen, wie weit diese Beschränkungen reichten und wie sie in der Praxis angewandt wurden. In der Diskussion der Beschränkungen des Souveräns spielen das Naturrecht und das göttliche Recht eine zentrale Rolle. Diese Diskussion ist nicht nur in Bezug auf diese Arbeit wichtig und interessant sondern kann als einer der Grundkonflikte der Neuzeit erachtet werden. Der Streit zwischen König und Adel/ Volk um Beschränkung der Macht und Macht des Adels oder des Volkes sind der Ursprung unzähliger Konflikte seit dem Ende des Mittelalters.
Inhaltsverzeichnis
- Teil 1
- Einleitung
- Historische und gesellschaftliche Umstände in Frankreich um 1570
- Der Staat bei Bodin
- Die Familie als Ursprung des Staates
- Entstehung eines Staates
- Die Republik in „Les six livres de la République“
- Hierarchie bei Bodin
- Souveränitätslehre
- Geschichte der Souveränität
- Merkmale der Souveränität
- Konkurrenten der Macht
- Die Kirche
- Der Adel
- Die Stände
- Einschränkungen des Souveräns bei Bodin
- Widerstandsrecht bei Bodin
- Teil 2
- Geschichtliche Entwicklung Frankreichs von Bodin bis Louis XIV. (1576-1661)
- Heinrich IV.
- Ludwig XIII., Richelieu und Mazarin
- Die Staatstheorie Bodins angewandt auf Frankreich unter Louis XIV.
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Staatstheorie von Jean Bodin und ihre Anwendung auf die Herrschaft von Ludwig XIV. in Frankreich. Sie untersucht, wie Bodins Konzepte des Souveränitätsbegriffs und der Staatsstruktur in die absolutistische Machtpolitik des Sonnenkönigs eingeflossen sind.
- Die Bedeutung des Souveränitätsbegriffs in Bodins Werk und seine Relevanz für die Entwicklung des Absolutismus
- Die Rolle der Hugenottenkriege und der französischen Gesellschaft im 16. Jahrhundert für Bodins Staatstheorie
- Die Umsetzung von Bodins Ideen in der Praxis der französischen Monarchie unter Ludwig XIV.
- Die Grenzen der Macht des Souveräns und die Konflikte zwischen Monarchie, Adel und Volk
- Die Verbindung zwischen Bodins Staatstheorie und der Entwicklung des französischen Staatswesens im 17. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit widmet sich der Staatstheorie von Jean Bodin, wobei der historische Kontext in Frankreich um 1570 im Vordergrund steht. Die Hugenottenkriege und die gesellschaftlichen Spannungen dieser Zeit werden als Hintergrund für Bodins Ideen erläutert. Anschließend wird Bodins Staatsauffassung und sein Souveränitätsbegriff im Detail betrachtet, um die Grundlage für die spätere Analyse der französischen Monarchie unter Ludwig XIV. zu schaffen.
Der zweite Teil der Arbeit untersucht die Anwendung von Bodins Staatstheorie auf Frankreich unter der Herrschaft von Ludwig XIV. Dazu wird zunächst ein kurzer Überblick über die geschichtliche Entwicklung Frankreichs vom 16. bis ins 17. Jahrhundert gegeben. Die Analyse konzentriert sich dann auf die Regierungszeit Ludwigs XIV. und die Frage, inwiefern seine absolutistische Machtpolitik mit Bodins Staatstheorie in Einklang zu bringen ist.
Schlüsselwörter
Jean Bodin, Staatstheorie, Souveränität, Absolutismus, Frankreich, Ludwig XIV., Hugenottenkriege, Republik, Macht, Herrschaft, Kirche, Adel, Stände, Geschichte, Politik, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Jean Bodin und warum ist er wichtig?
Jean Bodin war ein Staatstheoretiker des 16. Jahrhunderts, dessen Konzept der Souveränität als theoretische Grundlage für den Absolutismus gilt.
Wie hängen Bodins Theorie und die Herrschaft Ludwigs XIV. zusammen?
Die Arbeit untersucht, wie Bodins Souveränitätsbegriff in der absolutistischen Machtpolitik von Ludwig XIV. praktisch umgesetzt wurde.
Was war der historische Auslöser für Bodins Werk?
Die blutigen Hugenottenkriege (Religionskriege) in Frankreich veranlassten Bodin, eine Theorie der "höchsten Gewalt" zu entwickeln, um den Staat zu stabilisieren.
Gibt es laut Bodin Einschränkungen für den Souverän?
Ja, Bodin sah Beschränkungen durch das Naturrecht und das göttliche Recht vor, deren praktische Anwendung in der Arbeit analysiert wird.
Welche Rolle spielt die Familie in Bodins Staatsverständnis?
Bodin betrachtete die Familie als den ursprünglichen Ursprung und die kleinste Einheit des Staates.
- Quote paper
- Rasmus Portmann (Author), 2016, Frankreich unter der Herrschaft Ludwigs XIV. aus Sicht der Staatstheorie Jean Bodins, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339614