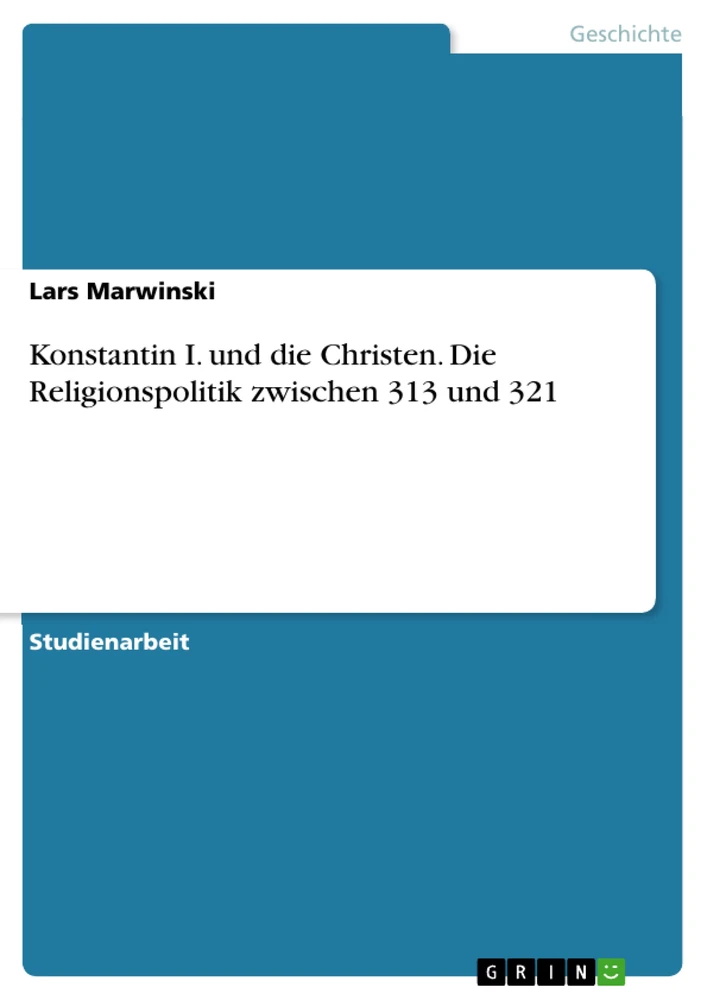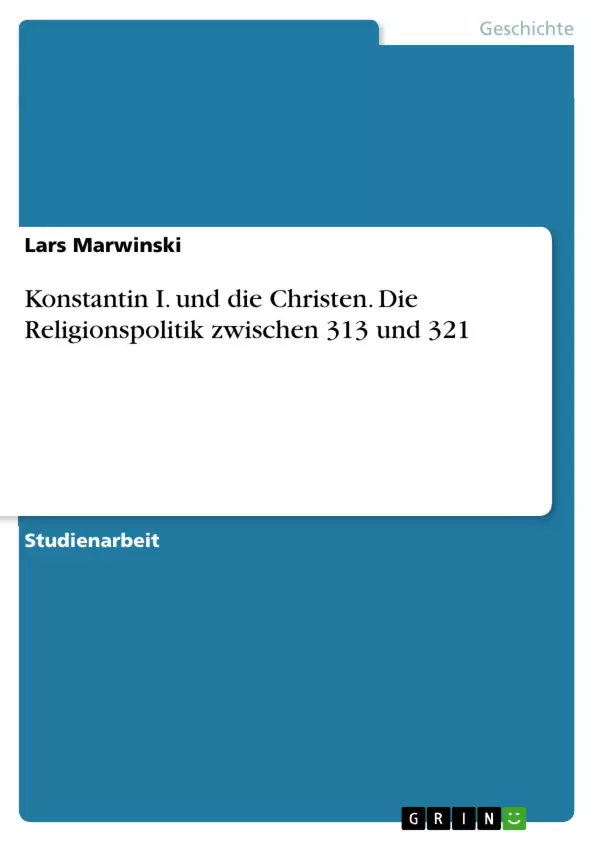Konstantin I. ist bis heute ein großes Thema in der Geschichte. Anfang des vierten Jahrhunderts herrschte er im römischen Reich. Über sein Leben und Wirken gibt es zahlreiche Quellen. Dem Laien im Fach Geschichte ist Konstantin nicht zwingend durch seine außenpolitischen Leistungen oder verwaltungstechnischen Reformen ein Begriff; sondern durch seine Beziehung zur Religion des Christentums. Es stellt sich die Frage, ob seine Hinwendung zum Christentum eine persönliche Motivation zugrunde lag oder ob er eine vorgegebene Denkströmung nutzte, um seine Macht zu festigen. Warum ließ er sich erst auf dem Sterbebett 337 taufen? Das sind Fragen, welche einige Diskussionen hervorrufen. Das Verhältnis zwischen Konstantin und dem Christentum hat „welthistorische Dimensionen angenommen und ihre Auswirkungen sind bis heute spürbar“ (Schmitt 2007).
Auch diese Hausarbeit wird sich mit Konstantin und seiner Religionspolitik beschäftigen. Dabei werde ich jedoch nicht thematisch auf seine Zeit als alleiniger Herrscher ab 324 eingehen, in welcher er bekanntermaßen den Christen Vorrang verschaffte, sondern die Periode beleuchten, in deren Verlauf er zu diesem aufstieg. Dabei werde ich mich aber auf die religionspolitischen Aspekte konzentrieren, die ab der Mailänder Vereinbarung 313 auftraten. Diese Vereinbarung stellte die Christen mit anderen Religionen gleich, und die Frage ist hier, was in den darauffolgenden Jahren mit ihnen geschah. Durch Gesetztestexte wird untersucht, wie das Christentum von Konstantin behandelt wurde. So formuliere ich als Leitfrage: Wie sah die Christenpolitik Konstantins ab einschließlich 313 aus, und lässt sich ein Prozess von der anfänglichen Gleichstellung zu einer Bevorzugung erkennen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konstantin und kurzer historischer Kontext
- Die Mailänder Vereinbarung und ihre Folgen
- Vorgeschichte
- Die Mailänder Vereinbarung
- Nach der Mailänder Vereinbarung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Christenpolitik Konstantins I. zwischen 313 und 321 n. Chr., fokussiert auf die Entwicklung der Haltung Konstantins zum Christentum nach der Mailänder Vereinbarung. Ziel ist es, den Prozess von der anfänglichen Gleichstellung des Christentums zu einer möglichen Bevorzugung zu analysieren.
- Konstantin I. und der historische Kontext seiner Regierungszeit
- Die Mailänder Vereinbarung und ihre Bedeutung für das Christentum
- Analyse der religionspolitischen Maßnahmen Konstantins nach 313
- Die Frage nach Konstantins persönlicher Religiosität und ihren politischen Implikationen
- Bewertung der Quellenlage und der unterschiedlichen Interpretationen der historischen Ereignisse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Konstantin und seine Religionspolitik ein. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Entwicklung der Christenpolitik Konstantins ab 313 und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit. Die Einleitung betont die Bedeutung der Mailänder Vereinbarung als Ausgangspunkt der Untersuchung und die Relevanz der Quellenlage, insbesondere die Schriften von Laktanz und Eusebius. Die Leitfrage der Arbeit wird prägnant formuliert und der Aufbau der folgenden Kapitel kurz umrissen.
Konstantin und kurzer historischer Kontext: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über das Leben Konstantins I., seinen Aufstieg zur Macht im Rahmen der Tetrarchie und den historischen Kontext seiner Regierungszeit. Es beleuchtet die komplexe politische Landschaft des späten 3. und frühen 4. Jahrhunderts und die Rolle Konstantins in den Konflikten zwischen den verschiedenen Kaisern. Der Aufbau der Tetrarchie und deren Auswirkungen auf die Verwaltung des Römischen Reiches werden hier kurz angerissen. Der Fokus liegt auf den Ereignissen, die zu Konstantins Machtergreifung führten und seine Position innerhalb des Vierkaisersystems verdeutlichen.
Die Mailänder Vereinbarung und ihre Folgen: Dieses Kapitel analysiert die Mailänder Vereinbarung von 313 und ihre Folgen. Die Vorgeschichte wird beleuchtet, um den Kontext der Vereinbarung zu verstehen. Die Vereinbarung selbst wird interpretiert und in den historischen Kontext eingeordnet. Die darauf folgenden Jahre werden untersucht, um zu belegen, inwieweit die Vereinbarung die Christenpolitik Konstantins tatsächlich beeinflusste und inwieweit es eine Entwicklung von der Gleichstellung zu einer Bevorzugung des Christentums gab. Die Analyse der entsprechenden Erlasse und Gesetze steht im Zentrum dieses Kapitels.
Schlüsselwörter
Konstantin der Große, Christentum, Mailänder Vereinbarung, Religionspolitik, Tetrarchie, Römisches Reich, Quellenkritik, Gleichstellung, Bevorzugung, Machtpolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Konstantin und die Mailänder Vereinbarung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Christenpolitik Kaiser Konstantins I. zwischen 313 und 321 n. Chr., mit besonderem Fokus auf die Entwicklung seiner Haltung zum Christentum nach der Mailänder Vereinbarung. Das Hauptziel ist die Analyse des Übergangs von der Gleichstellung des Christentums zu einer möglichen Bevorzugung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Konstantin I. und der historische Kontext seiner Regierungszeit; die Mailänder Vereinbarung und ihre Bedeutung für das Christentum; die Analyse der religionspolitischen Maßnahmen Konstantins nach 313; die Frage nach Konstantins persönlicher Religiosität und ihren politischen Implikationen; und die Bewertung der Quellenlage und unterschiedlicher Interpretationen der historischen Ereignisse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Konstantin und kurzer historischer Kontext, Die Mailänder Vereinbarung und ihre Folgen (inkl. Vorgeschichte, die Vereinbarung selbst und die Zeit danach), und Fazit.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema ein, stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Entwicklung der Christenpolitik Konstantins ab 313, skizziert den methodischen Ansatz und betont die Bedeutung der Mailänder Vereinbarung und der Quellenlage (Laktanz und Eusebius).
Was beinhaltet das Kapitel über Konstantin und den historischen Kontext?
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über Konstantins Leben, seinen Aufstieg zur Macht im Rahmen der Tetrarchie und den historischen Kontext seiner Regierungszeit. Es beleuchtet die politische Landschaft des späten 3. und frühen 4. Jahrhunderts und die Ereignisse, die zu Konstantins Machtergreifung führten.
Worauf konzentriert sich das Kapitel über die Mailänder Vereinbarung und ihre Folgen?
Dieses Kapitel analysiert die Mailänder Vereinbarung von 313 und ihre Folgen. Es beleuchtet die Vorgeschichte, interpretiert die Vereinbarung selbst und untersucht die darauf folgenden Jahre, um die Auswirkungen der Vereinbarung auf Konstantins Christenpolitik und die Entwicklung von der Gleichstellung zur möglichen Bevorzugung des Christentums zu analysieren.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Konstantin der Große, Christentum, Mailänder Vereinbarung, Religionspolitik, Tetrarchie, Römisches Reich, Quellenkritik, Gleichstellung, Bevorzugung, Machtpolitik.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit bezieht sich explizit auf die Schriften von Laktanz und Eusebius, weitere Quellen werden im Detail innerhalb der Arbeit benannt und analysiert (Quellenkritik).
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist, wie sich die Christenpolitik Konstantins nach der Mailänder Vereinbarung von 313 entwickelte und ob es einen Wandel von der Gleichstellung des Christentums zu einer Bevorzugung gab.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit folgt einem klaren logischen Aufbau: Einleitung, Kontextualisierung (Konstantin und seine Zeit), Analyse des zentralen Ereignisses (Mailänder Vereinbarung und Folgen) und ein abschließendes Fazit.
- Quote paper
- Lars Marwinski (Author), 2014, Konstantin I. und die Christen. Die Religionspolitik zwischen 313 und 321, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339645