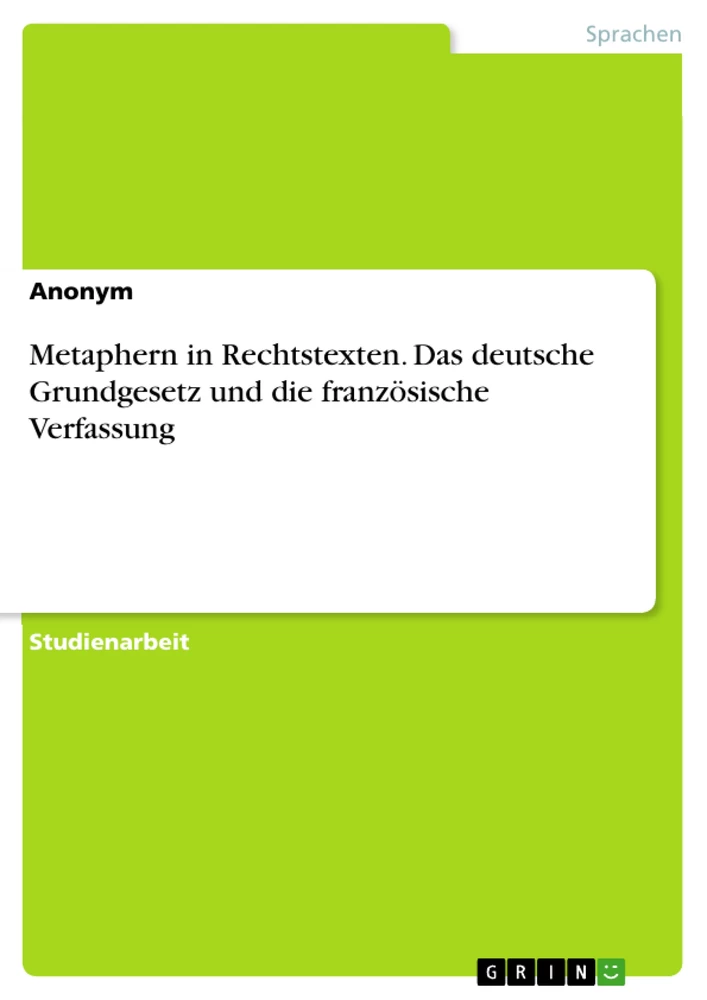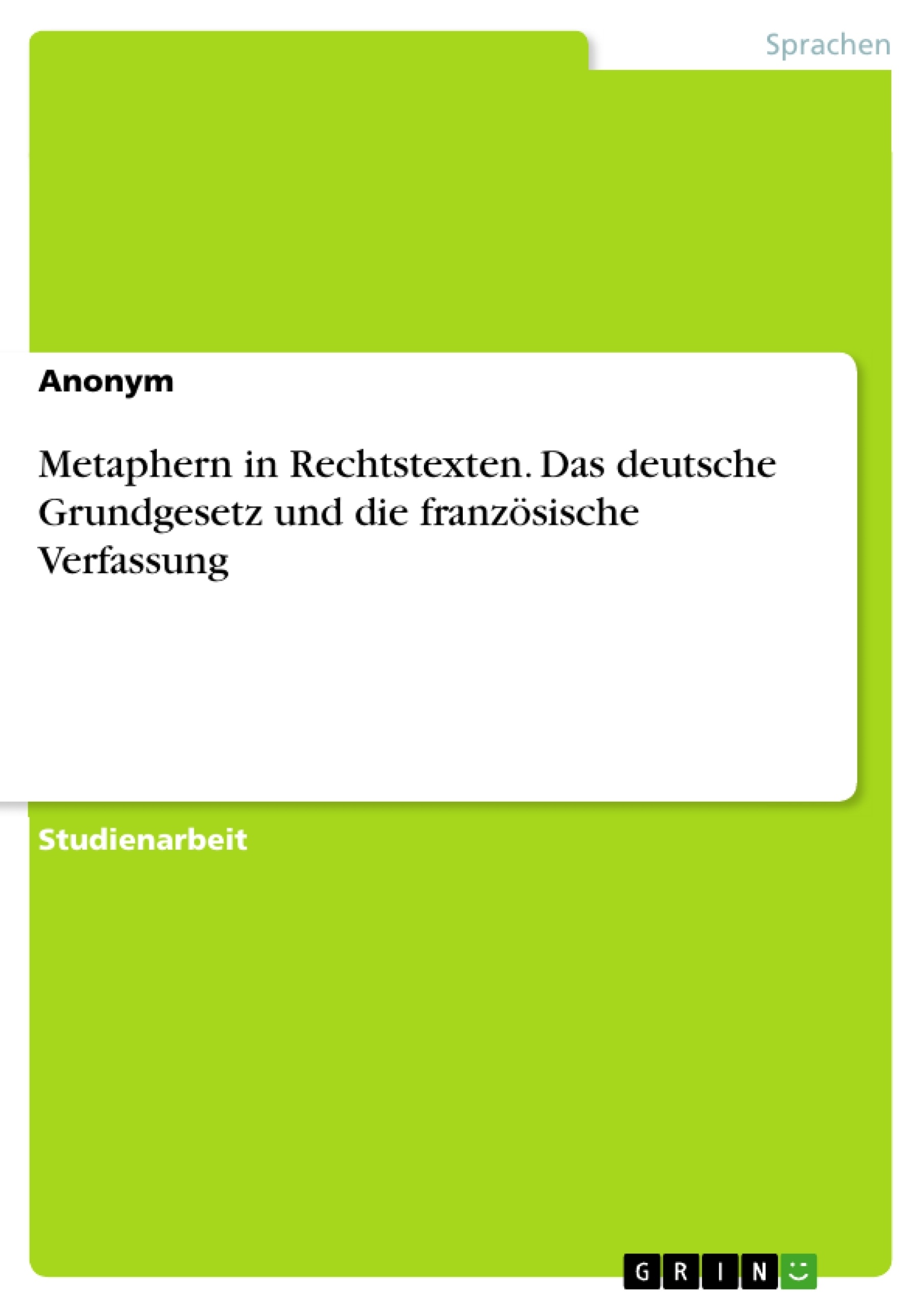Ziel dieser Seminararbeit ist es, die Frequenz von Metaphern, insbesondere Orientierungs- und Konzeptmetaphern, in den beiden Sprachen, Deutsch und Französisch, genauer gesagt in deren Rechtstexten, darzustellen und zugleich herauszufinden, ob es in einer der beiden Sprachen möglicherweise eher einen Hang zu Metaphern gibt.
Die Allgegenwärtigkeit von Metaphern im Alltag der Menschen ist, unter anderem, Gegenstand beziehungsweise die Basis der vorliegenden Seminararbeit.
Es stellt sich die Frage, ob Metaphern tatsächlich in allen denkbaren Bereichen des Lebens, also auch in der Rechtssprache, existieren. Grundsätzlich werden Rechtstexte häufig als äußerst nüchtern und trocken angesehen und man verbindet sie eher weniger mit rhetorischen Figuren wie Metaphern. Daher ist es sehr interessant herauszufinden, ob und wie häufig Metaphern in Wirklichkeit in Rechtstexten vorhanden sind.
Basierend auf einer einleitenden Darstellung von „Metaphors we live by“ von Lakoff und Johnson und der Bildfeldtheorie nach Harald Weinrich folgt zunächst eine getrennte Darstellung des deutschen Grundgesetzes und der französischen Verfassung im Hinblick auf die vorkommende Metaphorik. Anschließend folgt eine Gegenüberstellung der beiden Rechtstexte beziehungsweise deren Metaphernfrequenzen.
Abschließend werden in einem Fazit die Ergebnisse der Gegenüberstellung zusammenfassend dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der kognitiven Metapherntheorie von Lakoff und Johnson
- Die Bildfeldtheorie nach Harald Weinrich
- Metaphern in der deutschen Rechtssprache am Beispiel des deutschen Grundgesetzes
- Metaphern in der französischen Rechtssprache am Beispiel der französischen Verfassung (Constitution)
- Gegenüberstellung der Metaphernfrequenz
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Häufigkeit von Metaphern, insbesondere Orientierungs- und Konzeptmetaphern, im deutschen Grundgesetz und der französischen Verfassung. Ziel ist es, die Frequenz von Metaphern in beiden Sprachen zu vergleichen und herauszufinden, ob eine Sprache einen stärkeren Hang zu Metaphern in rechtlichen Texten aufweist.
- Kognitive Metapherntheorie nach Lakoff und Johnson
- Analyse von Metaphern im deutschen Grundgesetz
- Analyse von Metaphern in der französischen Verfassung
- Vergleich der Metaphernfrequenz zwischen beiden Texten
- Bedeutung von Metaphern in der Rechtssprache
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Metaphern in Rechtssprachen ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Vorkommen und der Häufigkeit von Metaphern in deutschen und französischen Verfassungstexten. Sie begründet die Relevanz des Themas mit der Annahme, dass Rechtstexte oft als nüchtern und trocken wahrgenommen werden, und untersucht, ob diese Annahme zutrifft. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz: eine Darstellung der kognitiven Metapherntheorie von Lakoff und Johnson sowie der Bildfeldtheorie nach Weinrich, gefolgt von separaten Analysen des Grundgesetzes und der französischen Verfassung und schließlich einem Vergleich der Metaphernfrequenzen.
2. Grundlagen der kognitiven Metapherntheorie von Lakoff und Johnson: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die kognitive Metapherntheorie von Lakoff und Johnson, ohne in alle Details einzugehen. Es wird die Auffassung von Metaphern als alltäglicher Bestandteil des Denkens und Handelns dargestellt, nicht nur als rhetorisches Stilmittel. Die Theorie der Konzeptmetaphern wird erläutert, wobei Beispiele wie "Argumentieren ist Krieg" und "Zeit ist Geld" die allgegenwärtige Verwendung von Metaphern verdeutlichen. Das Kapitel beleuchtet die Funktion von Metaphern, sowohl im Hervorheben bestimmter Aspekte als auch im Verbergen anderer, und führt den Begriff der Orientierungsmetaphern ein, die auf Raumorientierungen basieren und unsere Erfahrungen widerspiegeln.
3. Metaphern in der deutschen Rechtssprache am Beispiel des deutschen Grundgesetzes und 3.1 Metaphern in der französischen Rechtssprache am Beispiel der französischen Verfassung (Constitution): Diese Kapitel analysieren die Metaphorik im deutschen Grundgesetz und der französischen Verfassung. Sie untersuchen die Art und Häufigkeit der verwendeten Metaphern, wobei Konzeptmetaphern und Orientierungsmetaphern im Fokus stehen. Der Vergleich beider Rechtssysteme legt den Fokus auf sprachliche Unterschiede im Umgang mit Metaphern im rechtlichen Kontext und zeigt, wie Metaphern dazu beitragen, komplexe rechtliche Konzepte verständlicher und greifbarer zu machen, oder im Gegenteil, bestimmte Aspekte zu verschleiern oder zu betonen.
4. Gegenüberstellung der Metaphernfrequenz: Dieses Kapitel präsentiert einen quantitativen und qualitativen Vergleich der Metaphernfrequenz im deutschen Grundgesetz und der französischen Verfassung. Es analysiert die Unterschiede in der Verwendung von Metaphern zwischen beiden Sprachen und diskutiert mögliche Gründe für diese Unterschiede, beispielsweise kulturelle Einflüsse oder Unterschiede im sprachlichen Stil. Die Ergebnisse dieses Kapitels liefern die Grundlage für die Schlussfolgerungen der Arbeit.
Schlüsselwörter
Metapher, kognitive Metapherntheorie, Lakoff & Johnson, Bildfeldtheorie, Weinrich, Rechtssprache, Grundgesetz, französische Verfassung, Konzeptmetapher, Orientierungsmetapher, Sprachvergleich, Metaphernfrequenz.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Metaphern in der deutschen und französischen Rechtssprache
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit untersucht die Häufigkeit von Metaphern, insbesondere Orientierungs- und Konzeptmetaphern, im deutschen Grundgesetz und der französischen Verfassung. Das Ziel ist ein Vergleich der Metaphernfrequenz in beiden Sprachen, um festzustellen, ob eine Sprache einen stärkeren Hang zu Metaphern in rechtlichen Texten aufweist.
Welche Theorien werden angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf die kognitive Metapherntheorie von Lakoff und Johnson und die Bildfeldtheorie nach Harald Weinrich. Diese Theorien bilden die Grundlage für die Analyse der Metaphern in den beiden Verfassungen.
Welche Texte werden analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf das deutsche Grundgesetz und die französische Verfassung (Constitution). Die Arbeit vergleicht die Metaphorik beider Texte, um sprachliche Unterschiede im Umgang mit Metaphern im rechtlichen Kontext aufzuzeigen.
Wie wird die Analyse durchgeführt?
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema und die verwendeten Theorien. Es folgen separate Analysen des deutschen Grundgesetzes und der französischen Verfassung, wobei die Art und Häufigkeit der verwendeten Metaphern (Konzept- und Orientierungsmetaphern) im Fokus stehen. Abschließend wird ein quantitativer und qualitativer Vergleich der Metaphernfrequenz beider Texte durchgeführt.
Welche Arten von Metaphern werden untersucht?
Die Analyse konzentriert sich auf Konzeptmetaphern und Orientierungsmetaphern. Konzeptmetaphern beschreiben komplexe Konzepte mithilfe von metaphorischen Bildern (z.B. "Argumentieren ist Krieg"), während Orientierungsmetaphern auf Raumorientierungen basieren und unsere Erfahrungen widerspiegeln.
Was sind die Ergebnisse der Arbeit?
Die Arbeit präsentiert einen quantitativen und qualitativen Vergleich der Metaphernfrequenz im deutschen Grundgesetz und der französischen Verfassung. Sie analysiert die Unterschiede in der Verwendung von Metaphern zwischen beiden Sprachen und diskutiert mögliche Gründe für diese Unterschiede (z.B. kulturelle Einflüsse oder Unterschiede im sprachlichen Stil).
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen basieren auf den Ergebnissen des quantitativen und qualitativen Vergleichs der Metaphernfrequenz. Die Arbeit diskutiert, wie Metaphern dazu beitragen, komplexe rechtliche Konzepte verständlicher und greifbarer zu machen, oder im Gegenteil, bestimmte Aspekte zu verschleiern oder zu betonen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Metapher, kognitive Metapherntheorie, Lakoff & Johnson, Bildfeldtheorie, Weinrich, Rechtssprache, Grundgesetz, französische Verfassung, Konzeptmetapher, Orientierungsmetapher, Sprachvergleich, Metaphernfrequenz.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2013, Metaphern in Rechtstexten. Das deutsche Grundgesetz und die französische Verfassung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339686