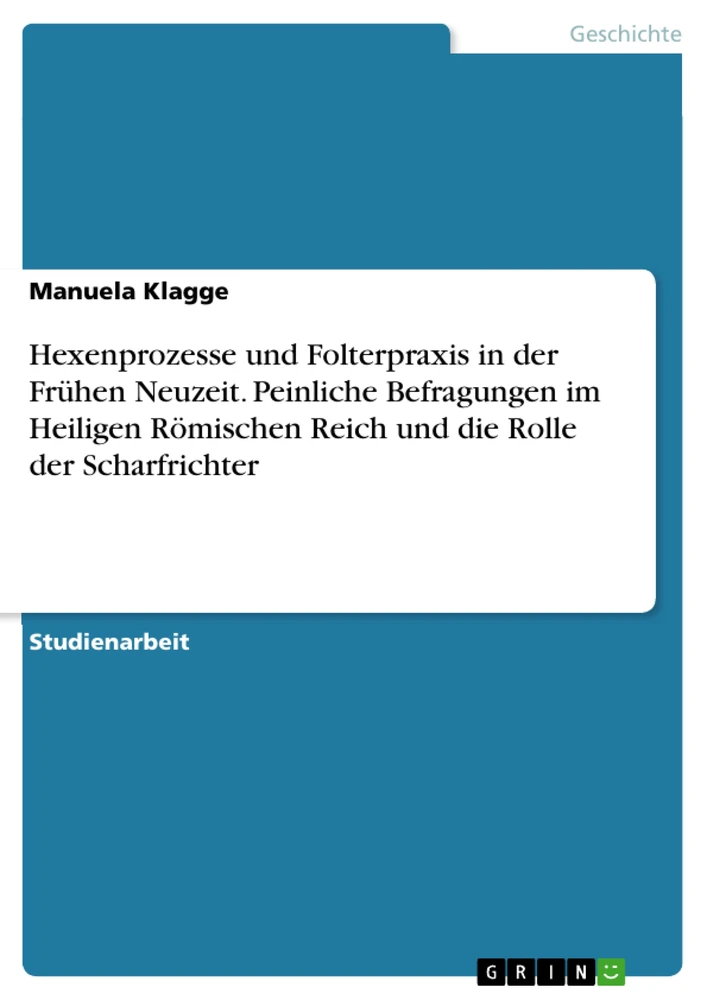Die vorliegende Arbeit wird zeigen, dass die Foltern in Hexenprozessen keineswegs so ungehemmt und grausam abliefen, wie allgemein angenommen wird, und dass auch der folternde Scharfrichter sich an Regeln zu halten hatte. Was geschah, wenn die vermeintliche Hexe selbst während der Folter leugnete? Wurden alle Angeklagten auch verurteilt? Und konnte die Folter auch ohne Geständnis überstanden werden?
Diese Arbeit wird nicht nach den Schuldigen oder Opfern der Hexenprozesse suchen, und auch nicht die Inquisition verurteilen, sondern nur die Inquisitionspraxis mit dem Schwerpunkt auf die Foltermethoden betrachten. Historiker schätzen die europaweite Zahl der Hinrichtungen vermeintlicher Hexen inzwischen auf 50.000. Dass in den katholischen Gebieten hierbei entschiedener vorgegangen wurde oder mehr Opfer zu beklagen sind, wird nicht bestätigt.
Denn allein im protestantischen Herzogtum Mecklenburg wurden circa 2.000 Hinrichtungen vollstreckt. Deshalb zählen neuere Studien über die Hexenverfolgung Mecklenburg zu den verfolgungsintensivsten Gebieten im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Darum wird auf die Hexenverfolgung und Folterpraxis in Mecklenburg noch einmal gesondert eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Maßgebende Werke der Hexenprozesse
- Malleus Maleficarum – Der Hexenhammer
- Constitutio Criminalis Carolina
- Der Inquisitionsprozess
- Die Folter – Spezialinquisition
- Die Anwendung der Folter
- Der Scharfrichter
- Die Foltergrade und Foltermethoden
- Gegner der Folter in der Frühen Neuzeit
- Cesare Beccaria und Friedrich von Spee
- Cornelius Pleier und Benedict Carpzov
- Die Hexenprozesse im Herzogtum Mecklenburg
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rolle des Scharfrichters in Hexenprozessen der Frühen Neuzeit, wobei das Augenmerk auf die Folterpraxis gelegt wird. Ziel ist es, zu zeigen, dass die Folter nicht so ungehemmt und grausam ablief, wie oft angenommen, und dass auch der Scharfrichter an Regeln gebunden war. Die Arbeit betrachtet die Inquisitionspraxis, ohne Schuldzuweisungen an die Opfer oder Verurteilungen der Inquisition selbst.
- Die Rolle des Scharfrichters in der Folterpraxis
- Die Anwendung von Foltermethoden in Hexenprozessen
- Regelungen und Einschränkungen der Folterpraxis
- Die Kritik an der Folter durch zeitgenössische Gelehrte
- Die Besonderheiten der Hexenverfolgung im Herzogtum Mecklenburg
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Scharfrichterrolle in Hexenprozessen ein und stellt die Notwendigkeit der Folter zur Erlangung eines Geständnisses heraus. Das zweite Kapitel untersucht maßgebende Werke wie den "Malleus Maleficarum" und die "Constitutio Criminalis Carolina", die den Ablauf von Hexenprozessen beeinflussten.
Kapitel 3 beschreibt den Ablauf des Inquisitionsprozesses und die Rolle von Besagungen und Indizien, die die Anwendung der Folter rechtfertigten. Kapitel 4 befasst sich mit der Folterpraxis an sich und den Regeln, die den Scharfrichter und seine Knechte bei der Anwendung der Foltermethoden einhielten.
Kapitel 5 stellt einige der wichtigsten Gegner der Folter in der Frühen Neuzeit vor und ihre Argumente gegen die willkürliche Anwendung von Torturen. Schließlich wird im sechsten Kapitel auf die Hexenprozesse im Herzogtum Mecklenburg eingegangen, das als eines der Hauptzentren der Hexenverfolgung gilt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter in dieser Arbeit sind: Hexenprozesse, Folter, Scharfrichter, Inquisitionsprozess, "Malleus Maleficarum", "Constitutio Criminalis Carolina", Cesare Beccaria, Friedrich von Spee, Cornelius Pleier, Benedict Carpzov, Herzogtum Mecklenburg, Denunziation, Geständnisquote, Todesstrafe, Rechtsgelehrte.
- Quote paper
- Manuela Klagge (Author), 2010, Hexenprozesse und Folterpraxis in der Frühen Neuzeit. Peinliche Befragungen im Heiligen Römischen Reich und die Rolle der Scharfrichter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339947