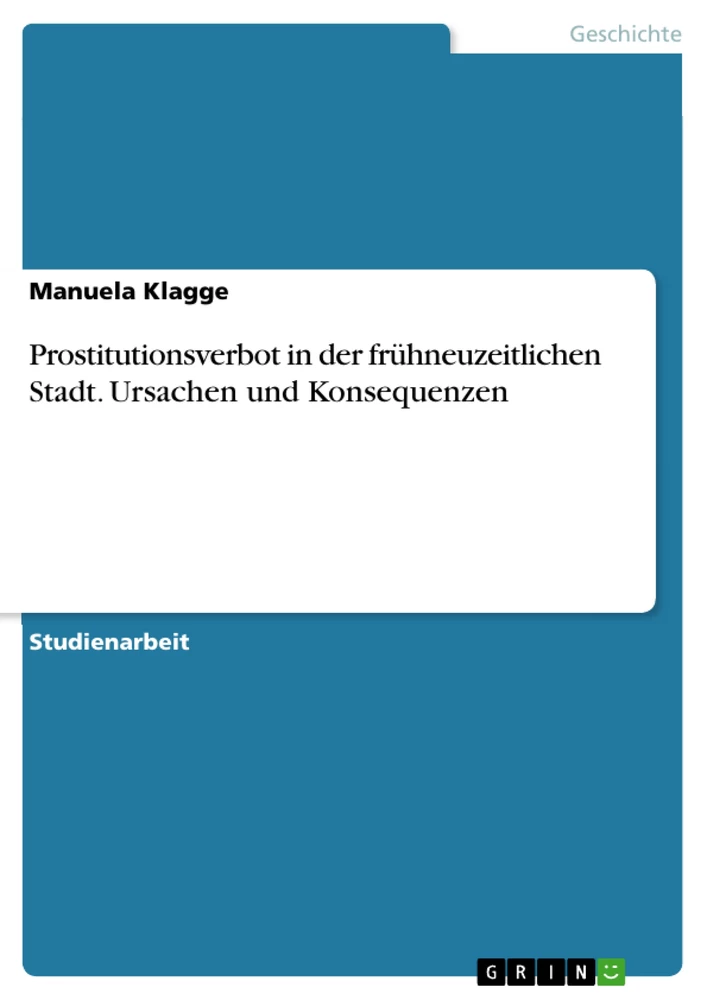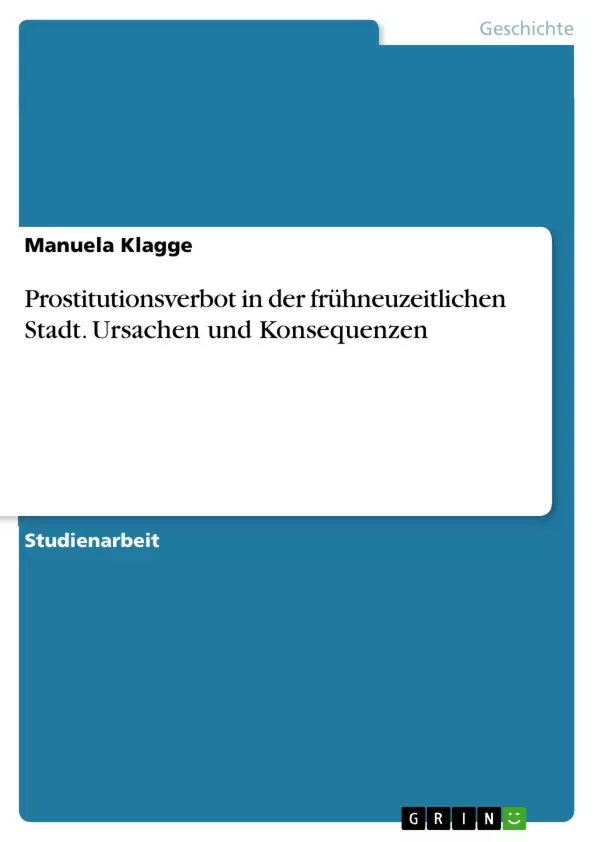Es gab in den vergangenen Jahren nur eine sehr dünne Schicht an Neuerscheinungen, die das Thema Prostitution in der Frühen Neuzeit behandelten, die neuste Literatur dazu ist zehn bis 20 Jahre alt. Die wohl neueste Veröffentlichung über das benannte Thema ist Lotte van de Pols „Der Bürger und die Hure“, eine Abhandlung über die Prostitution im frühneuzeitlichen Amsterdam.
Im Zuge dieser Arbeit werden zu den Beschreibungen der institutionalisierten Prostitution im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation die neueren Erkenntnisse Pols hinzugezogen. Für die Frauenhäuser in Deutschland und deren spätere Schließungen wird sich diese Arbeit hauptsächlich auf Peter Schusters „Frauenhäuser“ und Beate Schusters „Die freien Frauen“ stützen.
Der Großteil der kürzlich veröffentlichten Literatur bezieht sich auf die Prostitution im Mittelalter, dort hat das städtische Frauenhaus seine Wurzeln. Da die Grenze des Mittelalters zur Frühen Neuzeit eher fließend verläuft, lässt sich nicht endgültig festlegen, wie weit die beschriebenen Phänomene im Mittelalter oder in der Frühen Neuzeit liegen. Die Zeitspanne, der sich diese Arbeit widmet, wird den Beginn der Frühen Neuzeit (ca. von 1500 bis 1650) umfassen und einen kurzen Blick darüber hinaus werfen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein Blick zurück - Frauenhausgründungen
- Verbot der Prostitution
- Schließung der Frauenhäuser
- Schließungsgründe
- Schließungsgrund Syphilis?
- Weitere Schließungsgründe
- Reformierte Gebiete
- Katholische Gebiete
- Widerstand gegen die Frauenhausschließungen
- Die Folgen der Schließungen für die Prostituierten
- Verfolgung der Prostituierten nach den Frauenhausschließungen
- Strafen
- Entehrende Strafen
- Körperliche Strafen
- Wege aus der Prostitution
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte der städtischen Frauenhäuser im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation von ca. 1500 bis 1650 und deren Schließung im 16. Jahrhundert. Sie beleuchtet die Gründe für die Gründung dieser Einrichtungen, den Wandel in der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Prostitution und die Folgen der Schließungen für die betroffenen Frauen.
- Gründung und Funktion der städtischen Frauenhäuser im 15. Jahrhundert
- Die Kriminalisierung der Prostitution und die damit verbundene Schließung der Frauenhäuser
- Unterschiedliche regionale Entwicklungen (katholische vs. reformierte Gebiete)
- Die Folgen der Frauenhausschließungen für die Prostituierten
- Gesellschaftliche Wahrnehmung und Stigmatisierung von Prostituierten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert die Forschungslage zur Prostitution in der Frühen Neuzeit und die Schwierigkeiten, diese aufgrund der Geheimhaltung zu erforschen. Sie verortet die Prostitution als Randgruppenphänomen und benennt die wichtigsten Forschungsquellen für die Untersuchung der Frauenhäuser und deren Schließung im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Die Arbeit konzentriert sich auf den Zeitraum von ca. 1500 bis 1650, in dem der Wandel in der gesellschaftlichen Einstellung zur Prostitution und die Schließung der Frauenhäuser stattfanden. Die zentrale Fragestellung ist, wie es zur Schließung der städtischen Frauenhäuser kam und welche Konsequenzen dies für die betroffenen Frauen hatte.
Ein Blick zurück - Frauenhausgründungen: Dieses Kapitel beleuchtet die Gründung städtischer Frauenhäuser im 14. und 15. Jahrhundert. Es wird dargelegt, dass die Stadträte die Einrichtung dieser Häuser primär als Mittel zur Kontrolle und Eindämmung der Prostitution sahen, oft unter Aufsicht des Scharfrichters. Trotz der gesellschaftlichen Abneigung gegen die Prostitution, wurden Frauenhäuser als Mittel des Schutzes ehrbarer Frauen und zur Vermeidung größerer Übel angesehen. Die Argumente für die Gründung waren vielschichtig und reichten vom Schutz der Bevölkerung bis hin zur Behauptung, die Kirche billige diese Einrichtungen. Finanzielle Motive werden von den Autoren der untersuchten Quellen abgelehnt.
Verbot der Prostitution: Dieses Kapitel beschreibt die Kriminalisierung und das Verbot der Prostitution im 16. Jahrhundert und die daraus resultierende Schließungswelle der Frauenhäuser. Der Prozess der Schließung war nicht einheitlich und zog sich über mehrere Jahrzehnte hin. Das Beispiel Nürnberg veranschaulicht die schrittweise Marginalisierung der Prostituierten und die langwierige Schließung des dortigen Frauenhauses, beginnend mit eingeschränkten Öffnungszeiten bis zur endgültigen Auflösung. Die Schließung wurde teilweise mit der Behauptung begründet, dass die Frauenhäuser den Ruf der Städte schädigten, anstatt die Kriminalität zu reduzieren. Auch Großereignisse führten dazu, dass die Frauenhäuser temporär oder dauerhaft geschlossen wurden, um den Ruf der Stadt zu schützen.
Schlüsselwörter
Prostitution, Frauenhäuser, Frühe Neuzeit, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, Kriminalisierung, soziale Kontrolle, gesellschaftliche Randgruppen, Schließung, Stigmatisierung, Reformierte Gebiete, Katholische Gebiete.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Städtische Frauenhäuser im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation (ca. 1500-1650)"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Geschichte der städtischen Frauenhäuser im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation von ca. 1500 bis 1650, insbesondere deren Schließung im 16. Jahrhundert. Sie beleuchtet die Gründe für deren Gründung, den Wandel in der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Prostitution und die Folgen der Schließungen für die betroffenen Frauen.
Welche Zeitspanne wird untersucht?
Der Fokus liegt auf dem Zeitraum von etwa 1500 bis 1650, einer Periode, die durch einen Wandel in der gesellschaftlichen Einstellung zur Prostitution und die Schließung der Frauenhäuser gekennzeichnet war.
Warum wurden Frauenhäuser gegründet?
Die Stadträte sahen in der Einrichtung von Frauenhäusern primär ein Mittel zur Kontrolle und Eindämmung der Prostitution. Trotz gesellschaftlicher Abneigung gegen die Prostitution dienten sie dem Schutz ehrbarer Frauen und der Vermeidung größerer Übel. Die Argumente reichten vom Schutz der Bevölkerung bis hin zur Behauptung, die Kirche billige diese Einrichtungen. Finanzielle Motive wurden von den Autoren der untersuchten Quellen abgelehnt.
Wie verlief der Prozess der Schließung der Frauenhäuser?
Der Prozess war nicht einheitlich und erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte. Die Schließung erfolgte schrittweise, beispielsweise durch eingeschränkte Öffnungszeiten, bevor es zur endgültigen Auflösung kam (Beispiel Nürnberg). Die Schließung wurde teilweise mit der Begründung gerechtfertigt, dass die Frauenhäuser den Ruf der Städte schädigten, anstatt die Kriminalität zu reduzieren. Auch Großereignisse führten zu temporären oder dauerhaften Schließungen.
Welche Gründe gab es für die Schließung der Frauenhäuser?
Die Schließung wurde mit verschiedenen Gründen begründet, darunter die Behauptung, die Frauenhäuser würden den Ruf der Städte schädigen und die Kriminalität nicht reduzieren. Die Möglichkeit einer Syphilis-Ausbreitung wird ebenfalls als möglicher Schließungsgrund diskutiert. Weitere Schließungsgründe werden in der Arbeit detailliert untersucht.
Gab es regionale Unterschiede in der Entwicklung?
Ja, die Arbeit untersucht unterschiedliche regionale Entwicklungen in katholischen und reformierten Gebieten, da die Schließung der Frauenhäuser nicht einheitlich verlief.
Welche Folgen hatten die Schließungen für die Prostituierten?
Die Arbeit beleuchtet die Verfolgung der Prostituierten nach den Schließungen und die verhängten Strafen, darunter entehrende und körperliche Strafen. Es wird untersucht, welche Wege aus der Prostitution für die betroffenen Frauen bestanden.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene Quellen, die in der Einleitung näher beschrieben werden. Aufgrund der Geheimhaltung der Prostitution ist die Recherche schwierig.
Welche zentralen Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Fragestellung ist, wie es zur Schließung der städtischen Frauenhäuser kam und welche Konsequenzen dies für die betroffenen Frauen hatte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Prostitution, Frauenhäuser, Frühe Neuzeit, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, Kriminalisierung, soziale Kontrolle, gesellschaftliche Randgruppen, Schließung, Stigmatisierung, Reformierte Gebiete, Katholische Gebiete.
- Citation du texte
- Manuela Klagge (Auteur), 2010, Prostitutionsverbot in der frühneuzeitlichen Stadt. Ursachen und Konsequenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339960