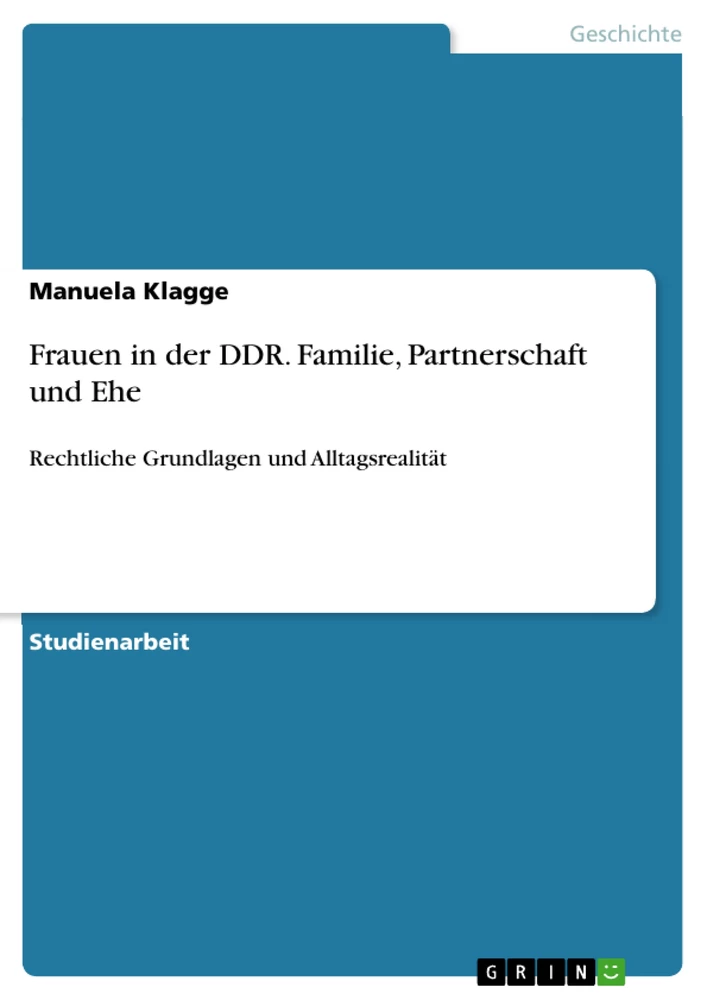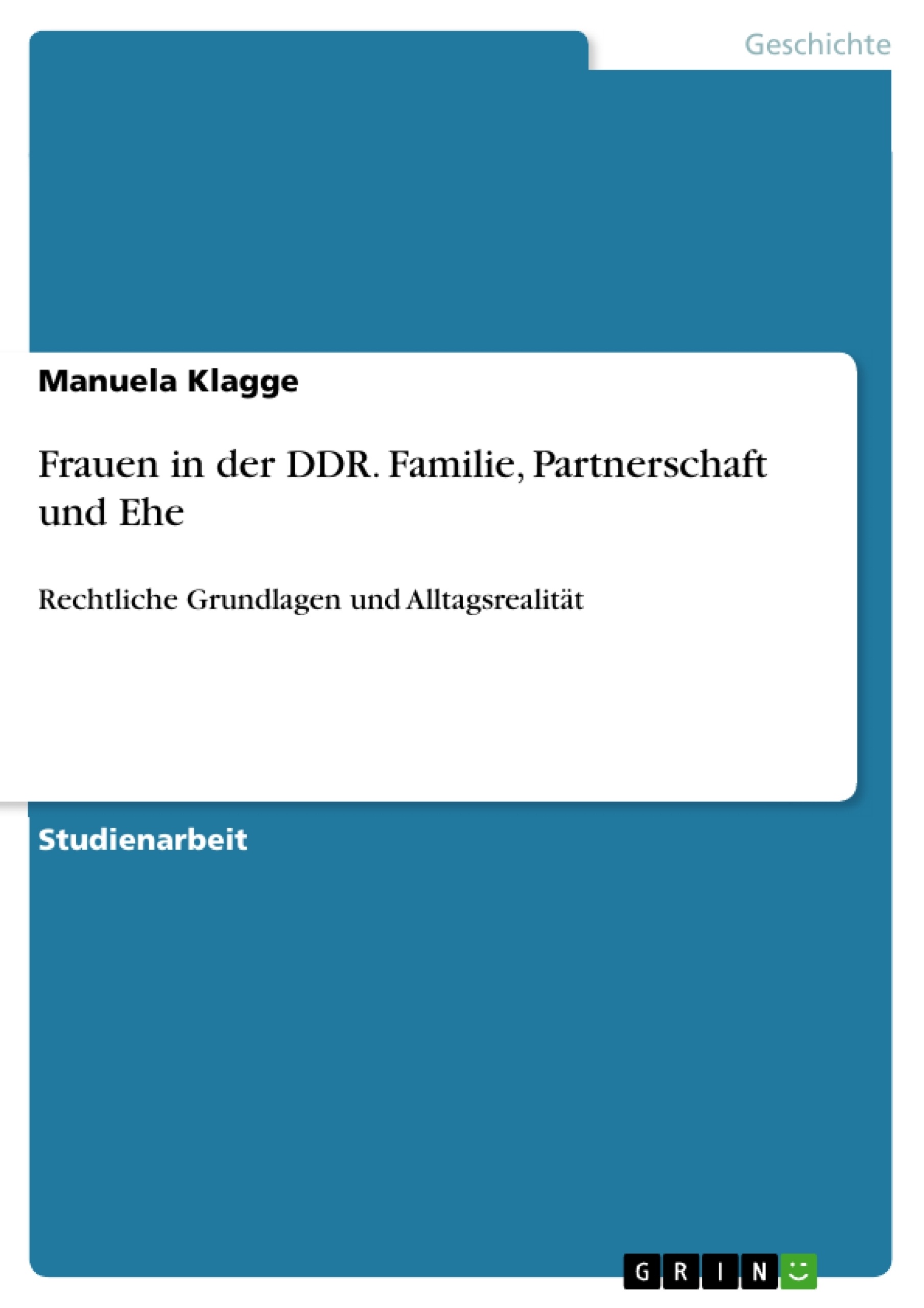Frauen wurden in der DDR mit einem besonderen Interesse bedacht. Sie waren letztendlich diejenigen, die den Erhalt der sozialistischen Gesellschaft durch die Geburt von Kindern sicherten. Gleichzeitig stellten sie nach dem Zweiten Weltkrieg den größten Teil der Bevölkerung und spielten somit eine entscheidende Rolle in der Produktion. Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele Regelungen und Erleichterungen auf die Bedürfnisse der Frauen ausgerichtet waren. In der folgenden Arbeit sollen diese betrachtet und den Lebenswirklichkeiten der DDR-Frauen in ihrem Alltag gegenübergestellt werden.
Einen wichtigen Wendepunkt für die Situation der Frauen innerhalb der Familien bildeten die 1960er und 70er Jahre. In dieser Zeit entstand das Familiengesetzbuch der DDR (FGB) und eine Neuformulierung des Parteiprogramms der SED. Welche politischen Bestimmungen existierten in der DDR zur Regelung des privaten Bereiches bezüglich der Frauen in Familie, Partnerschaft und Ehe? Wie sahen der Alltag und die Lebenswirklichkeit der Frauen nun aus? Diesen zentralen Fragen widmet sich die vorliegende Arbeit.
Da in der DDR bis 1990 die SED gesetzmäßig allein regierte, bildet ihr Programm von 1976 den Ausgangspunkt dieser Analyse. Anhand der ideellen Vorstellung der Alltagssituation von Frauen in der DDR durch die SED, welche in ihrem Parteiprogramm festgehalten ist, werde ich diese Vorstellung der Realität in den einzelnen Bereichen – Familie, Partnerschaft und Ehe – gegenüberstellen.
In der Forschungsliteratur werden oftmals nur die Erwerbstätigkeit der Frauen und deren Vereinbarungsstrategien zwischen Beruf und Familie betrachtet. Untersuchungen zum privaten Bereich, besonders bezogen auf die innerfamiliäre Beziehung zwischen Frau und Mann, sind kaum erfolgt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rechtliche Grundlagen
- Das Familienrecht in der DDR
- Die Gleichstellungspolitik der DDR
- Das Programm der SED von 1976
- DDR-Frauen in Familie, Partnerschaft und Ehe
- Die werktätige Mutter
- DDR-Frauen in der Familie
- Familienformen
- Unterstützung der Familien
- DDR-Frauen in der Ehe: Gleiche Rechte - Gleiche Pflichten?
- DDR-Frauen in Partnerschaft: Gleichberechtigung und Reproduktion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die rechtlichen Grundlagen und die alltägliche Realität von DDR-Frauen in Familie, Partnerschaft und Ehe. Sie beleuchtet die politischen Bestimmungen der DDR, insbesondere das Programm der SED von 1976, und setzt diese in Bezug zu den Lebenserfahrungen von Frauen in den verschiedenen Bereichen. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die Gleichstellungspolitik der DDR die Lebenswelt von Frauen in der DDR tatsächlich beeinflusst hat.
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Gleichstellungspolitik der DDR
- Die Rolle des SED-Programms von 1976 in der Gestaltung der Familienpolitik
- Die Lebenswirklichkeit von DDR-Frauen in Familie, Partnerschaft und Ehe
- Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für DDR-Frauen
- Die Rolle der Frauen in der DDR-Gesellschaft als „werktätige Mütter“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die rechtlichen Grundlagen, die die Situation von Frauen in der DDR bestimmten. Hierbei wird das Familienrecht der DDR im Vergleich zur Gleichstellungspolitik betrachtet. Es werden die wichtigsten Punkte des Familiengesetzbuches der DDR und des SED-Programms von 1976 beleuchtet.
Kapitel 4.1 widmet sich der Rolle der „werktätigen Mutter“ in der DDR-Gesellschaft. Hier werden die Erwartungen und Anforderungen an Frauen in Bezug auf Berufstätigkeit und Kindererziehung untersucht. Kapitel 4.2 beleuchtet die verschiedenen Familienformen und die Unterstützungsmöglichkeiten für Familien in der DDR. Kapitel 4.3 befasst sich mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Ehe und Kapitel 4.4 analysiert die Rolle von Frauen in Partnerschaften in Bezug auf Gleichberechtigung und Reproduktion.
Schlüsselwörter
DDR-Frauen, Familienpolitik, Gleichstellung, SED-Programm, Familiengesetzbuch, Berufstätigkeit, Kindererziehung, Familienformen, Ehe, Partnerschaft, Reproduktion.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten Frauen in der sozialistischen Gesellschaft der DDR?
Frauen sicherten durch Geburten den Fortbestand der Gesellschaft und waren zugleich als Arbeitskräfte in der Produktion unverzichtbar.
Was war das Ziel des Familiengesetzbuches (FGB) der DDR?
Das FGB regelte den privaten Bereich und sollte die rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau in Ehe und Familie festschreiben.
Was bedeutete der Begriff „werktätige Mutter“ im DDR-Alltag?
Er beschrieb das staatliche Ideal der Frau, die Berufstätigkeit und Kindererziehung erfolgreich miteinander vereinbart.
Wie unterstützte der Staat Familien in der DDR?
Es gab zahlreiche Regelungen und Erleichterungen, die darauf abzielten, die Belastung von Frauen zu senken und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern.
Gab es in der DDR-Ehe tatsächlich „gleiche Pflichten“?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob die proklamierte Gleichberechtigung in der innerfamiliären Beziehung zwischen Mann und Frau der Realität entsprach.
Warum ist das SED-Programm von 1976 für diese Analyse wichtig?
Da die SED allein regierte, bildete ihr Programm die ideelle Vorgabe für die Familienpolitik, an der die tatsächliche Lebenswirklichkeit gemessen werden kann.
- Quote paper
- Manuela Klagge (Author), 2012, Frauen in der DDR. Familie, Partnerschaft und Ehe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340000