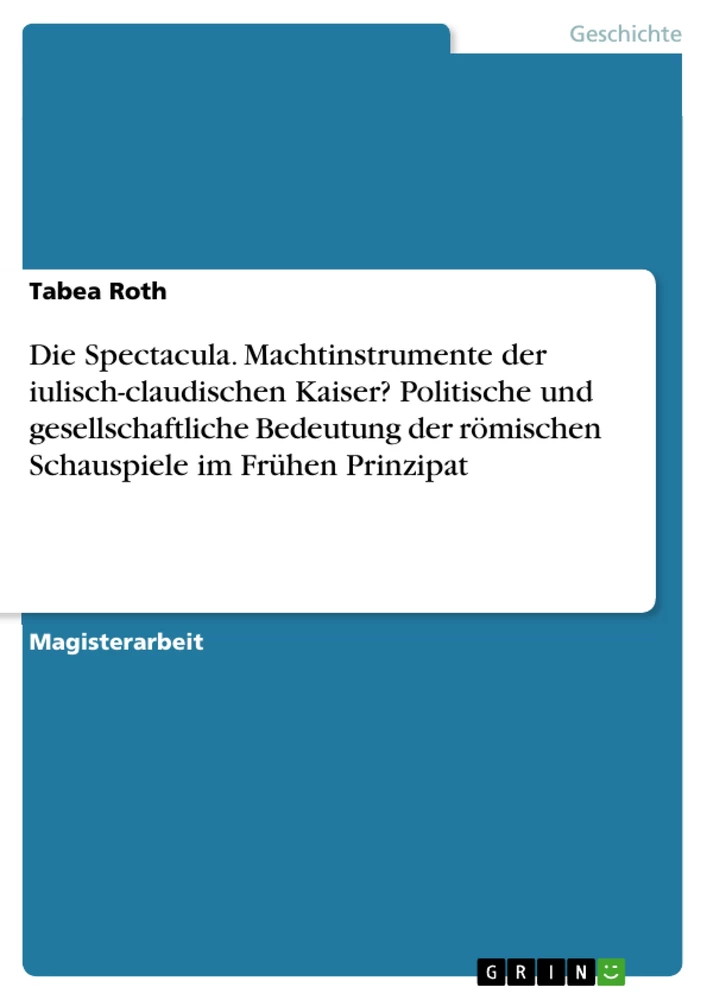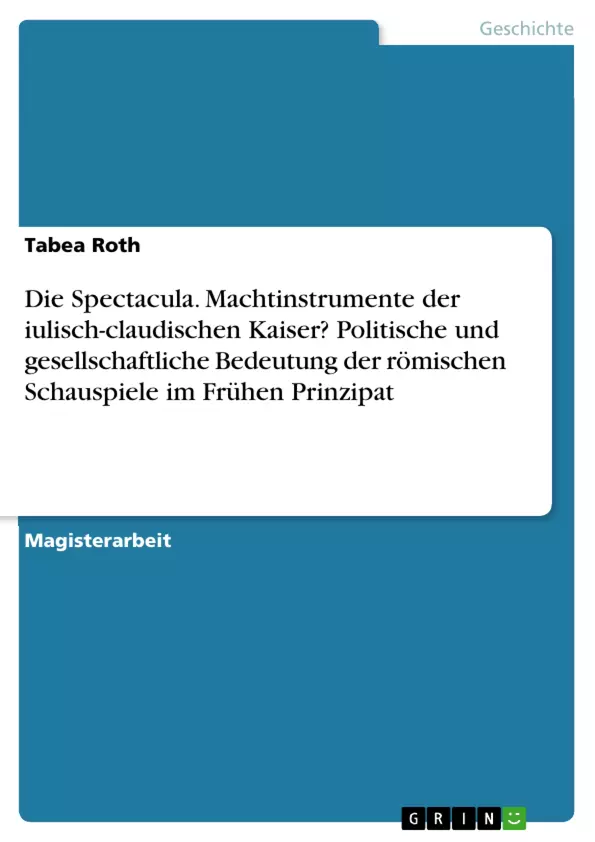In Anbetracht der Tatsache, dass der Prinzipat offensichtlich an wesentliche Elemente der caesarischen Diktatur anknüpft, ist es gerechtfertigt, zu fragen, ob die ihm nachfolgenden Kaiser möglicherweise weitere politische Mittel Gaius Iulius Caesars, wie zum Beispiel die Instrumentalisierung der Spectacula, übernommen haben. Dieser Aspekt ist deshalb interessant, da zum einen das Engagement des Augustus für das römische Spielwesen, das des Diktators nochmals übertraf, sich aber zum anderen die politische Bedeutung der Plebs urbana, an die sich die pompösen Schauspiele Caesars in erster Linie gerichtet hatten, seit der Gründung des Kaisertums, das sich vor allem auf die Loyalität des Senatorenstandes stützte, entscheidend gewandelt hatte.
Sollten die Alleinherrscher, wie es Augustus durch die Res gestae vermuten lässt, die Spectacula also tatsächlich in ähnlicher Weise wie der Diktator für ihre Politik instrumentalisiert haben, mussten dafür in der Kaiserzeit andere Gründe vorgelegen haben als noch unter der caesarischen Diktatur, da die Principes im Gegensatz zu Caesar nicht mehr darauf angewiesen waren, ihre Gesetzesinitiativen, ihre Auswahl von Beamten oder sonstige ihrer politischen Aktivitäten von der Volksversammlung legitimieren zu lassen.
Diese Arbeit möchte sich daher mit der Frage auseinandersetzten, inwiefern die Bedeutung der in Rom ausgerichteten Spectacula für die Phase des Aufbaus, der Etablierung und der Stabilisierung des Prinzipats ab 27 v. Chr. mit der für die Errichtung der caesarischen Diktatur vergleichbar ist. Da die Konsolidierung der Monarchie in die Regierungszeit der iulisch-claudischen Kaiser fällt, konzentriert sie sich dabei auf die Schauspiele, die im Frühen Prinzipat veranstaltet wurden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Die Bedeutung der Spectacula bei der Errichtung der caesarischen Diktatur
- 1.2 Die caesarische Diktatur im Vergleich zum augusteischen Prinzipat
- 1.3 Zum Gegenstand dieser Arbeit
- 2. Die Entwicklung der Spectacula von ihren Anfängen bis zum Ende der Römischen Republik
- 2.1 Die Königszeit
- 2.2 Die Frühe Republik
- 2.3 Die Mittlere Republik
- 2.4 Die Späte Republik
- 2.5 Die Reorganisation der Spectacula in der Kaiserzeit
- 3. Bisherige Thesen der Geschichtswissenschaft zur Bedeutung der Spectacula in der Kaiserzeit
- 3.1 Die Spectacula als Mittel der Kaiser zur Entpolitisierung der Plebs urbana
- 3.1.1 Jérôme Carcopino
- 3.1.2 Aspekte, die gegen die Annahmen Carcopinos sprechen
- 3.2 Die Spectacula als Ersatz für die republikanische Volksversammlung
- 3.2.1 Ludwig Friedländer
- 3.2.2 Aspekte, die gegen Friedländers These sprechen
- 3.3 Die politische Bedeutung der Spectacula im kaiserlichen Rom
- 4. Die Berichte antiker Autoren über die Spectacula unter der Regierung der iulisch-claudischen Kaiser
- 4.1 Vorstellung der bei der Analyse verwendeten Quellen
- 4.1.1 Die Annalen des Publius Cornelius Tacitus
- 4.1.2 Die Kaiserviten des Gaius Suetonius Tranquillus
- 4.1.3 Die Römische Geschichte des Cassius Dio Cocceianus
- 4.2 Die Quellenanalyse
- 4.3 Die Instrumentalisierung der Spectacula unter den iulisch-claudischen Kaisern
- 5. Die Spectacula als politische und gesellschaftliche Machtmittel der iulisch-claudischen Kaiser
- 5.1 Die Spectacula als Beneficia
- 5.2 Die Spectacula als Kommunikationsmedien
- 5.3 Die Spectacula als Stützen des Prinzipats
- 6. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die politische und gesellschaftliche Bedeutung der römischen Schauspiele (Spectacula) im frühen Prinzipat, insbesondere unter den iulisch-claudischen Kaisern. Die Arbeit analysiert, inwieweit die Spectacula als Machtinstrumente eingesetzt wurden und welche Rolle sie im Kontext der Machtübernahme und -sicherung der Kaiser spielten.
- Die Entwicklung der Spectacula von der römischen Republik bis zum frühen Prinzipat.
- Die unterschiedlichen Interpretationen der Geschichtswissenschaft zur Bedeutung der Spectacula in der Kaiserzeit.
- Die Analyse antiker Quellen (Tacitus, Suetonius, Cassius Dio) zur Darstellung der Spectacula unter den iulisch-claudischen Kaisern.
- Die Funktion der Spectacula als Beneficia, Kommunikationsmedien und Stützen des Prinzipats.
- Die politische Instrumentalisierung der Spectacula durch die Kaiser.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Magisterarbeit ein und skizziert die Forschungsfrage nach der politischen und gesellschaftlichen Bedeutung der Spectacula im frühen Prinzipat. Sie beleuchtet die Rolle der Spectacula bei der Errichtung der caesarischen Diktatur, vergleicht diese mit dem augusteischen Prinzipat und umreißt den methodischen Ansatz der Arbeit. Der Bezug auf Ciceros Zweite Philippische Rede illustriert die bereits in der Antike vorhandene Debatte um die politische Instrumentalisierung der Spiele.
2. Die Entwicklung der Spectacula von ihren Anfängen bis zum Ende der Römischen Republik: Dieses Kapitel zeichnet die Entwicklung des römischen Spielwesens von der Königszeit bis zum Ende der Republik nach. Es analysiert die Veränderungen im Charakter und der Bedeutung der Spectacula in den verschiedenen Epochen und legt den Grundstein für das Verständnis der Veränderungen und Kontinuitäten unter der Kaiserzeit. Der Fokus liegt auf der Transformation der Spiele von eher religiösen und traditionellen Ereignissen hin zu politischen Instrumenten.
3. Bisherige Thesen der Geschichtswissenschaft zur Bedeutung der Spectacula in der Kaiserzeit: Das Kapitel präsentiert und diskutiert verschiedene etablierte Interpretationen der Rolle der Spectacula im Kontext der Kaiserzeit. Es werden insbesondere die Thesen von Jérôme Carcopino (Entpolitisierung der Plebs) und Ludwig Friedländer (Ersatz für die Volksversammlung) vorgestellt und kritisch bewertet. Dieser Abschnitt dient als Grundlage für die eigenständige Analyse der vorliegenden Arbeit.
4. Die Berichte antiker Autoren über die Spectacula unter der Regierung der iulisch-claudischen Kaiser: Dieses Kapitel stellt die wichtigsten Quellen für die Untersuchung dar – Tacitus, Suetonius und Cassius Dio – und analysiert deren Berichte über die Spectacula unter Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius und Nero. Es werden die jeweiligen Darstellungen verglichen und interpretiert, um ein umfassendes Bild der Veranstaltungen und ihrer politischen Konnotation zu gewinnen.
5. Die Spectacula als politische und gesellschaftliche Machtmittel der iulisch-claudischen Kaiser: Dieses Kapitel synthetisiert die Ergebnisse der Quellenanalyse und untersucht die verschiedenen Funktionen der Spectacula als politische und gesellschaftliche Machtmittel. Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Spiele als Beneficia (Wohltaten), Kommunikationsmedien und Stützen des Prinzipats und analysiert, wie die Kaiser die Spectacula gezielt zur Festigung ihrer Macht einsetzten.
Schlüsselwörter
Spectacula, iulisch-claudische Kaiser, Römisches Prinzipat, politische Instrumentalisierung, Plebs urbana, Beneficia, Kommunikationsmedien, Macht, Tacitus, Suetonius, Cassius Dio, Quellenanalyse, antike Geschichte.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Die politische und gesellschaftliche Bedeutung der Spectacula im frühen Prinzipat
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die politische und gesellschaftliche Bedeutung der römischen Schauspiele (Spectacula) im frühen Prinzipat, insbesondere unter den iulisch-claudischen Kaisern. Der Fokus liegt auf der Analyse, inwieweit die Spectacula als Machtinstrumente eingesetzt wurden und welche Rolle sie bei der Machtübernahme und -sicherung der Kaiser spielten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Spectacula von der römischen Republik bis zum frühen Prinzipat, verschiedene Interpretationen der Geschichtswissenschaft zu deren Bedeutung in der Kaiserzeit, eine Analyse antiker Quellen (Tacitus, Suetonius, Cassius Dio) zur Darstellung der Spectacula unter den iulisch-claudischen Kaisern, die Funktion der Spectacula als Beneficia, Kommunikationsmedien und Stützen des Prinzipats sowie die politische Instrumentalisierung der Spectacula durch die Kaiser.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich hauptsächlich auf die Berichte antiker Autoren, insbesondere die Annalen des Tacitus, die Kaiserviten des Suetonius und die Römische Geschichte des Cassius Dio. Diese Quellen werden analysiert, um ein umfassendes Bild der Spectacula und ihrer politischen Konnotation zu gewinnen.
Welche Thesen der Geschichtswissenschaft werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert und bewertet kritisch verschiedene etablierte Interpretationen zur Rolle der Spectacula in der Kaiserzeit. Im Mittelpunkt stehen die Thesen von Jérôme Carcopino (Entpolitisierung der Plebs) und Ludwig Friedländer (Ersatz für die Volksversammlung).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Entwicklung der Spectacula bis zum Ende der Republik, bisherige Thesen der Geschichtswissenschaft, Analyse antiker Quellen unter den iulisch-claudischen Kaisern, die Spectacula als politische und gesellschaftliche Machtmittel und schließlich Zusammenfassung und Ausblick.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit synthetisiert die Ergebnisse der Quellenanalyse und untersucht die verschiedenen Funktionen der Spectacula als politische und gesellschaftliche Machtmittel. Sie beleuchtet deren Rolle als Beneficia, Kommunikationsmedien und Stützen des Prinzipats und analysiert, wie die Kaiser die Spectacula gezielt zur Festigung ihrer Macht einsetzten. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Kapitel "Zusammenfassung und Ausblick" zu finden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Spectacula, iulisch-claudische Kaiser, Römisches Prinzipat, politische Instrumentalisierung, Plebs urbana, Beneficia, Kommunikationsmedien, Macht, Tacitus, Suetonius, Cassius Dio, Quellenanalyse, antike Geschichte.
- Quote paper
- M.A. Tabea Roth (Author), 2007, Die Spectacula. Machtinstrumente der iulisch-claudischen Kaiser? Politische und gesellschaftliche Bedeutung der römischen Schauspiele im Frühen Prinzipat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340042