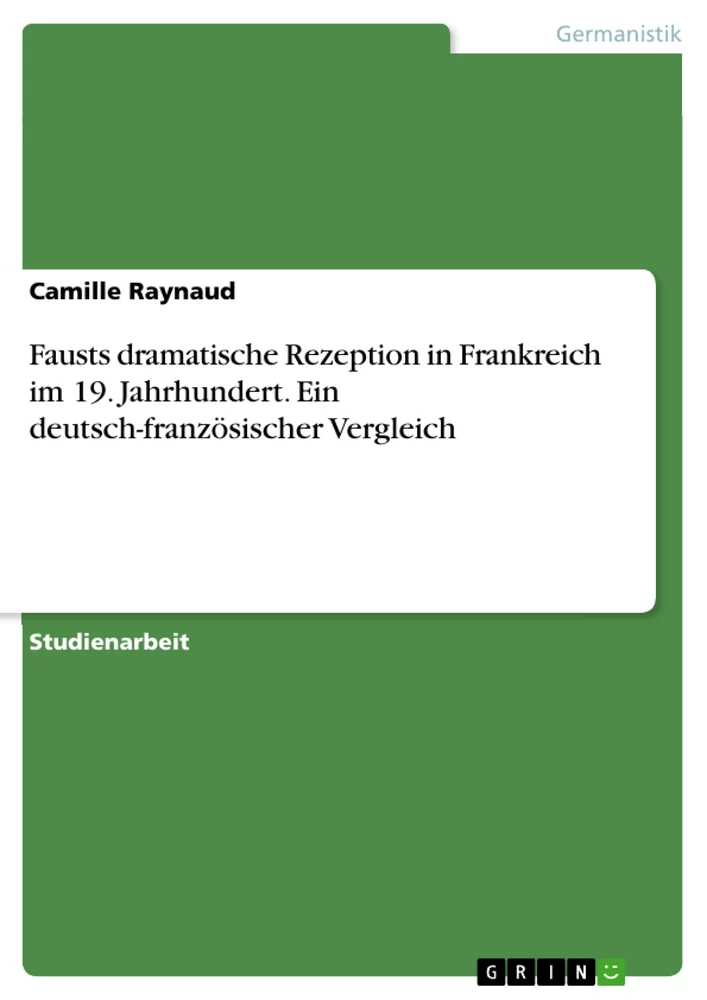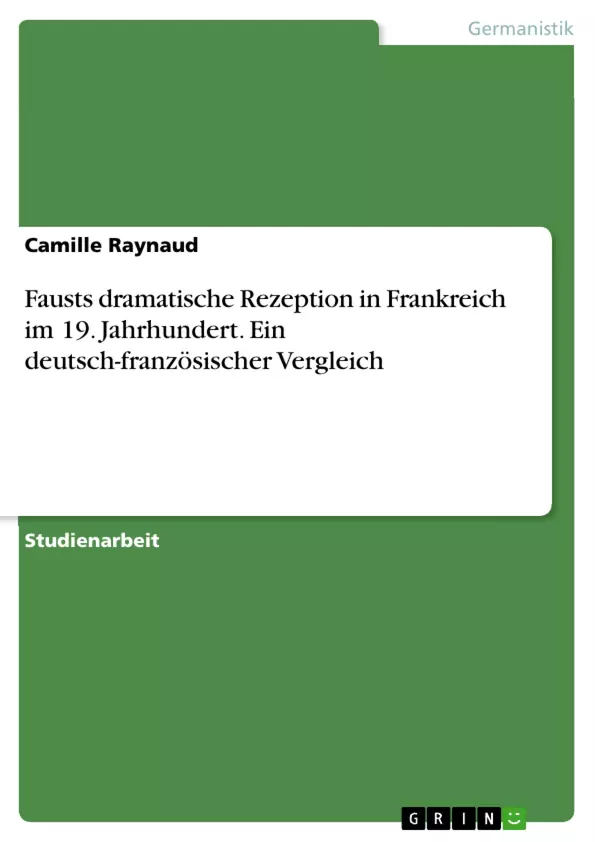Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Rezeption des weltbekannten Werks von Johann Wolfgang Goethe Faust in Frankreich im 19. Jahrhundert. Obwohl dieses Drama die Weltliteratur stark beeinflusst hat, fehlt eine Gesamtdarstellung der Faust Rezeption in Frankreich. In dieser Arbeit wird die dramatische Rezeption im Laufe des 19. Jahrhunderts untersucht um ihre Entwicklung zu deuten und es wird gleichzeitig ein Vergleich mit Deutschland gezogen.
Schon vor Goethe war in Frankreich der Faust Stoff durch Palmat-Cayets Übertragung des Volksbuchs Historia von D. Johann Fausten, doch der Erfolg, den es in Deutschland gab, blieb in Frankreich aus. Hier stellt sich die Frage, wieso die Franzosen das Werk anders wahrgenommen haben? Hier wird ein Überblick über die Geschichte beider Länder gezeigt, in der sich die Begeisterung des Werkes Faust wegen der politischen Spannungen völlig anders entwickelt hat.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die historischen und literaturgeschichtlichen Hintergründe der deutsch-französischen Beziehungen im 19. Jahrhundert
- III. Deutsch-französische produktive Aneignung von Goethes Faust in Frankreich
- IV. Die dramatische Rezeption Fausts in Frankreich
- V. Die musikalische Faust Rezeption
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Rezeption von Johann Wolfgang Goethes "Faust" in Frankreich während des 19. Jahrhunderts. Sie analysiert die Entwicklung der dramatischen Rezeption und zieht einen Vergleich mit der deutschen Rezeption. Die Arbeit soll ein besseres Verständnis für die Besonderheiten der französischen Auseinandersetzung mit dem Werk "Faust" vermitteln.
- Historische und literaturgeschichtliche Hintergründe der deutsch-französischen Beziehungen im 19. Jahrhundert
- Die produktive Aneignung von Goethes "Faust" in Frankreich
- Die dramatische Rezeption von "Faust" in Frankreich
- Die musikalische Rezeption von "Faust" in Frankreich
- Vergleichende Analyse der deutschen und französischen Rezeption
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz der Rezeption von Goethes "Faust" in Frankreich im 19. Jahrhundert dar und erläutert den Forschungsstand. Sie beleuchtet die Besonderheiten der französischen Rezeption im Vergleich zur deutschen und hebt die Notwendigkeit einer umfassenden Untersuchung hervor.
II. Die historischen und literaturgeschichtlichen Hintergründe der deutsch-französischen Beziehungen im 19. Jahrhundert
Dieses Kapitel analysiert die politischen und literarischen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich im 19. Jahrhundert und beleuchtet, wie diese die Rezeption von "Faust" beeinflusst haben. Es werden wichtige historische Ereignisse und literarische Strömungen beider Länder betrachtet, die die Entwicklung der Rezeption des Werkes prägten.
III. Deutsch-französische produktive Aneignung von Goethes Faust in Frankreich
In diesem Kapitel werden die verschiedenen Ansätze der französischen Dichter bei der Übersetzung und Interpretation von Goethes "Faust" analysiert. Es werden wichtige Figuren der französischen Literatur vorgestellt und deren Versuche, den Faust-Stoff in ihre eigene literarische Tradition zu integrieren, beleuchtet.
IV. Die dramatische Rezeption Fausts in Frankreich
Dieses Kapitel untersucht die Rezeption von "Faust" in Frankreich auf der Bühne. Es beleuchtet die verschiedenen Bühnenadaptionen des Dramas und analysiert, wie diese die französische Kultur und Gesellschaft im 19. Jahrhundert beeinflusst haben.
V. Die musikalische Faust Rezeption
Dieses Kapitel widmet sich der musikalischen Rezeption von "Faust" in Frankreich. Es analysiert die Entstehung von Opern, Liedern und Ballett-Szenarien, die auf dem Stoff des Dramas basieren, und zeigt, wie diese die Rezeption des Werkes auf einer anderen Ebene beeinflusst haben.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: "Faust", "Goethe", "Rezeption", "Frankreich", "19. Jahrhundert", "deutsch-französische Beziehungen", "Dramaturgie", "Musik", "Literatur", "Kultur", "Vergleich", "Entwicklung", "Aneignung". Die Arbeit beleuchtet die multidimensionale Rezeption des Werks "Faust" in Frankreich und untersucht die Verbindung von literarischen, musikalischen und kulturellen Aspekten.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde Goethes Faust im 19. Jahrhundert in Frankreich aufgenommen?
Die Rezeption war stark von den politischen Spannungen zwischen Deutschland und Frankreich geprägt, entwickelte sich aber zu einer produktiven Aneignung in Literatur und Musik.
Warum unterschied sich die französische Wahrnehmung von der deutschen?
Während Faust in Deutschland als Nationalepos galt, betrachteten französische Intellektuelle das Werk oft durch die Brille ihrer eigenen literarischen Traditionen und politischen Vorurteile.
Welche Rolle spielt die Musik bei der Faust-Rezeption in Frankreich?
Die musikalische Umsetzung (z.B. Opern und Ballett) war in Frankreich besonders erfolgreich und trug maßgeblich zur Popularisierung des Stoffes bei.
Wie gingen französische Übersetzer mit dem Werk um?
Übersetzer wie Gérard de Nerval versuchten, den Faust-Stoff nicht nur zu übertragen, sondern in die französische Romantik zu integrieren.
Was war der Einfluss der politischen Beziehungen auf die Literatur?
Kriege und Rivalitäten führten oft zu einer ambivalenten Haltung gegenüber deutscher Kultur, was die Interpretation von Faust mal bewundernd, mal distanziert ausfallen ließ.
- Quote paper
- Camille Raynaud (Author), 2015, Fausts dramatische Rezeption in Frankreich im 19. Jahrhundert. Ein deutsch-französischer Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340066