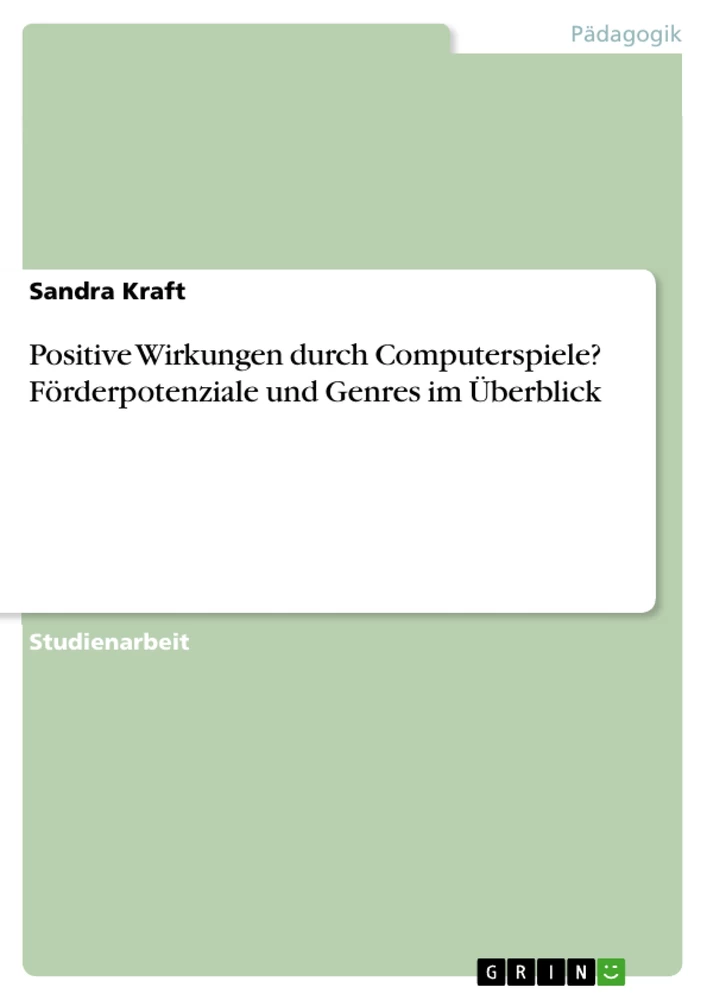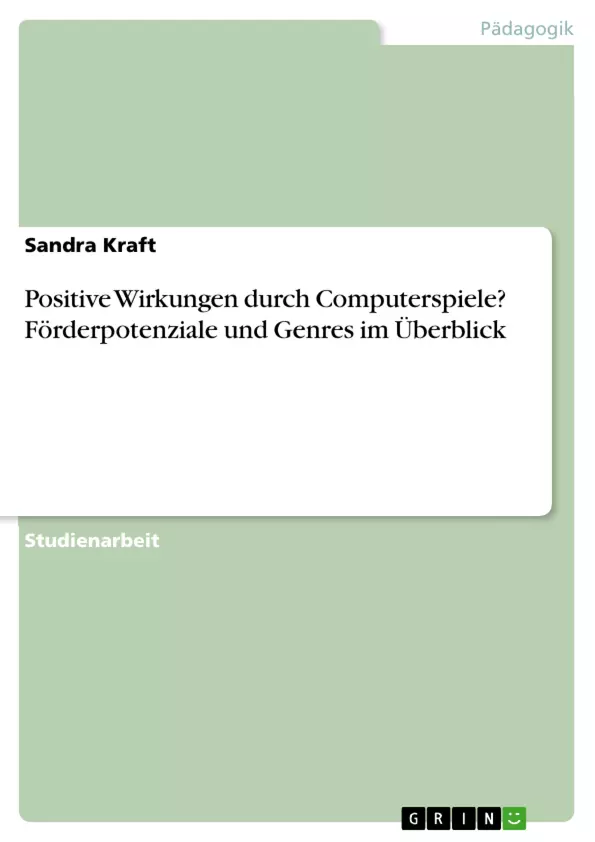Computerspiele tauchen in der Medienberichterstattung meist in negativen Zusammenhängen auf. Man liest von gewaltverherrlichenden Killerspielen, deren Konsum z.B. für die brutalen Taten von Amokläufern (mit)verantwortlich sein soll. Genauso wurde in den letzten Jahren vermehrt auf die äußerst bedenklichen Auswirkungen von übermäßigem Spielekonsum hingewiesen. Zwar tauchen auch differenziertere Berichte auf, das medial vermittelte Bild von Computerspielen wirkt aber dennoch größtenteils einseitig negativ behaftet.
Als HauptnutzerInnen dieses Mediums gelten vor allem Jugendliche und Heranwachsende. Augenscheinlich ist es ihr Medium. Das Medium, mit dem sie sich auskennen, wohingegen Eltern meist nur wenig bis gar keinen Kontakt in ihrem bisherigen Leben mit Spielen dieser Art hatten. Dies ist natürlich dadurch begründet, dass es ein recht neues Medium ist, z.B. im Gegensatz zu dem Fernsehen. Um überhaupt einschätzen zu können, was ComputerspielerInnen an dieser Art von Unterhaltung so fasziniert, wieso sie spielen, was da genau passiert, wie hoch ein mögliches Gefährdungs- oder Förderungspotenzial ist, bedarf es umfänglicher Informationsangebote. Natürlich für (besorgte) Eltern, aber auch für PädagogInnen und sonstige Interessierte. Diese Angebote dürfen aber nicht einseitig verzerrt sein, wie es o.g. Berichterstattungen häufig sind.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den Blick auf das Gebiet der Computerspiele auszuweiten, indem mögliche Förderpotenziale und positive Effekte durch deren Konsum betrachtet werden. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es hier nicht darum geht einen ähnlich einseitigen Standpunkt einzunehmen wie den von Computerspielgegnern. Gewaltverherrlichende Inhalte und exzessiver Spielkonsum u.Ä. sind ohne Frage ernst zu nehmende Problemfelder. Um Informationen für Interessierte im Sinne einer Aufklärungsarbeit bereit zu stellen oder eine ergiebige Diskussion führen zu können, muss aber auch der entgegengesetzte Pol beleuchtet werden, abseits von Extrembeispielen, also die möglichen positiven Wirkungen. Der normale Computerspieler und die Computerspielerin müssen in den Blick genommen werden. Um sich der Antwort auf die leitende Frage „Besitzen Computerspiele Potenziale, um positive Wirkungen zu entfalten?“ nähern zu können, erscheint es angebracht zunächst das Medium selbst und seine NutzerInnen näher zu betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Computerspiele allgemein
- ComputerspielerInnen
- Computerspiele und ihre (positiven) Wirkungen
- Positive Wirkungen
- Strukturelle Kopplung
- Erforderliche Kompetenzen
- Gefördert, was gefordert wird?!
- Positive Wirkungen beispielhaft dargestellt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die potenziellen positiven Effekte von Computerspielen auf den Nutzer. Im Gegensatz zur häufig negativen Berichterstattung über das Medium, die vor allem auf die Risiken von Gewaltverherrlichung und exzessivem Konsum fokussiert, soll hier ein umfassender Blick auf die Förderpotenziale von Computerspielen geworfen werden.
- Analyse verschiedener Genres von Computerspielen
- Beurteilung der Fähigkeiten und Kompetenzen, die durch das Spielen von Computerspielen gefördert werden können
- Erörterung der Bedeutung von struktureller Kopplung in Bezug auf Computerspiele
- Aufzeigen von Beispielen für positive Effekte von Computerspielen
- Erstellung eines ausgewogenen Gesamtbilds der Auswirkungen von Computerspielen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Problematik der einseitigen negativen Berichterstattung über Computerspiele dar und begründet die Notwendigkeit einer ausgewogeneren Betrachtungsweise. Es wird die Zielsetzung der Arbeit erläutert, die positive Wirkungen von Computerspielen zu beleuchten.
- Computerspiele allgemein: In diesem Kapitel wird der Begriff "Computerspiele" definiert und die vielfältige Bandbreite verschiedener Genres vorgestellt. Es werden klassische Adventures, Action Adventures, Shooter, Simulationen und Rollenspiele (RPGs) anhand ihrer Spielmechaniken und Ziele charakterisiert.
- ComputerspielerInnen: Das Kapitel beschäftigt sich mit den Nutzergruppen von Computerspielen, fokussiert insbesondere auf Jugendliche und Heranwachsende als Hauptkonsumenten. Es wird die Bedeutung von Computerspielen für diese Altersgruppe hervorgehoben und die Notwendigkeit umfassenderer Informationsangebote für Eltern und Pädagogen betont.
- Computerspiele und ihre (positiven) Wirkungen: Dieses Kapitel beleuchtet die positiven Wirkungen, die durch den Konsum von Computerspielen entstehen können. Es werden die Aspekte der strukturellen Kopplung, der Entwicklung von Kompetenzen und die Förderung von Fähigkeiten durch Computerspiele diskutiert. Beispiele für positive Effekte werden dargestellt.
Schlüsselwörter
Computerspiele, positive Effekte, Förderpotenziale, strukturelle Kopplung, Kompetenzen, Genres, Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), MMORPGs, Serious Games, Medienberichterstattung.
Häufig gestellte Fragen
Welche positiven Wirkungen können Computerspiele haben?
Computerspiele können kognitive Fähigkeiten, strategisches Denken, Teamfähigkeit und die Hand-Auge-Koordination fördern.
Was versteht man unter „struktureller Kopplung“ bei Computerspielen?
Dieser Begriff beschreibt die enge Wechselwirkung zwischen dem Spieler und dem Spielsystem, bei der Handlungen im Spiel Lernprozesse in der Realität anstoßen können.
Welche Genres werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit gibt einen Überblick über Adventures, Action-Adventures, Shooter, Simulationen und Rollenspiele (RPGs) sowie MMORPGs.
Was sind „Serious Games“?
Serious Games sind Spiele, die primär dazu entwickelt wurden, Informationen oder Bildungsinhalte zu vermitteln, statt nur der reinen Unterhaltung zu dienen.
Warum wird die Medienberichterstattung über Spiele kritisiert?
Die Arbeit kritisiert, dass Medien oft einseitig negativ über „Killerspiele“ berichten und dabei die vielfältigen Förderpotenziale des Mediums vernachlässigen.
Was bedeutet die Formel „Gefördert, was gefordert wird“?
Es bedeutet, dass Spieler genau jene Kompetenzen entwickeln, die notwendig sind, um die Herausforderungen innerhalb eines bestimmten Spielgenres erfolgreich zu meistern.
- Quote paper
- Sandra Kraft (Author), 2013, Positive Wirkungen durch Computerspiele? Förderpotenziale und Genres im Überblick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340176