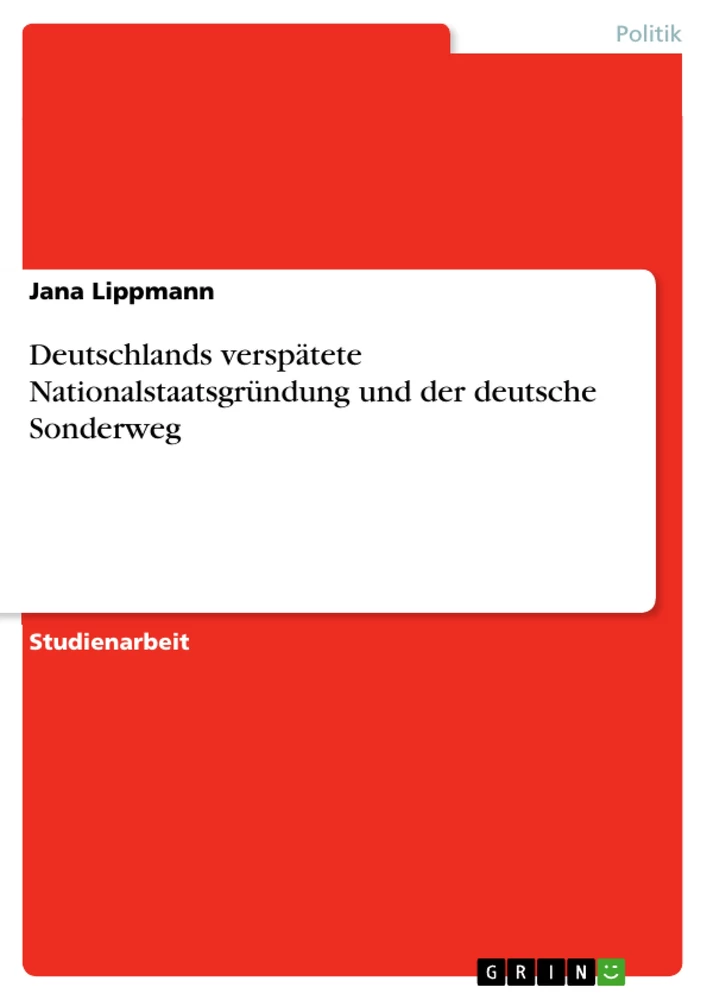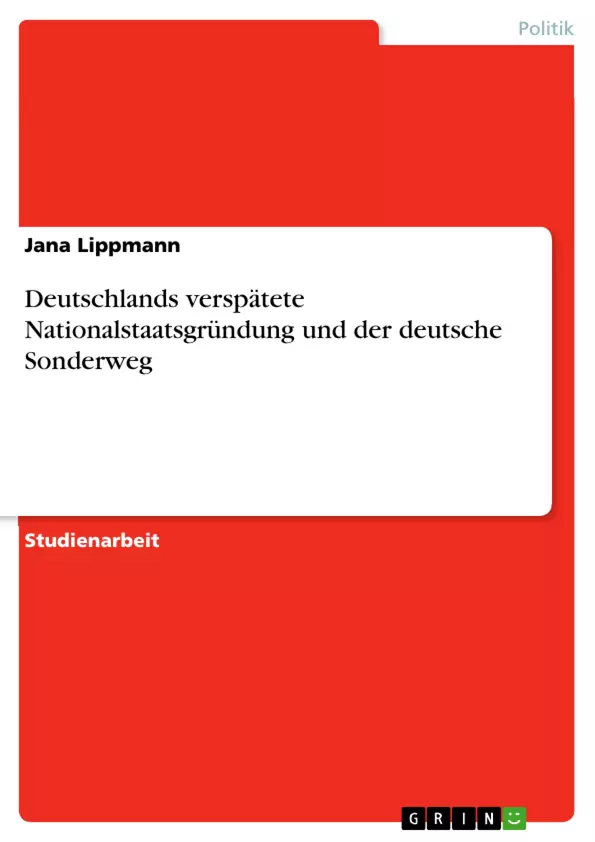Einleitung
Die Vorstellung von einer besonderen deutschen Entwicklung hat eine lange Tradition(1). Sie diente schon seit dem 19. Jahrhundert - mit wechselnden Inhalten - als Interpretationsschema deutscher Geschichte. Besonders in den Historikerdebatten der neuesten Zeit war sie häufig der Kritik ausgesetzt, sich weniger mit konkreten historischen Gegebenheiten als mit Deutungen solcher zu einem bestimmten politischen Ziel hin, zu beschäftigen.(2) Durch die
Jahrzehnte hinweg wurde diese These immer wieder aufgegriffen und ganze Wissenschaftlergenerationen beschäftigten sich mit der Ursachensuche für die deutsche Sonderentwicklung: die schwierige geopolitische Mittellage, das Ausbleiben einer bürgerlichen Revolution, der unvergleichbar starke Verwaltungsstaat, der relativ spät einsetzende, dann aber rasch erfolgende Industrialisier-ungsprozeß und am wichtigsten: die verspätete Nationalstaatsgründung - sind einige der in diesem Zusammenhang gebrauchten Schlagworte. Vorliegende Arbeit soll zunächst aufzeigen, wie sich die Vorstellung vom Deutschen Sonderweg herausbildete und welche spezifisch deutschen Bedingungen dabei als konstituierend angesehen werden.
[...]
_____
1 Vgl. dazu ausführlich: Vierhaus, Rudolf: „Die Ideologie des deutschen Weges der politischen und sozialen
Entwicklung“, In: Thadden, Rudolf von (Hrsg.):[...]
2 Vgl. dazu: Deutscher Sonderweg - Mythos oder Realität, Kolloquium des Instituts für Zeitgeschichte, München 1982.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Vorstellung vom Deutschen Sonderweg
- Deutsche Sonderbedingungen und europäische Gemeinsamkeiten
- Deutschland als verspätete Nation
- Schlußbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Vorstellung vom Deutschen Sonderweg und untersucht, wie sich diese Sichtweise herausbildete und welche spezifischen Bedingungen als konstituierend angesehen werden.
- Die Entwicklung der Vorstellung vom Deutschen Sonderweg
- Die Bedeutung von spezifischen deutschen Bedingungen
- Die These der „verspäteten Nation“
- Die Analyse von Deutschlands Nationalstaatsbildung im europäischen Kontext
- Die Frage nach der „Normalität“ im Vergleich zum Deutschen Sonderweg
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Thematik des Deutschen Sonderwegs vor und skizziert die wichtigsten Forschungsstränge zu diesem Thema.
- Die Vorstellung vom Deutschen Sonderweg: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung der Vorstellung vom Deutschen Sonderweg und analysiert die wichtigsten Argumente, die zur Annahme einer deutschen Sonderentwicklung führten.
- Deutsche Sonderbedingungen und europäische Gemeinsamkeiten: Hier werden die spezifischen deutschen Bedingungen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern untersucht, um die Frage nach der Besonderheit Deutschlands zu beleuchten.
- Deutschland als verspätete Nation: Dieses Kapitel widmet sich der These der „verspäteten Nation“ und hinterfragt die Deutung von Deutschlands Nationalstaatsbildung als „verspätet“ im europäischen Kontext.
Schlüsselwörter
Deutscher Sonderweg, Nationalstaatsgründung, Historikerdebatten, Historismus, Verspätete Nation, Sonderbedingungen, europäischer Vergleich, deutsche Geschichte, Leopold von Ranke.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem „Deutschen Sonderweg“?
Es ist die historische These, dass Deutschland eine von anderen westlichen Demokratien abweichende politische Entwicklung nahm, die schließlich im Nationalsozialismus mündete.
Warum wird Deutschland oft als „verspätete Nation“ bezeichnet?
Im Vergleich zu Ländern wie Frankreich oder England erfolgte die Gründung eines einheitlichen Nationalstaats in Deutschland erst relativ spät (1871) und „von oben“ durch Preußen.
Welche Faktoren begünstigten laut der These den Sonderweg?
Genannt werden oft das Ausbleiben einer erfolgreichen bürgerlichen Revolution (1848), der starke Einfluss des Adels und Militärs sowie die rasche, aber autoritär begleitete Industrialisierung.
Ist die Sonderweg-These heute noch aktuell?
In der modernen Geschichtswissenschaft wird sie kritisch hinterfragt. Viele Historiker betonen heute eher die Gemeinsamkeiten mit europäischen Nachbarn statt einer isolierten Fehlentwicklung.
Welche Rolle spielten die Historikerdebatten für dieses Thema?
Die Debatten (besonders ab den 1960ern) untersuchten, ob der Sonderweg ein Mythos oder eine historische Realität zur Erklärung der deutschen Katastrophe im 20. Jahrhundert war.
- Arbeit zitieren
- Jana Lippmann (Autor:in), 2001, Deutschlands verspätete Nationalstaatsgründung und der deutsche Sonderweg, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3404