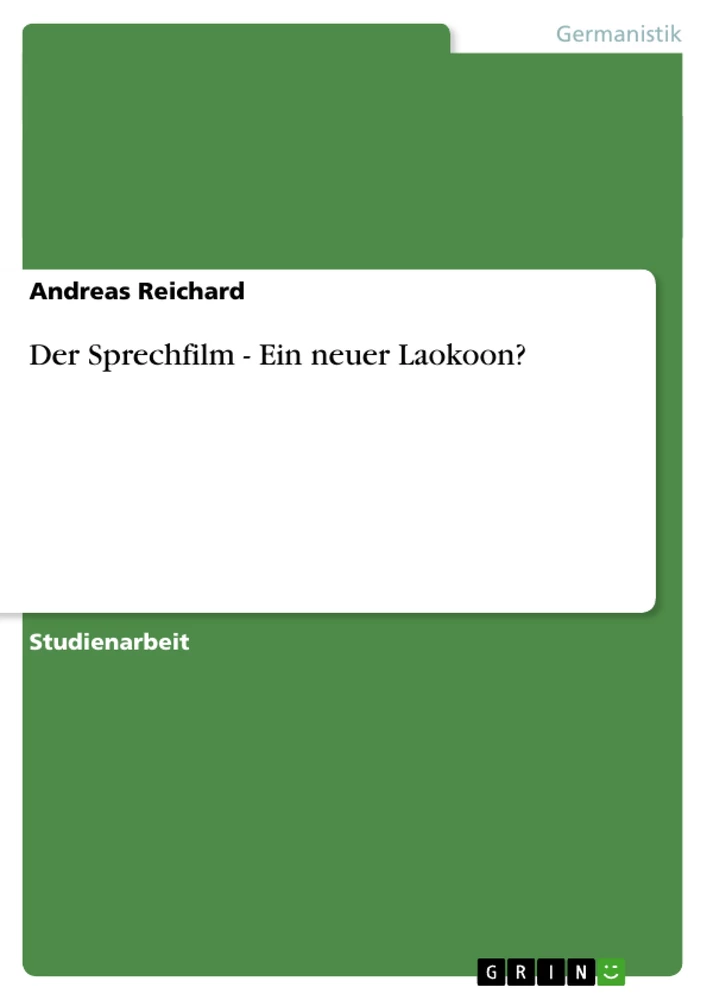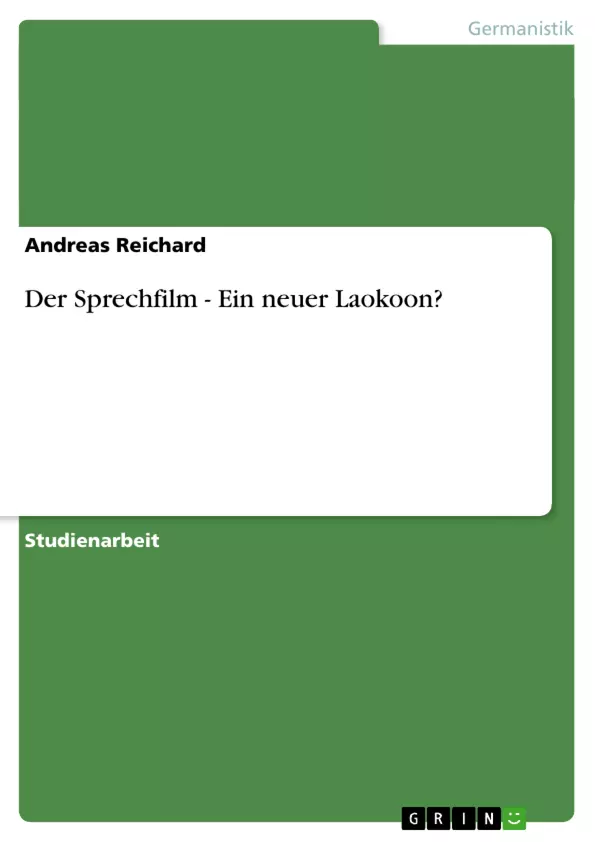Einleitung
Anlässlich vieler Diskussionen, was man unter Kino zu verstehen hat, das heiß t was wir unter wissenschaftlicher Betrachtungsweise des ‚Apparates’ Kino zu erwarten haben, nämlich die Multimedialität des „kinematographischen Spektakels“1, erscheint es angebracht, essentielle kunsttheoretische Betrachtungen des Dispositivs anhand des wohl am kinospezifischsten Mediums, des Filmes, einzubeziehen. Da wir es beim Film mit einer Reihe verschiedener Mittel (Bild, Sprache, Geräusche) zu tun haben – zumindest seit der Erfindung des Tonfilmes – nämlich mit einer „Verkopplung der künstlerische n Mittel“2 (eben Bild mit Ton/Sprache) – ist es von großer Bedeutung, eine der wohl wichtigsten Schriften des 18. Jahrhunderts (zumindest was die ästhetischen Diskussionen der damaligen Zeit angeht), Gotthold Ephraim Lessings ‚Laokoon’3, als eine Art Maßstab und Analyseverfahren zur Untersuchung heranzuziehen. Einen interessanten Ansatzpunkt zur kunsthistorischen oder kunsttheoretischen Untersuchung der filmischen Kunst bietet Rudolf Arnheims Aufsatz ‚Neuer Laokoon’, in dem er versucht, die wie oben schon genannte Kopplung von künstlerischen Mitteln anhand des Sprechfilms zu untersuchen.
Ziel dieser Arbeit soll es nun sein, anhand Lessings kunsttheoretischer Schrift ‚Laokoon’ und Arnheims Aufsatz ‚Neuer Laokoon’, die Eigenheiten der Kunst, im Speziellen des Bildes (oder der „Malerei“ wie Lessing sie bezeichnet4) und der Sprache als poetische Kunst (bei Lessing „Poesie“) aufzuzeigen und sie auf den Sprechfilm anzuwenden, so wie Arnheim es tut, um die Frage nach der Gültigkeit von Lessings Regeln für neuere Kunst (wie eben der Sprechfilm) zu prüfen und somit den künstlerischen Anspruch des Sprechfilmes zu klären: Entsteht durch die Realisierung des Sprechfilms und der damit verbundenen Kopplung der künstlerischen Mittel Bild und Sprache ein ‚neuer Laokoon’? Zunächst soll ein kurzer historischer Abriss Klarheit über die Figur des Laokoon bringen und Lessings Werk sowie Arnheims Aufsatz kurz vorgestellt werden. Danach sollen die Kernpunkte und die ästhetischen Auffassungen über Kunst geklärt, erläutert und in Bezug zum Sprechfilm gesetzt werden, um die Bedeutsamkeit von Lessings Werk zu klären.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lessings,Laokoon' vs. Arnheims, Neuer Laokoon'
- Laokoon – Priester im Schmerz
- Zu Lessings Werk, Laokoon'
- Zu Arnheims Aufsatz, Neuer Laokoon'
- Zum ästhetischen Programm – Kunstauffassungen
- Lessings Bestimmung von Poesie und Malerei
- Arnheims Kunstauffassung
- Zum Sprechfilm
- Der Sprechfilm als Kunst?
- Warum der Sprechfilm nach Arnheim kaum als Kunst zu gelten hat
- Lessings, Laokoon' – Ein Regelwerk mit Bestand?!
- Der Sprechfilm – Ein neuer Laokoon’?
- Lessings,Laokoon' durch den Film überholt?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob der Sprechfilm, durch die Kopplung von Bild und Sprache, als eine neue Form der Kunst angesehen werden kann, die sich möglicherweise nicht mehr durch die Regeln von Lessings "Laokoon" definieren lässt. Anhand des Werkes "Laokoon" von Gotthold Ephraim Lessing und dem Aufsatz "Neuer Laokoon" von Rudolf Arnheim, werden die ästhetischen Prinzipien des Bildes und der Sprache analysiert und auf den Sprechfilm angewendet. Ziel ist es, die Frage nach der Gültigkeit von Lessings Regeln für moderne Kunstformen zu klären und somit den künstlerischen Anspruch des Sprechfilms zu untersuchen.
- Die Bedeutung von Lessings "Laokoon" für die Kunsttheorie
- Die Unterscheidung zwischen Malerei und Poesie nach Lessing
- Die ästhetischen Prinzipien des Sprechfilms
- Die Gültigkeit von Lessings Regeln für den Sprechfilm
- Die künstlerische Eigenständigkeit des Sprechfilms
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas "Was ist Kino?" in Bezug auf den Sprechfilm dar und verdeutlicht die Bedeutung von Lessings "Laokoon" für die kunsthistorische Betrachtung. Es wird die zentrale Fragestellung der Arbeit vorgestellt: Entsteht durch die Kopplung von Bild und Sprache im Sprechfilm ein "neuer Laokoon"?
Kapitel 2.1 präsentiert einen kurzen Abriss über die Figur des Laokoon in der griechischen Mythologie und beleuchtet die Bedeutung der Laokoon-Plastik als Kunstwerk. Kapitel 2.2 stellt Lessings Werk "Laokoon" vor, das sich mit der Differenzierung von Poesie und Malerei auseinandersetzt. Kapitel 2.3 widmet sich Arnheims Aufsatz "Neuer Laokoon" und seiner Untersuchung der Kopplung künstlerischer Mittel am Beispiel des Sprechfilms.
Kapitel 3 befasst sich mit den ästhetischen Programmen von Lessing und Arnheim, indem es deren Kunstauffassungen und ihre jeweiligen Bestimmungen von Poesie und Malerei analysiert. Es wird die Frage aufgeworfen, inwieweit sich diese Konzepte auf den Sprechfilm übertragen lassen.
Kapitel 4 untersucht den Sprechfilm als Kunstform und beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, die sich aus der Kopplung von Bild und Sprache ergeben. Es wird die Frage gestellt, ob der Sprechfilm nach Arnheims Kriterien als Kunst zu gelten hat.
Kapitel 5 geht der Frage nach, ob Lessings Regeln für den Sprechfilm als eine neue Kunstform gültig sind. Es wird untersucht, ob die Kopplung von Bild und Sprache im Sprechfilm eine neue Ästhetik hervorbringt, die über Lessings "Laokoon" hinausgeht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen "Laokoon", "Sprechfilm", "Kunst", "Bild", "Sprache", "Ästhetik", "Malerei", "Poesie", "Kopplung", "Lessing", "Arnheim", "Vergil", "Winckelmann". Es werden die kunsttheoretischen Konzepte von Lessing und Arnheim beleuchtet und auf den Sprechfilm als eine moderne Kunstform angewendet.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die zentrale Fragestellung dieser Arbeit zum Sprechfilm?
Die Arbeit untersucht, ob durch die Kopplung von Bild und Sprache im Sprechfilm ein „neuer Laokoon“ entsteht und ob Lessings ästhetische Regeln noch für dieses Medium gelten.
Welche Rolle spielt Gotthold Ephraim Lessing in der Untersuchung?
Lessings Schrift „Laokoon“ dient als Maßstab für die Trennung der Künste (Malerei für den Raum, Poesie für die Zeit), was auf den Film übertragen wird.
Was kritisiert Rudolf Arnheim am Sprechfilm?
In seinem Aufsatz „Neuer Laokoon“ hinterfragt Arnheim den künstlerischen Anspruch des Sprechfilms, da die Kopplung verschiedener Mittel (Bild und Ton) die Reinheit der Kunstform gefährden könne.
Wie definiert Lessing den Unterschied zwischen Malerei und Poesie?
Malerei nutzt Farben und Formen im Raum und stellt Körper dar, während Poesie artikulierte Töne in der Zeit nutzt und Handlungen abbildet.
Ist der Sprechfilm nach modernen Maßstäben als Kunst anzusehen?
Die Arbeit prüft, ob die Verschmelzung von Bild und Sprache eine neue Ästhetik hervorbringt, die über die klassischen Regeln des 18. Jahrhunderts hinausgeht.
- Citar trabajo
- M.A. Andreas Reichard (Autor), 2001, Der Sprechfilm - Ein neuer Laokoon?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34041