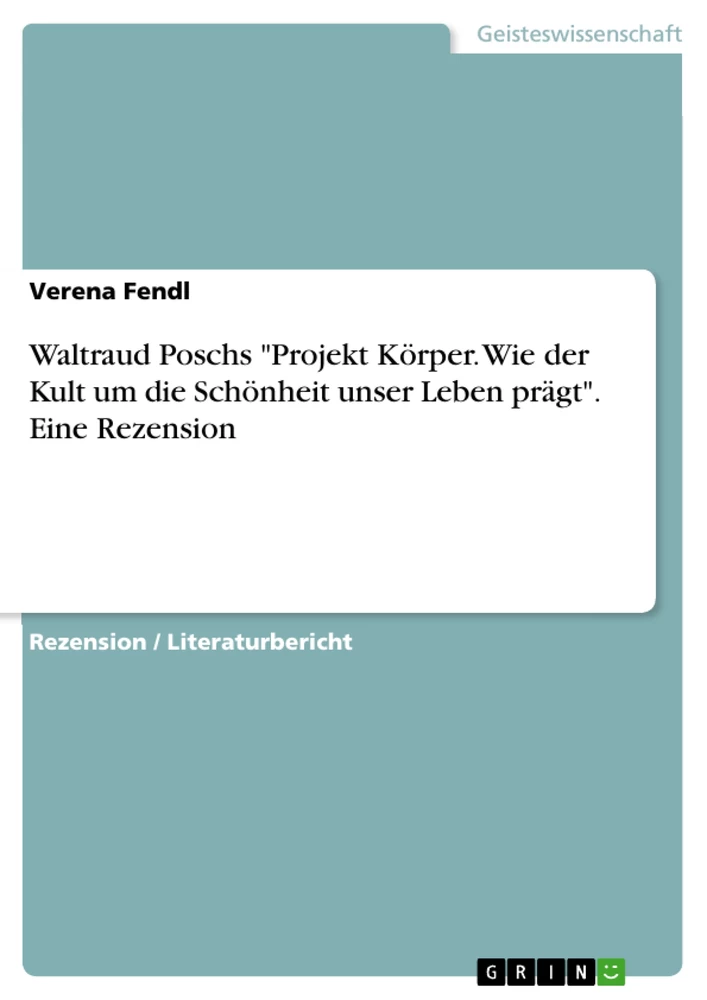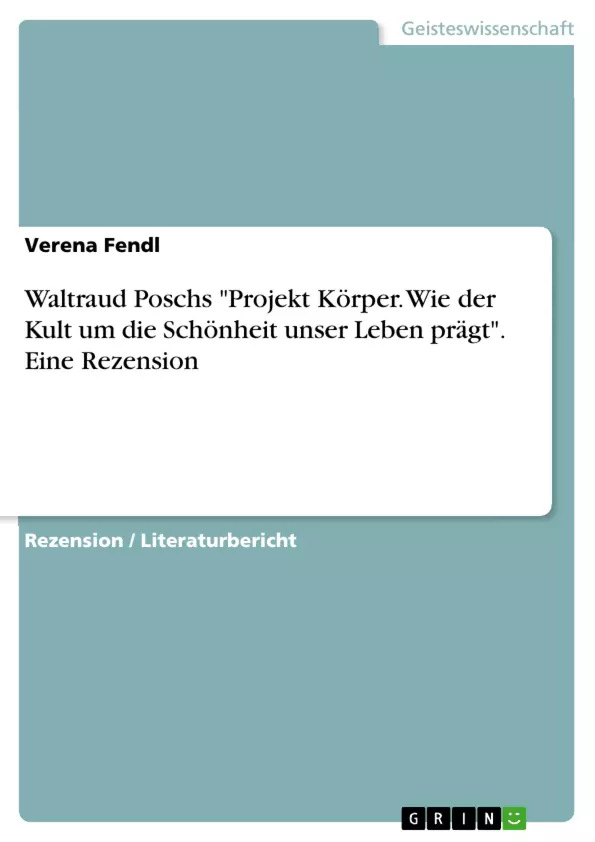In ihrer zweiten Monografie „Projekt Körper. Wie der Kult um die Schönheit unser Leben prägt“ zeigt die Autorin Waltraud Posch, dass die permanente Arbeit am eigenen Körper heute wichtiger ist denn je.
Die Arbeit am Köper mit dem Ziel seiner Optimierung wird von der Autorin als „Projekt“ bezeichnet, das für jeden von uns zur Pflicht geworden ist. Demzufolge handelt der moderne Mensch hinsichtlich seines Körpers gleich einem Unternehmer: Wie er sein Leben managt, so muss er auch seinen Körper managen. Dabei geht es bei dem geschönten Körper nicht um die Schönheit als solche, sondern darum, welche Bedeutungen einem idealen Körper in der modernen Gesellschaft zugeschrieben werden. Die Funktion von Schönheitshandlungen besteht demnach darin, uns eine Identität aufzubauen bzw. zu erhalten und uns sozial zu positionieren.
Inhaltsverzeichnis
- Soziologie der Schönheit
- Hochkonjunktur Schönheit
- Schönheit als widersprüchliches Alltagsphänomen
- Mode
- Schönheit als Mittel zum Zweck
- Das Ideal
- Schlankheit
- Jugendlichkeit
- Fitness
- Authentizität
- Warum uns das Schönheitsideal nicht egal ist
- Das Schönheitsideal als sichtbares Phänomen
- Das Schönheitsideal als einziges Ideal
- Herstellbarkeit von Schönheit
- Nutzen von Schönheit
- Zwischen Für und Wider
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
In ihrem Buch "Projekt Körper" analysiert Waltraud Posch die Bedeutung des Schönheitsideals in der modernen Gesellschaft. Ihr Ziel ist es, die permanente Arbeit am eigenen Körper als ein „Projekt“ zu verstehen, das für jeden von uns zur Pflicht geworden ist. Sie untersucht, wie der moderne Mensch seinen Körper als ein Kapital betrachtet, das es zu managen gilt, und wie Schönheitsideale in diesem Kontext eine zentrale Rolle spielen.
- Die Bedeutung des Schönheitsideals für die Konstruktion von Identität und sozialer Positionierung
- Die Rolle von Körpermanipulationen und Verschönerungen als Mittel der Selbstinszenierung
- Die Wechselwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft im Kontext des Schönheitsideals
- Die Auswirkungen des Schönheitsideals auf Körperbefindlichkeit und Selbstwahrnehmung
- Die Rolle von Medien und Experten/innen bei der Konstruktion und Verbreitung von Schönheitsidealen
Zusammenfassung der Kapitel
Soziologie der Schönheit
Dieses Kapitel untersucht die Funktionen von Verschönerungen und wie sie zur Konstruktion von Identität und zur sozialen Positionierung beitragen. Posch argumentiert, dass Schönheit in der modernen Gesellschaft zu einem „Mittel zum Zweck“ geworden ist, das der Individualisierung und der Freiheit dient. Sie zeigt, wie das Schönheitsideal als ein Instrument der sozialen Selektion fungiert und wie es mit neoliberalen Werten wie Selbstverantwortung und Leistungsbereitschaft verbunden ist.
Das Ideal
In diesem Kapitel werden die Kriterien des modernen Schönheitsideals anhand von Schlankheit, Jugendlichkeit, Fitness und Authentizität analysiert. Posch zeigt, wie diese Eigenschaften in der modernen Gesellschaft für hochstehende Werte wie Disziplin, Gesundheit und Dynamik stehen. Sie untersucht auch die Auswirkungen des Schönheitsideals auf die Körperbefindlichkeit und die Entstehung von gesellschaftlicher Unzufriedenheit.
Warum uns das Schönheitsideal nicht egal ist
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Gründen für die Macht des Schönheitsideals in der modernen Gesellschaft. Posch erklärt, wie die Anpassung an das Schönheitsideal durch die Verinnerlichung von Schönheitsstandards als freiwillige, individualisierte Unterordnung empfunden wird. Sie argumentiert, dass die Faktoren Freiheit und Selbstermächtigung bei der Interpretation von Verschönerungen eine große Rolle spielen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Konzepte des Buches "Projekt Körper" lassen sich mit den Schlüsselwörtern Körperlichkeit, Schönheitsideal, Individualisierung, Selbstinszenierung, soziale Positionierung, Körpermanipulation, Medien, neoliberale Logik und Selbstverantwortung zusammenfassen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Waltraud Posch unter dem Begriff "Projekt Körper"?
Sie beschreibt damit die permanente, pflichtbewusste Arbeit am eigenen Körper zur Selbstoptimierung. Der moderne Mensch managt seinen Körper wie ein Unternehmer sein Kapital.
Welche Rolle spielt Schönheit für die soziale Positionierung?
Ein idealer Körper dient heute als Ausweis für Disziplin, Dynamik und Leistungsbereitschaft. Schönheit fungiert somit als Mittel zur sozialen Selektion und zum Aufbau einer Identität.
Was sind die zentralen Kriterien des modernen Schönheitsideals?
Die Arbeit nennt vor allem Schlankheit, Jugendlichkeit, Fitness und Authentizität als die heute maßgeblichen Attribute eines "schönen" Körpers.
Warum empfinden wir die Anpassung an Schönheitsideale als "freiwillig"?
Durch die neoliberale Logik der Selbstverantwortung werden gesellschaftliche Standards verinnerlicht. Verschönerungen werden als Akt der Freiheit und Selbstermächtigung interpretiert, obwohl sie einem äußeren Druck folgen.
Welchen Einfluss haben Medien auf den "Kult um die Schönheit"?
Medien und Experten konstruieren und verbreiten die Ideale, die für die Entstehung gesellschaftlicher Unzufriedenheit und den Wunsch nach ständiger Körpermanipulation verantwortlich sind.
- Arbeit zitieren
- Magistra Artium Verena Fendl (Autor:in), 2011, Waltraud Poschs "Projekt Körper. Wie der Kult um die Schönheit unser Leben prägt". Eine Rezension, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340616