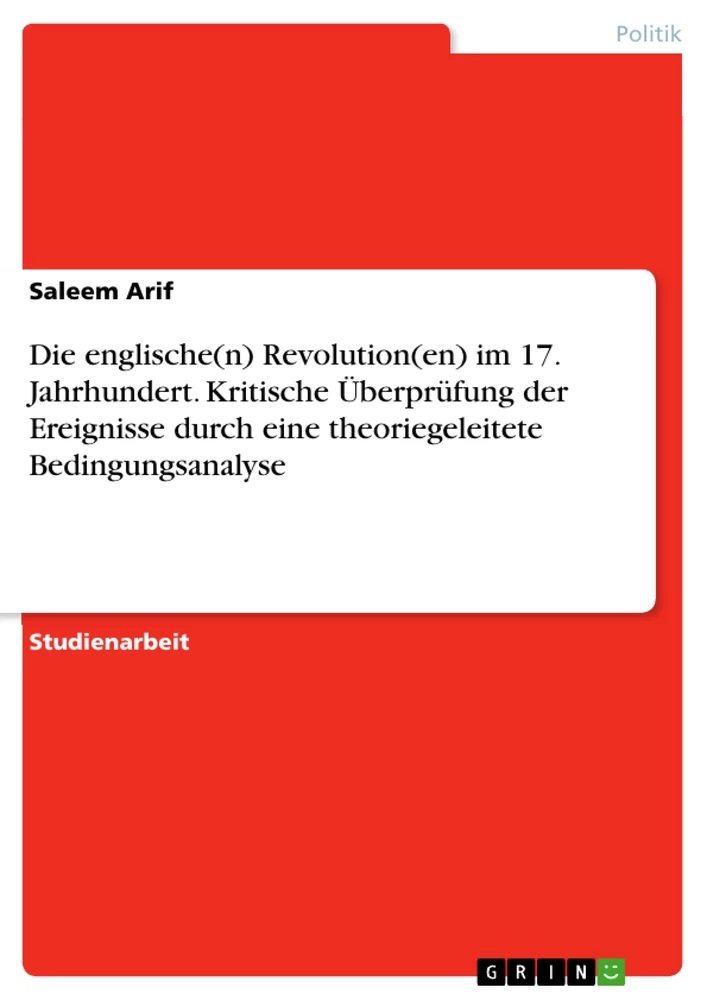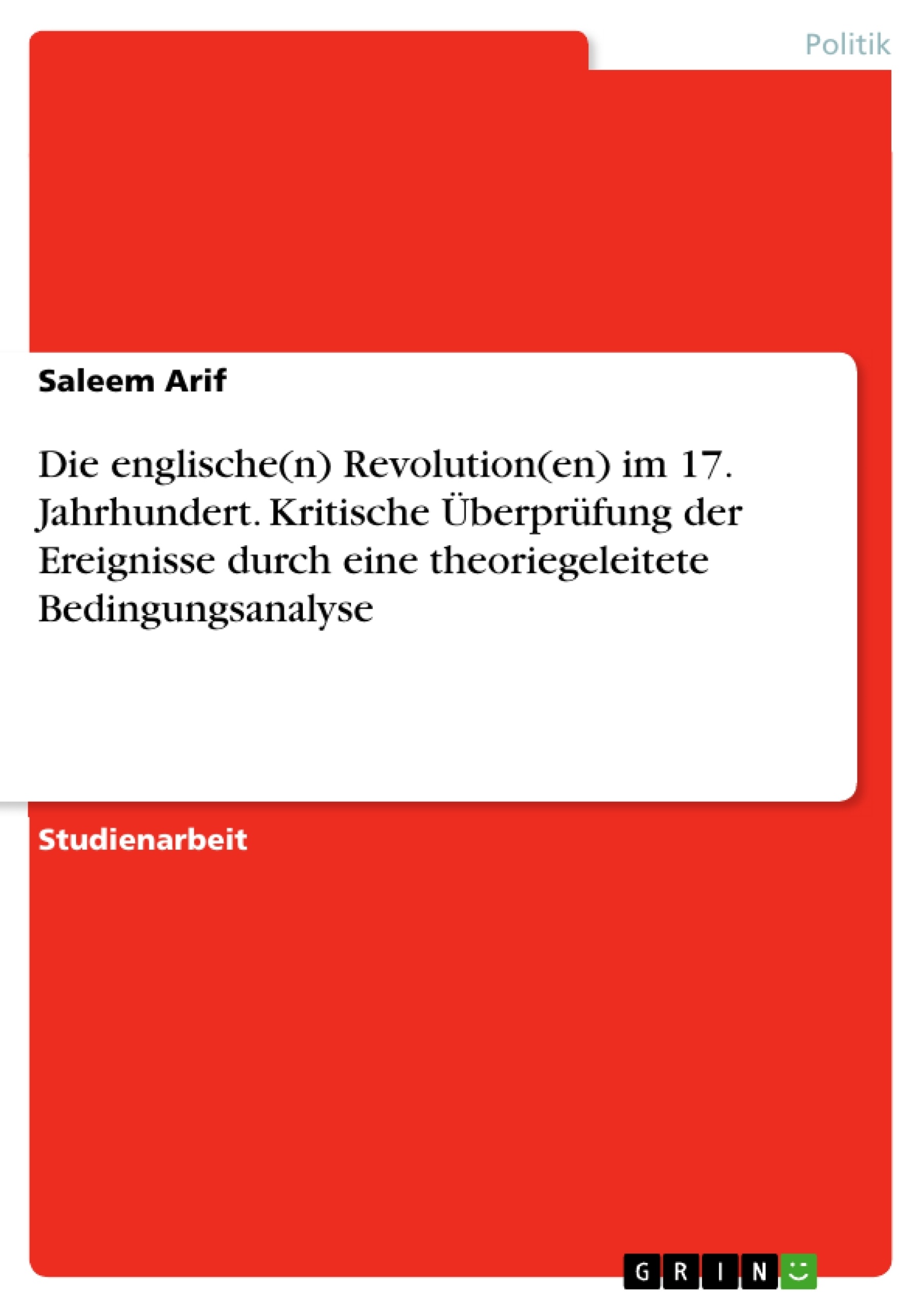Schon vor der französischen Revolution kam es im 17. Jahrhundert in England zu gravierenden politischen Umwälzungen. Wie selbstverständlich werden auch diese politischen Umbrüche als Revolution bezeichnet. Dabei ist sogar in der fachwissenschaftlichen Literatur eine klare und eindeutige Definition zu diesem laut Enzmann (2013: 206) sehr „facettenreichen Phänomen“ schwer zu finden.
Eine präzise Definition des Begriffs, ist jedoch essentiell wichtig zur Einordnung, Beurteilung und Analyse eines politischen Ereignisses. Oft bleibt nämlich unklar, ob es sich bei einem bestimmten politischen Ereignis tatsächlich um eine Revolution handelt oder ob zur Beschreibung dieses Ereignisses besser eines dem Begriff Revolution verwandtes Wort, wie etwa Aufstand, Rebellion, Staatsstreich, Reform, Protest, Widerstand, Invasion genutzt werden sollte. Auch aufgrund der fehlenden allgemein anerkannten Definition sind sich viele Autoren uneinig darüber, ob es sich bei den angesprochenen historisch bedeutenden politischen Umwälzungen, die den Begriff Revolution im Namen tragen, tatsächlich um Revolutionen handelt oder nicht.
Das Ziel dieser Arbeit ist daher eine kritische Überprüfung der Ereignisse vorzunehmen. Dafür werden im ersten Schritt zunächst die historisch-politischen Ereignisse beschrieben. Anschließend wird sich die Arbeit ausführlich mit der revolutionstheoretischen Einordnung des Begriffs Revolution beschäftigen. Es wird also zu klären sein, welche Bedingungen, Kriterien, Merkmale erfüllt sein müssen, um bei einem umwälzenden politischen Ereignis tatsächlich von Revolution sprechen zu können.
Aus verschiedenen Definitionen und revolutionstheoretischen Überlegungen aus der Fachliteratur werden nach dem Prinzip der größten Schnittmenge besonders häufig genannte Bedingungen und Kernmerkmale für eine Revolution hergeleitet und als hinreichende oder notwendige Bedingung gekennzeichnet. Im dritten Schritt wird dann die Bedingungsanalyse folgen. Diese wird dazu dienen die zuvor herausgearbeiteten Bedingungen mit den Ereignissen in England abzugleichen und zu prüfen, ob die Ereignisse die aus Sicht der modernen Revolutionsforschung an eine an eine Revolution gestellten Bedingungen erfüllen oder nicht. Hieraus kann dann abschließend geschlussfolgert werden, ob es vor diesem Hintergrund formal zutreffend oder unzutreffend ist die Ereignisse als Revolution zu kategorisieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Englands politische Umwälzungen im 17. Jahrhundert
- 2.1 Der erste große politische Umbruch (1629–1660): Die sog. puritanische Revolution
- 2.2 Der zweite große politische Umbruch (1688–1689): Die sog. glorreiche Revolution
- 3. Theoriesynthese: Begriffsdefinition und Herleitung der an eine Revolution gestellten Bedingungen aus der Revolutionsforschung
- 3.1 Ergebnis als übergeordnete Bedingungskategorie von Revolutionen
- 3.2 Akteure als übergeordnete Bedingungskategorie von Revolutionen
- 3.3 Mittel, Motivation, Organisation als übergeordnete Bedingungskategorie von Revolutionen
- 3.4 Prozesse und Ereignisse als übergeordnete Bedingungskategorie von Revolutionen
- 3.5 Zwischenfazit: Eigene Definition von Revolution
- 4. Bedingungsanalyse und Schlussfolgerungen
- 4.1 Bedingungsanalyse und Schlussfolgerungen zum ersten großen politischen Umbruch (1629–1660)
- 4.2 Bedingungsanalyse und Schlussfolgerungen zum zweiten großen politischen Umbruch (1688–1689)
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die englischen politischen Umwälzungen des 17. Jahrhunderts und hinterfragt deren Kategorisierung als Revolutionen. Ziel ist eine kritische Überprüfung der Ereignisse anhand einer theoriegeleiteten Bedingungsanalyse. Dazu werden zunächst die historischen Ereignisse beschrieben, anschließend der Revolutionsbegriff theoretisch eingeordnet und schließlich eine Bedingungsanalyse durchgeführt, um die Ereignisse anhand der Kriterien der modernen Revolutionsforschung zu bewerten.
- Definition des Begriffs "Revolution" und Herleitung relevanter Kriterien
- Beschreibung der politischen Umwälzungen in England im 17. Jahrhundert
- Analyse der englischen Ereignisse im Hinblick auf die zuvor definierten Revolutionskriterien
- Bewertung der Ereignisse als Revolutionen im Lichte der Analyse
- Diskussion der unterschiedlichen Interpretationen der englischen Ereignisse in der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung thematisiert die Problematik der Definition von "Revolution" und die Uneinigkeit in der Literatur darüber, ob die englischen Ereignisse des 17. Jahrhunderts als Revolutionen zu bezeichnen sind. Sie beschreibt das Ziel der Arbeit: eine kritische Überprüfung der Ereignisse mittels einer theoriegeleiteten Bedingungsanalyse, um zu klären, ob die an eine Revolution gestellten Bedingungen erfüllt wurden.
2. Englands politische Umwälzungen im 17. Jahrhundert: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die grundlegenden gesellschaftlichen und politischen Veränderungen in England im 17. Jahrhundert, die in zwei großen politischen Umbrüchen gipfelten. Es betont die Notwendigkeit einer wertneutralen Darstellung dieser Ereignisse, bevor die revolutionstheoretische Einordnung erfolgt.
3. Theoriesynthese: Begriffsdefinition und Herleitung der an eine Revolution gestellten Bedingungen aus der Revolutionsforschung: In diesem Kapitel wird der Begriff "Revolution" aus verschiedenen Definitionen und revolutionstheoretischen Überlegungen der Fachliteratur heraus analysiert. Es werden Bedingungen und Kernmerkmale für eine Revolution hergeleitet und als hinreichend oder notwendig gekennzeichnet, um eine Grundlage für die anschließende Bedingungsanalyse zu schaffen.
4. Bedingungsanalyse und Schlussfolgerungen: Dieses Kapitel vergleicht die im vorherigen Kapitel erarbeiteten Bedingungen mit den Ereignissen in England. Es prüft, ob die Ereignisse die an eine Revolution gestellten Bedingungen erfüllen, und zieht daraus Schlussfolgerungen über die formale Zutreffendheit der Kategorisierung der Ereignisse als Revolutionen.
Schlüsselwörter
Revolution, England, 17. Jahrhundert, Puritanische Revolution, Glorreiche Revolution, Revolutionsforschung, Bedingungsanalyse, Parlament, Monarchie, Volkssouveränität, Absolutismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Englands Politische Umwälzungen des 17. Jahrhunderts – Eine Bedingungsanalyse
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die englischen politischen Umwälzungen des 17. Jahrhunderts (die puritanische und die glorreiche Revolution) und analysiert kritisch, ob diese Ereignisse den Kriterien einer Revolution im Sinne der modernen Revolutionsforschung entsprechen.
Welche Methode wird angewendet?
Es wird eine theoriegeleitete Bedingungsanalyse durchgeführt. Zuerst werden die historischen Ereignisse beschrieben, dann der Revolutionsbegriff theoretisch eingeordnet und schließlich die Ereignisse anhand der erarbeiteten Kriterien bewertet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Beschreibung der englischen politischen Umwälzungen, Theoriesynthese zur Definition von Revolution und Herleitung relevanter Kriterien, Bedingungsanalyse und Schlussfolgerungen, sowie ein Fazit.
Wie wird der Begriff "Revolution" definiert?
Das Kapitel "Theoriesynthese" analysiert verschiedene Definitionen von "Revolution" aus der Fachliteratur. Daraus werden Bedingungen und Kernmerkmale für eine Revolution abgeleitet, die als notwendig oder hinreichend gekennzeichnet werden, um eine Grundlage für die Bedingungsanalyse zu schaffen.
Welche Ereignisse werden im Detail untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf zwei große politische Umbrüche in England: den ersten großen politischen Umbruch (1629-1660), auch bekannt als die puritanische Revolution, und den zweiten großen politischen Umbruch (1688-1689), die glorreiche Revolution.
Was ist das Ergebnis der Bedingungsanalyse?
Die Bedingungsanalyse vergleicht die im dritten Kapitel erarbeiteten Kriterien mit den Ereignissen in England. Sie prüft, ob die Ereignisse die an eine Revolution gestellten Bedingungen erfüllen und zieht daraus Schlussfolgerungen zur formalen Zutreffendheit der Kategorisierung als Revolutionen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Revolution, England, 17. Jahrhundert, Puritanische Revolution, Glorreiche Revolution, Revolutionsforschung, Bedingungsanalyse, Parlament, Monarchie, Volkssouveränität, Absolutismus.
Welches ist das Ziel der Arbeit?
Ziel ist eine kritische Überprüfung der englischen Ereignisse des 17. Jahrhunderts anhand einer theoriegeleiteten Bedingungsanalyse. Es soll geklärt werden, ob die an eine Revolution gestellten Bedingungen erfüllt wurden und ob die Ereignisse folglich als Revolutionen zu bezeichnen sind.
Wie werden die englischen Ereignisse im 17. Jahrhundert dargestellt?
Die Arbeit bietet einen Überblick über die grundlegenden gesellschaftlichen und politischen Veränderungen in England im 17. Jahrhundert. Es wird Wert auf eine wertneutrale Darstellung gelegt, bevor die revolutionstheoretische Einordnung erfolgt.
Welche unterschiedlichen Interpretationen der englischen Ereignisse werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die unterschiedlichen Interpretationen der englischen Ereignisse in der Literatur, insbesondere die Frage, ob die Ereignisse als Revolutionen zu klassifizieren sind. Die Arbeit liefert eine eigene fundierte Bewertung anhand der durchgeführten Bedingungsanalyse.
- Quote paper
- Saleem Arif (Author), 2016, Die englische(n) Revolution(en) im 17. Jahrhundert. Kritische Überprüfung der Ereignisse durch eine theoriegeleitete Bedingungsanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340628