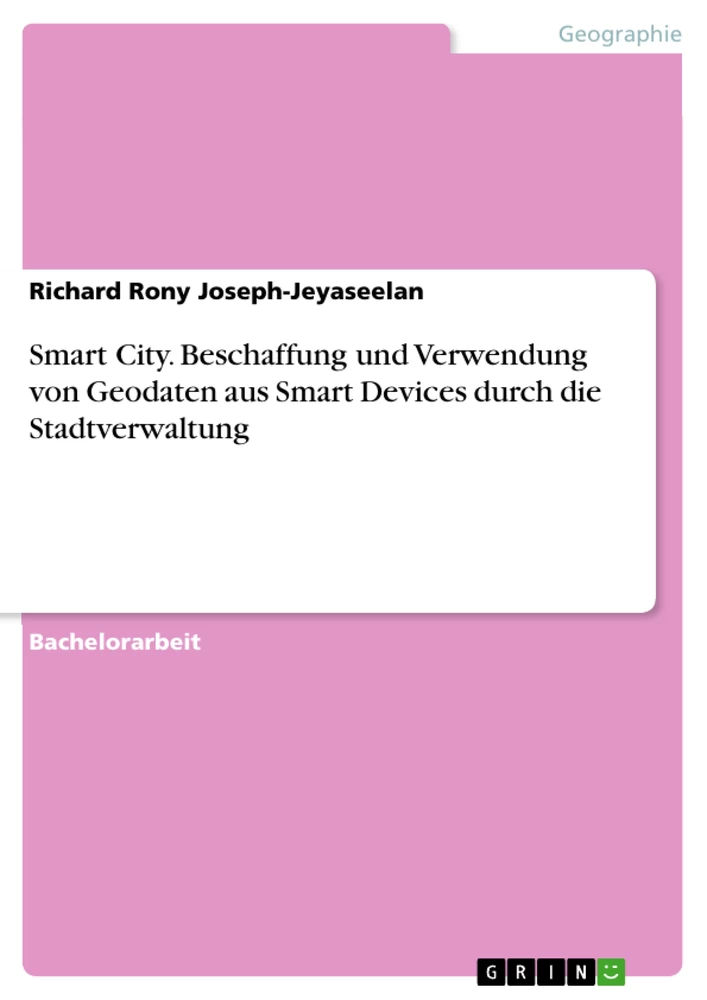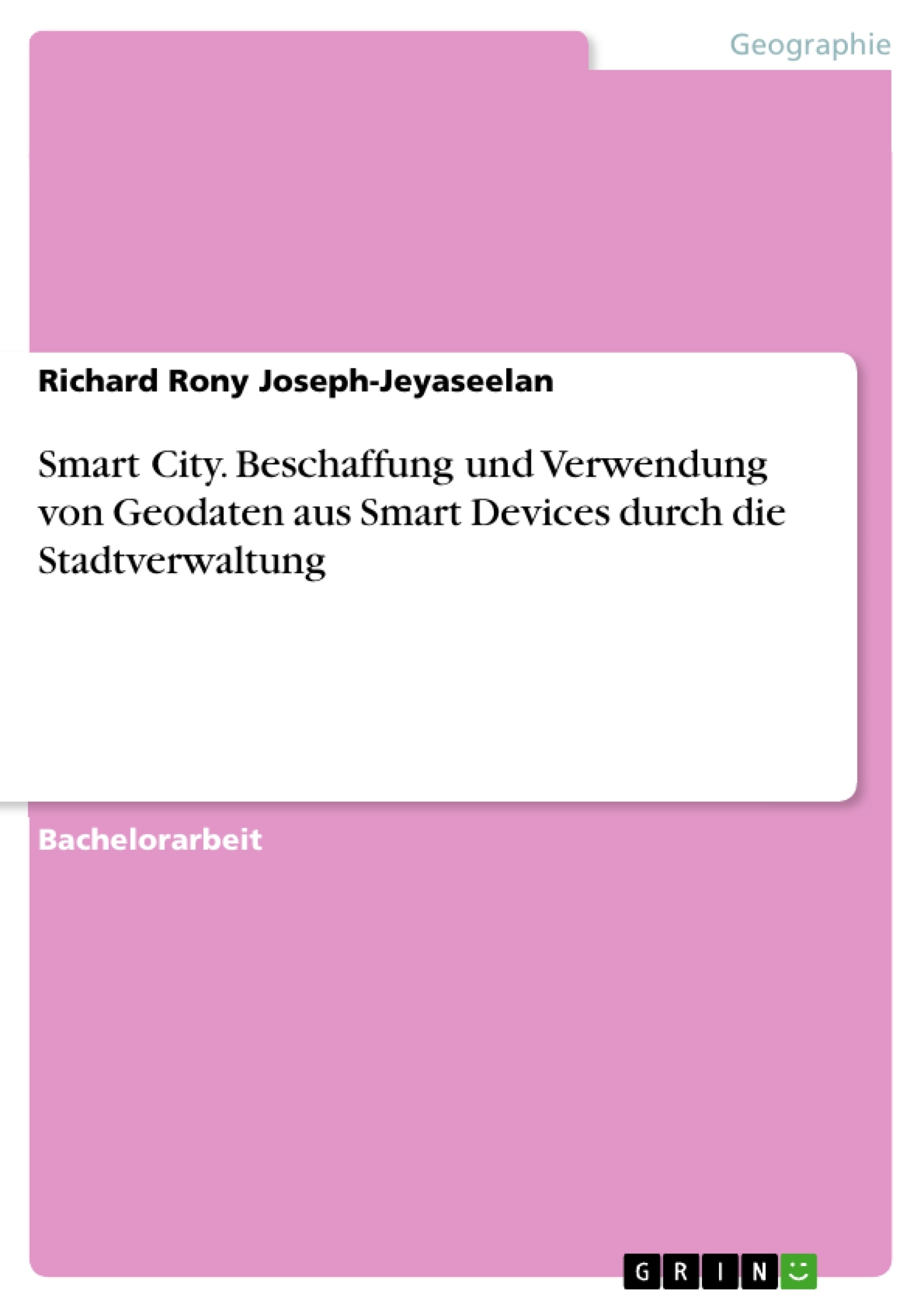In dieser Arbeit soll untersucht werden, ob und wie die Ämter einer Stadt Geodaten, die mittels Smart Devices generiert wurden, nutzen können, um damit das Smart City Konzept zu realisieren.
Dabei müssen zunächst die Beschaffungsmöglichkeiten und das Nutzungspotential der Geodaten genau untersucht werden, um damit schließlich die Umsetzung des Smart City Konzept unterstützen zu können. Es müssen somit innovative und intelligente Ideen und Möglichkeiten zur Beschaffung und Nutzung dieser Geodaten sowie zur Bereitstellung von Diensten für die Bürger überlegt werden. In besonderem Fokus stehen dabei mögliche Herausforderungen und Probleme, die eine Umsetzung dieser Ideen verhindern können. Es muss geklärt werden, ob und wie diese Probleme gelöst und die Herausforderungen überwunden werden können.
In den letzten Jahren hat sich die IT-Branche im Bereich der mobilen IT-Geräte stark revolutioniert. Die Anzahl der Smartphone-Nutzer steigt stetig an. Während im Januar 2009 lediglich 6,3 Millionen Menschen in Deutschland ein Smartphone besaßen, gab es im Februar 2015 in Deutschland bereits 45,6 Millionen Smartphone-Nutzer. Die Tendenz ist weiter steigend. Aber nicht nur die Anzahl der Smartphone- und Tablet-Nutzer steigt stetig an. Es wird prognostiziert, dass auch der Absatz von Wearables, wie zum Beispiel Smart Watches oder Fitnesstracker, stark ansteigen wird. Im Jahre 2014 wurden weltweit 26,4 Millionen Wearables gekauft. Dagegen soll 2019 die Anzahl der abgesetzten Wearables bereits 155,7 Millionen betragen. Diese mobilen IT-Geräte (Smart Devices) werden dabei von den Nutzern vielfältig sowohl im Alltag und in der Freizeit als auch bei der Arbeit eingesetzt. Bei der Nutzung dieser Geräte werden viele verschiedene Daten generiert. Ein großer Anteil daran bilden Geodaten.
Die Weltbevölkerung steigt stetig an und weltweit zeigt sich auch ein starker Trend zur Urbanisierung. Dadurch, dass die Anzahl der in Städten lebenden Menschen weltweit stark ansteigt entstehen auch viele Probleme, wie zum Beispiel Umweltverschmutzung, Klimawandel, demografischer Wandel und Ressourcenknappheit. Das Smart City Konzept beinhaltet viele Ansätze, um diese Probleme in den Städten zu bekämpfen. Deshalb wird in vielen Ländern dieses Konzept stark durch die Politik vorangetrieben. Kennzeichnend bei diesem Konzept ist, dass moderne Technologien verwendet werden, um diesen Problemen entgegen zu wirken.
Inhaltsverzeichnis
- Thematische Einführung
- Methodik
- Grundlagen
- Der Begriff Geodaten
- Smart Devices
- Der Begriff Smart City
- Unterscheidung von anderen Begriffen
- EU-Förderprogramme zu Smart City
- Bereiche des Smart City Konzepts
- Smart Mobility
- Smart Energy
- Smart Living
- Smart Environment
- Smart Governance
- Geodaten aus Smart Devices im Smart City Konzept
- Beschaffungsmöglichkeiten der Geodaten
- Geodatenerhebung mittels Auto
- Geodatenerhebung mittels Fahrrad
- Geodatenerhebung mittels Smart Meter und intelligenter Haushaltselektronik
- Personenbezogene Generierung von Geodaten unterschiedlicher Nutzungsaktivität im Bereich Gesundheit, Lifestyle und Kultur via Smartphone und Wearables
- Anwendungssoftware und zentrale Einheit
- Amtliche Nutzung und öffentliche Bereitstellung von Diensten aus den gewonnenen Geodaten
- Interne Nutzung durch die Ämter
- Nutzung der Geodaten im Bereich Smart Mobility
- Nutzung der Geodaten im Bereich Smart Energy
- Nutzung der Geodaten zur Verbesserung der Lebensqualität
- Öffentliche Bereitstellung über die Geoportale
- Applikations-Dienste für die Nutzer
- Dienste im Bereich Smart Mobility
- Dienste im Bereich Smart Home und Energy
- Dienste im Bereich Smart Living und Environment
- Dienste im Bereich Communication and Governance
- Interne Nutzung durch die Ämter
- Diskussion
- Beschaffungsmöglichkeiten der Geodaten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen der Nutzung von Geodaten aus Smart Devices zur Realisierung des Smart City Konzepts. Der Fokus liegt dabei auf der Beschaffung und Verwendung dieser Daten durch städtische Ämter und der Bereitstellung von Diensten für die Bürger.
- Beschaffungsmöglichkeiten von Geodaten aus Smart Devices
- Nutzungspotenzial von Geodaten im Smart City Kontext
- Herausforderungen und Probleme bei der Nutzung von Geodaten aus Smart Devices
- Entwicklung von innovativen Ideen und Möglichkeiten zur Beschaffung und Nutzung von Geodaten
- Bereitstellung von digitalen Diensten für die Bürger durch städtische Ämter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer thematischen Einführung, die den Kontext der steigenden Nutzung von Smart Devices und den wachsenden Herausforderungen in urbanen Räumen beleuchtet. Anschließend erläutert das zweite Kapitel die Methodik der Arbeit, die auf Literaturrecherche und Eigenüberlegungen basiert.
Im dritten Kapitel werden verschiedene Grundlagen des Themas behandelt, darunter der Begriff Geodaten, Smart Devices und das Smart City Konzept. Hier wird auch auf die verschiedenen Bereiche des Smart City Konzepts wie Smart Mobility, Smart Energy und Smart Living eingegangen.
Das vierte Kapitel stellt den Kern der Arbeit dar und beschäftigt sich mit der Beschaffung und Nutzung von Geodaten aus Smart Devices im Smart City Konzept. Es werden verschiedene Beschaffungsmöglichkeiten, Anwendungssoftware und die amtliche Nutzung der Daten durch städtische Ämter sowie die öffentliche Bereitstellung von Diensten für die Bürger erörtert.
Schlüsselwörter
Smart City, Geodaten, Smart Devices, Beschaffung, Nutzung, Amtliche Nutzung, Öffentliche Bereitstellung, Dienste, Smart Mobility, Smart Energy, Smart Living, Smart Environment, Smart Governance, Herausforderungen, Probleme, Lösungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel dieser Untersuchung?
Die Arbeit untersucht, wie städtische Ämter Geodaten von Smart Devices (wie Smartphones und Wearables) nutzen können, um das Smart City Konzept umzusetzen und innovative Dienste für Bürger bereitzustellen.
Welche Geräte werden als Smart Devices definiert?
Zu den Smart Devices zählen insbesondere Smartphones, Tablets sowie Wearables wie Smart Watches und Fitnesstracker, die im Alltag kontinuierlich Geodaten generieren.
Welche Bereiche umfasst das Smart City Konzept in dieser Arbeit?
Das Konzept gliedert sich in die Bereiche Smart Mobility, Smart Energy, Smart Living, Smart Environment und Smart Governance.
Wie können Geodaten im städtischen Kontext beschafft werden?
Geodaten können über Autos, Fahrräder, Smart Meter (intelligente Zähler) sowie über gesundheits- und lifestylerelevante Apps auf Smartphones und Wearables erhoben werden.
Welche Herausforderungen bestehen bei der Nutzung dieser Daten?
Im Fokus stehen technische Hürden, organisatorische Probleme in der Stadtverwaltung sowie die Notwendigkeit, Lösungen für den Datenschutz und die effektive Bereitstellung der Dienste zu finden.
Warum ist die Nutzung von Geodaten für moderne Städte so wichtig?
Angesichts der steigenden Urbanisierung helfen Geodaten dabei, Probleme wie Umweltverschmutzung, Ressourcenknappheit und den demografischen Wandel durch intelligente Technologien zu bekämpfen.
- Citar trabajo
- Richard Rony Joseph-Jeyaseelan (Autor), 2015, Smart City. Beschaffung und Verwendung von Geodaten aus Smart Devices durch die Stadtverwaltung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340668