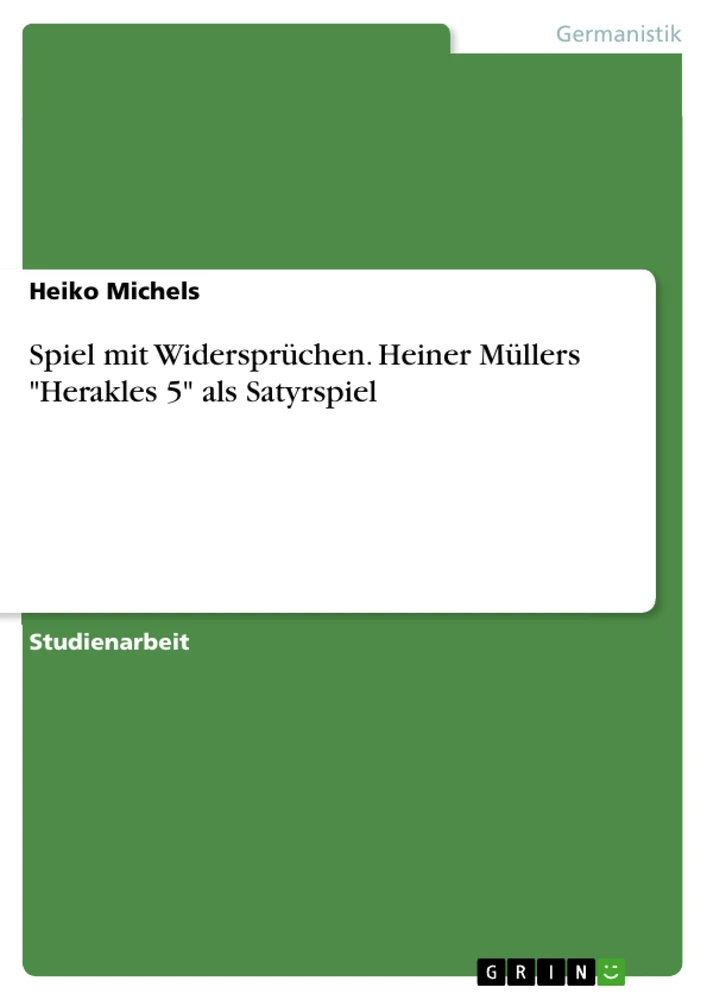Heiner Müllers Herakles 5 ist 1964/65 entstanden, in Anschluß an Philoktet (1964) und kurz vor seiner Ödipus-Bearbeitung Ödipus Tyrann (1965/66). Müller bezeichnet Herakles 5 als ein Satyrspiel zu Philoktet. Aus dieser Gattungszuweisung läßt sich einiges über den Deutungshorizont des Stückes erschließen, und ich möchte aus dieser Perspektive eine Lesart des Stückes vornehmen. Somit soll zunächst die Gattung „Satyrspiel“ in ihrem Spannungsverhältnis zwischen Komödie und Tragödie betrachtet werden. Daraufhin folgt eine Lektüre von Herakles 5, die sich an dem Umgang mit Widersprüchen orientiert. Abschließend soll diese im Kontext der Satyrspielbezeichnung gedeutet werden, um zu erschließen, wie Müller diese Gattung verwendet, bzw. warum Müller das Stück als ein solches bezeichnet.
Ich denke, daß man eine andere Lesart gegen die meine verteidigen kann. Es geht mir hier nicht um das Widerlegen anderer Deutungsansätze. Vielmehr soll der Text, angeregt durch die Bezeichnung „Satyrspiel“, aus einer bestimmten Perspektive betrachtet werden, so wie auch das Satyrspiel Elemente des Tragischen aus anderen Perspektiven darstellt. Dieses scheint mir, gerade für Müllers Texte, legitim und konsequent; Müller verwies selbst immer auf die Vieldeutigkeit seiner Texte und nahm über die Jahre immer wieder Umdeutungen seiner eigenen Texte vor. Das Beharren auf der einen Deutung wäre für Müller, der die Erfahrung einer „Unvereinbarkeit von Schreiben und Lesen“ beschrieb und eine „Austreibung des Lesers aus dem Text“ erdachte, unsinnig.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Das Satyrspiel
- Widersprüche in Herakles 5
- Spiel mit den Widersprüchen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Heiner Müllers „Herakles 5“ als Satyrspiel im Kontext der antiken Theatertradition. Sie zielt darauf ab, die Besonderheiten des Satyrspiels in seiner ambivalenten Beziehung zu Komödie und Tragödie zu beleuchten und diese Erkenntnisse auf Müllers Werk anzuwenden.
- Die Gattung des Satyrspiels in der attischen Theaterkultur
- Der Umgang mit Widersprüchen in „Herakles 5“
- Die Bedeutung des Satyrspiels als Gattungsbezeichnung für Müllers Werk
- Die wirkungsästhetische Funktion des Satyrspiels in der Rezeption von „Herakles 5“
- Der Vergleich von „Herakles 5“ mit anderen Werken Heiner Müllers
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkung
Diese Einleitung stellt Heiner Müllers „Herakles 5“ als Satyrspiel im Kontext seiner anderen Dramen vor. Der Autor erläutert seinen Ansatz, das Stück aus der Perspektive des Satyrspiels zu interpretieren, und betont die Vieldeutigkeit von Müllers Texten.
Das Satyrspiel
Dieser Abschnitt beleuchtet die Gattung des Satyrspiels im Vergleich zu Tragödie und Komödie in der attischen Theaterkultur. Er geht auf die Bedeutung des performativen Spiels, die kultische Bindung und die thematische Verbindung zur Tragödie ein. Der Abschnitt behandelt außerdem die Spezifika des Satyrspiel-Chores und seine Funktion im Theater.
Widersprüche in Herakles 5
Dieser Abschnitt untersucht die Widersprüche in „Herakles 5“ und erörtert, wie diese im Kontext des Satyrspiels interpretiert werden können. Er stellt die Argumentation von Wolfgang Emmerich dar, der das Satyrspiel mit der Komödie gleichsetzt und eine Auflösung der tragischen Widersprüche durch das Komische sieht. Der Autor argumentiert dagegen, dass Müllers Verwendung des Satyrspiels eine komplexere Beziehung zum Tragischen impliziert.
Spiel mit den Widersprüchen
In diesem Abschnitt wird der Umgang mit den „tragischen Widersprüchen“ in „Herakles 5“ näher betrachtet. Der Autor diskutiert, welche Aspekte des attischen Satyrspiels für Müllers Verständnis relevant sind, und geht auf die Unterschiede zwischen dem Satyrspiel und der modernen Rezeption des Stücks ein.
Schlüsselwörter
Heiner Müller, Satyrspiel, Herakles 5, Antikenrezeption, Tragödie, Komödie, Widerspruch, Performativität, Wirkungsästhetik, Theatergeschichte, Gattungsbezeichnung, Intermedium, Kontrafaktur.
Häufig gestellte Fragen zu Heiner Müllers "Herakles 5"
Warum bezeichnet Heiner Müller "Herakles 5" als Satyrspiel?
Müller nutzt die antike Gattung des Satyrspiels als komisches, aber widersprüchliches Gegenstück zu seinem tragischen Werk "Philoktet".
Was kennzeichnet die Gattung des antiken Satyrspiels?
Es steht im Spannungsverhältnis zwischen Komödie und Tragödie und dient oft dazu, tragische Stoffe aus einer anderen, grotesken Perspektive zu zeigen.
Wie geht Müller mit Widersprüchen im Stück um?
Die Arbeit zeigt, dass Müller Widersprüche nicht auflöst, sondern sie spielerisch inszeniert, um die Vieldeutigkeit des Textes zu wahren.
Ist "Herakles 5" als Komödie zu verstehen?
Während einige Forscher es als Komödie sehen, argumentiert die Arbeit für eine komplexere Lesart, die das Tragische nicht einfach durch das Komische ersetzt.
Welchen Stellenwert hat die Antikenrezeption bei Heiner Müller?
Müller nutzt antike Mythen und Gattungen, um zeitgenössische politische und gesellschaftliche Konflikte in einer universellen Form darzustellen.
- Arbeit zitieren
- Magister Heiko Michels (Autor:in), 2004, Spiel mit Widersprüchen. Heiner Müllers "Herakles 5" als Satyrspiel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340753