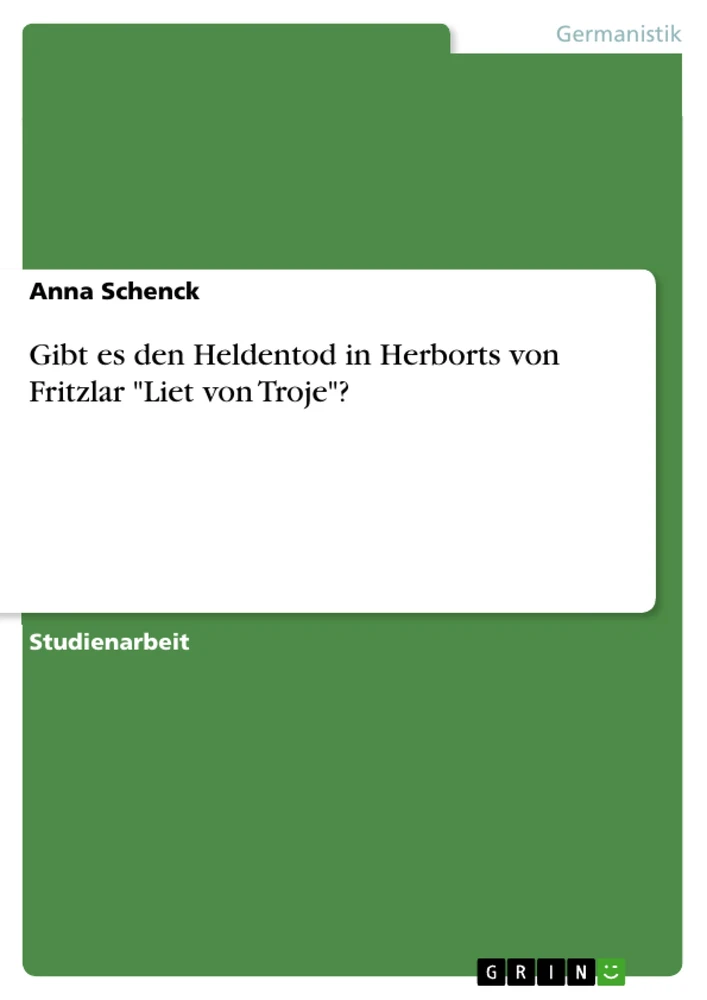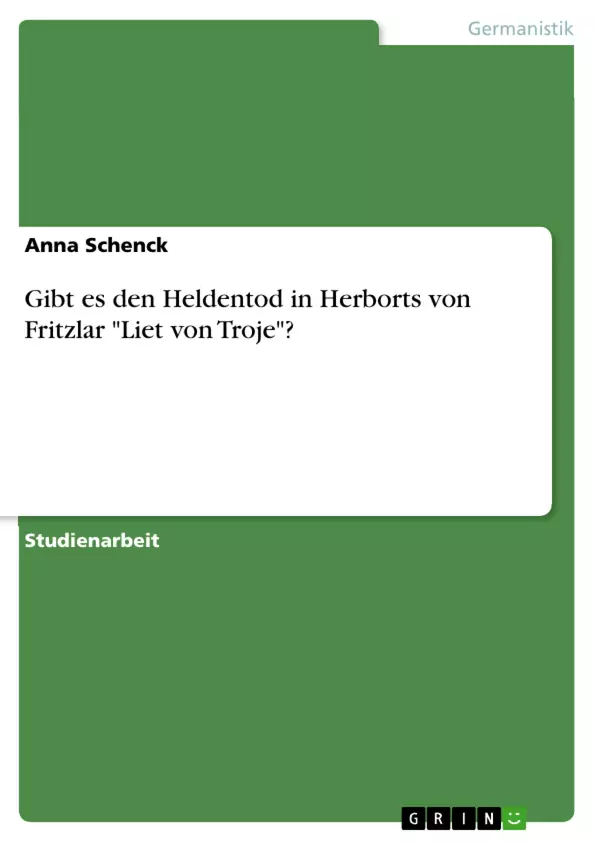Herborts von Fritzlar um 1190 entstandener Antikenroman das „Liet von Troye“ ist eine Wiedererzählung des trojanischen Kriegs. Durch eine Neukonzeptionalisierung der antiken Stoffe dringen die Leitthemen des höfischen Romans in die Antikenmaterie ein. Dazu zählen in erster Linie Ritterschaft und Minne2, außerdem unterläuft der Stoff einer Christianisierung. Hieraus ergeben sich einige Leitfragen, die von der Forschung ausführlich besprochen wurden, woraus die häufig vertretene These entstand, dass es sich beim „Liet von Troje“ um ein Antikriegsepos handelt. Dies als Grundlage annehmend, beschäftigt sich diese Arbeit mit der Thematik des Heldentodes. Ist die Glorifizierung des Helden durch seinen Tod auf dem Schlachtfeld in einem Antikriegsepos überhaupt möglich?
Einen Heldentod zu sterben, ist für den Helden von immenser Bedeutung: „Der letzte Akt in der Lebensgeschichte des Helden ist der Tod oder der Fortgang. Darin findet der ganze Sinn seines Lebens sein Denkmal.“ Der klassisch antike Heldentod unterliegt bestimmten Bedingungen, wozu die sogenannte Versöhnung mit dem Grab zählt. RENEHAN zufolge konfrontiert in heroischen Kulturen der Held seinen Tod mit der Würde seiner angeborenen Tapferkeit, ohne Angst und ungeschlagen bis zum Ende. In der Gewissheit des Todes eines jeden Menschen verspricht der öffentliche Tod in der Schlacht ewigen Ruhm: „the hero is granted [...] the single privilege of dying a hero's death, not a random or undignified one.“
Der Erwerb des pris durch den heldenhaften Tod ist also ein Konzept, das auch Herbort keineswegs fremd ist. So wird zwar der Topos des Heldentodes von Herbort aufgegriffen, interessant ist aber, wie der Autor damit umgeht. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die sich ergebende zweigeteilte Problematik aufzuzeigen, die in Herborts Text entsteht: Es gibt als Helden bezeichnete Krieger oder auch Ritter, die einen wenig glorreichen, brutalen oder makaberen Tod sterben, sind diese dennoch Helden? Mit anderen Worten: Wie ausschlaggebend ist der Tod an sich für die Heldenehrung? Und: Andere Helden, stellen ihr Heldentum durch ihre Taten massiv in Frage.
Wird ihnen dennoch ein Heldentod gewährt? Wirkt sich ein heldenhafter Tod positiv auf ihre Rezeption aus? Dies als Richtlinie nehmend, sollen in dieser Arbeit sechs Tode genauer betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Philomenis - Der erste namenhafte Tod
- Patroclus - Ein Tod aus Selbstüberschätzung und der Beginn des Rachedurstes
- Hector – Der Tod des größten Helden
- Achilles - Der Mord im Tempel
- Paris Des schönen Mörders Tod
- Ayax - Der Mord im Dunkeln und keine Heldentode außerhalb des Krieges
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Thematik des Heldentodes in Herborts von Fritzlars Liet von Troye. Im Fokus steht dabei die Frage, ob die Glorifizierung des Helden durch seinen Tod auf dem Schlachtfeld in einem Antikriegsepos überhaupt möglich ist. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Todesarten der Helden im Text und hinterfragt die Kriterien für einen „echten“ Heldentod.
- Die Rolle des Heldentodes in Herborts Liet von Troye
- Die Kriterien für einen Heldentod im Kontext des Antikriegsepos
- Die Bedeutung des öffentlichen Todes und der Klage um den Helden
- Die Rolle der Brutalität und des Kampfes im Kontext des Heldentodes
- Die Frage, ob ein Heldentod tatsächlich zur Heldenverehrung beiträgt
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die These auf, dass Herborts Liet von Troye ein Antikriegsepos ist und sich mit der Frage beschäftigt, ob die Glorifizierung des Helden durch seinen Tod in diesem Kontext überhaupt möglich ist. Die Arbeit untersucht, wie Herbort mit dem Topos des Heldentodes umgeht und ob ein heldenhafter Tod sich positiv auf die Rezeption der Helden auswirkt.
- Philomenis - Der erste namenhafte Tod: Das erste Kapitel analysiert den Tod von Philomenis, einem Verbündeten Troyas, der im Kampf gegen Ulixes stirbt. Der Tod wird als relativ unspektakulär beschrieben, und die Frage gestellt, ob die kurzen Elemente der Klage und des Streits um den Leichnam für einen Heldentod sprechen.
- Patroclus – Ein Tod aus Selbstüberschätzung und der Beginn des Rachedurstes: Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Tod von Patroclus, einem Freund Achilles, der im Kampf gegen Hector stirbt. Es wird untersucht, inwieweit der Tod als Folge von Selbstüberschätzung betrachtet werden kann und wie er den Rachedurst Achilles befeuert.
- Hector – Der Tod des größten Helden: Das dritte Kapitel analysiert den Tod von Hector, einem der größten Helden der Trojaner, der im Kampf gegen Achilles stirbt. Es wird untersucht, wie Hector als Held dargestellt wird, wie er seinen Tod empfängt und ob sein Tod als „echter“ Heldentod betrachtet werden kann.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Topos des Heldentodes, insbesondere im Kontext des Antikriegsepos. Wichtige Themen sind die Kriterien für einen Heldentod, die Rolle des öffentlichen Todes und der Klage, die Bedeutung des Kampfes und der Brutalität und die Frage, wie sich ein heldenhafter Tod auf die Rezeption der Helden auswirkt. Der Fokus liegt auf der Analyse der Todesarten der Helden in Herborts Liet von Troye und deren Bedeutung für die Darstellung von Helden in der Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Liet von Troje“?
Es ist ein um 1190 entstandener Antikenroman von Herbort von Fritzlar, der den Trojanischen Krieg nacherzählt.
Wird das „Liet von Troje“ als Antikriegsepos betrachtet?
In der Forschung wird oft die These vertreten, dass das Werk durch seine Darstellung von Brutalität und Leid Züge eines Antikriegsepos trägt.
Was sind die Kriterien für einen klassischen Heldentod?
Ein klassischer Heldentod erfordert Tapferkeit ohne Angst, den öffentlichen Tod in der Schlacht und die Aussicht auf ewigen Ruhm (pris).
Welche Helden-Tode werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit untersucht die Tode von Philomenis, Patroclus, Hector, Achilles, Paris und Ayax.
Wie geht Herbort von Fritzlar mit makabren Todesarten um?
Die Arbeit hinterfragt, ob Krieger, die einen wenig glorreichen oder brutalen Tod sterben, im Text dennoch als Helden geehrt werden.
- Citar trabajo
- Anna Schenck (Autor), 2014, Gibt es den Heldentod in Herborts von Fritzlar "Liet von Troje"?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340899