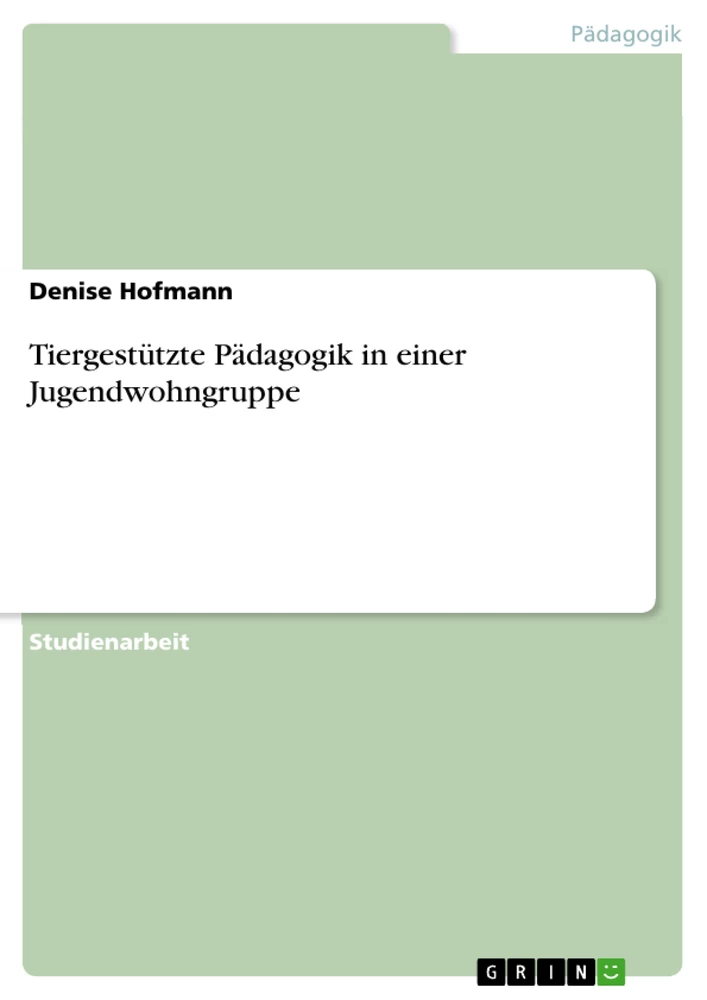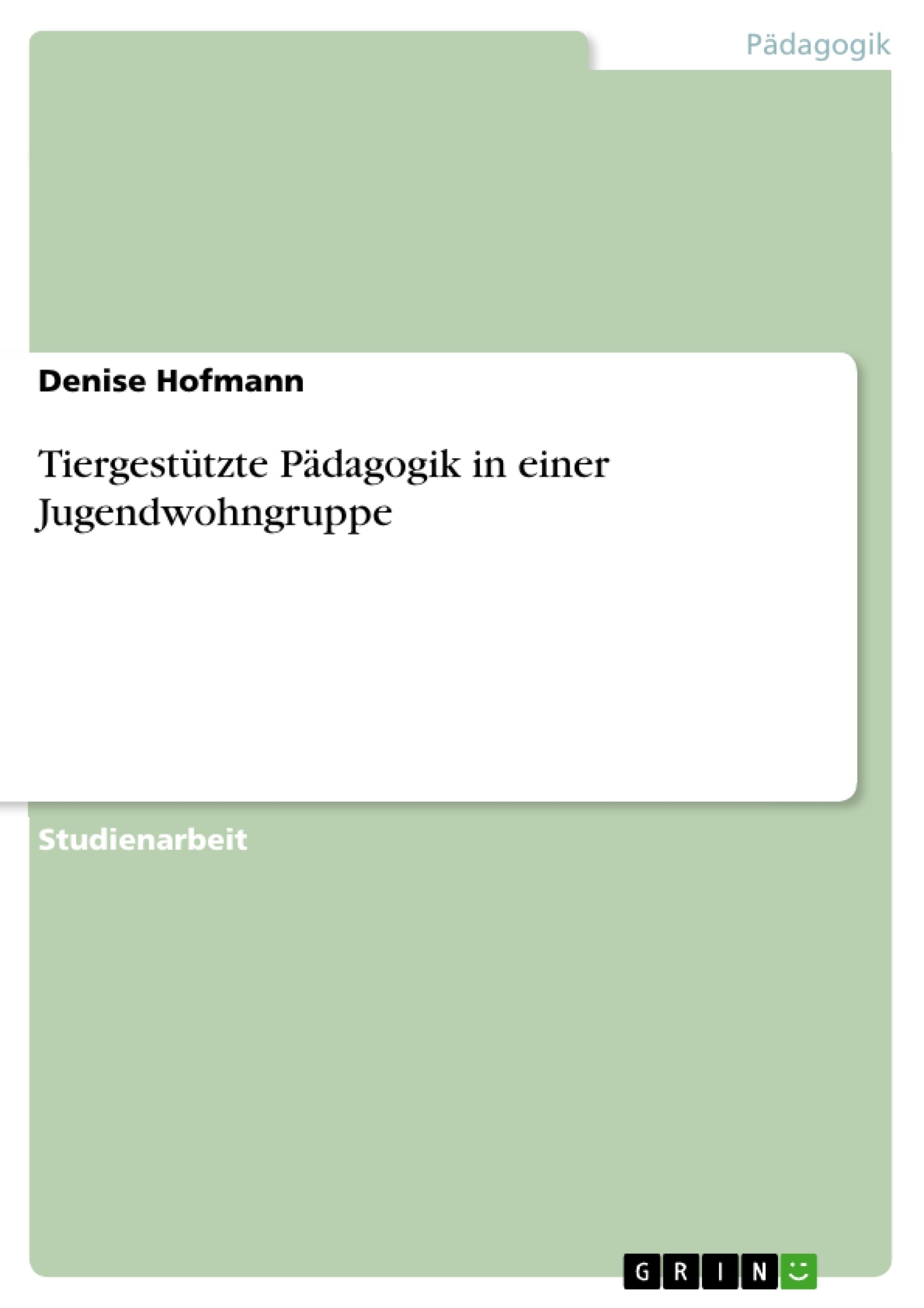Diese Facharbeit handelt von der tiergestützten Pädagogik in einer Jugendeinrichtung. Was sind die Vor- und Nachteile der tiergestützten Pädagogik? Was ist zu beachten? Um welchen Geldbetrag handelt es sich und welche Tiere sind am besten dafür geeignet?
Nur Tiere, welche domestiziert , speziell ausgebildet, gut versorgt und gut untergebracht sind, werden für diese Pädagogik ausgewählt. Hierfür gelten die Richtlinien der IAHAIO. Der Pädagoge muss zudem Kompetenzen gegenüber dem Tier haben. Das bedeutet, dass der Mensch die Stärken und Schwächen des Tieres genauestens kennt und über den richtigen Umgang Bescheid weiß. Die Sitzungen werden durch Protokolle dokumentiert und geplant. Der zeitliche Rahmen ist umfangreich und wird zuvor festgelegt. Die tiergestützte Pädagogik verfolgt konkrete, pädagogische Ziele, um den Menschen im sozialen und emotionalen Bereich zu stärken.
„Tiergestützte Pädagogik beschreibt einen von Tieren begleiteten (Heil-) Pädagogischen Erziehungs- und Förderansatz, sowie die Integration von Tieren in das Leben von Menschen jeden Alters. Die Tiere können den Pädagogen nicht ersetzen, sondern erweitern deren Erziehungs- und Fördermöglichkeiten. […]“
(Schaumweber 2009, S. 47)
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Formen der tiergestützten Arbeit
- 2.1 Tiergestützte Aktivität
- 2.2 Tiergestützte Pädagogik
- 2.3 Tiergestützte Therapie
- 3. Mensch-Tier-Beziehung
- 3.1 Jäger-Sammler-Gesellschaft
- 3.2 Griechische Antike
- 3.3 Mittelalter
- 3.4 Neuzeit
- 3.5 Zeit der Aufklärung
- 3.6 Sechziger Jahre
- 3.7 Zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts
- 4. Lernchancen
- 4.1 Allgemeine Lernchancen
- 4.2 Am Beispiel der tiergestützten Aktivität in meinem Oberstufenpraktikum
- 4.3 Am Beispiel einer Fernsehsendung
- 5. Grundbedingungen
- 5.1 Raum
- 5.2 Zeit
- 5.3 Geld
- 5.4 Tierschutz
- 5.5 Personal / Ausbildung
- 5.6 Schulungen
- 6. Probleme und Grenzen
- 7. Geeignete Tierarten
- 8. Möglicher Versorgungsplan am Beispiel „Hund“
- 9. Pädagogisches Handeln
- 9.1 In der Gruppe
- 9.1.1 Regeln
- 9.1.2 Rituale
- 9.1.3 Fairness
- 10. Elternarbeit
- 11. Das Team
- 12. Institutionen
- 13. Tod des Tieres
- 14. Schluss / Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Facharbeit „Tiergestützte Pädagogik im Jugendalter am Beispiel einer Jugendwohngruppe“ befasst sich mit der Anwendung von tiergestützten Methoden in der pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die verschiedenen Formen der tiergestützten Arbeit zu erläutern, die Lernchancen und Grundbedingungen für die tiergestützte Pädagogik zu beleuchten und die Herausforderungen und Grenzen dieser Pädagogik aufzuzeigen.
- Die verschiedenen Formen der tiergestützten Arbeit, insbesondere die tiergestützte Pädagogik, werden im Detail vorgestellt.
- Die Entwicklung der Mensch-Tier-Beziehung im historischen Kontext wird beleuchtet.
- Die Lernchancen, die die tiergestützte Pädagogik bietet, werden anhand praktischer Beispiele aus dem Oberstufenpraktikum und einer Fernsehsendung dargestellt.
- Die Grundbedingungen für die erfolgreiche Umsetzung der tiergestützten Pädagogik, wie Raum, Zeit, Geld, Tierschutz, Personal und Schulungen, werden analysiert.
- Die Probleme und Grenzen der tiergestützten Pädagogik werden aufgezeigt.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 stellt das Thema „Tiergestützte Pädagogik im Jugendalter“ vor und erläutert die Motivation für die Wahl dieses Themas. Kapitel 2 definiert und unterscheidet die verschiedenen Formen der tiergestützten Arbeit, einschließlich der tiergestützten Aktivität, Pädagogik und Therapie. Kapitel 3 beleuchtet die Entwicklung der Mensch-Tier-Beziehung in verschiedenen historischen Epochen. Kapitel 4 befasst sich mit den Lernchancen, die die tiergestützte Pädagogik bietet, anhand von praktischen Beispielen aus dem Oberstufenpraktikum und einer Fernsehsendung. Kapitel 5 untersucht die Grundbedingungen für die erfolgreiche Umsetzung der tiergestützten Pädagogik, wie Raum, Zeit, Geld, Tierschutz, Personal und Schulungen. Kapitel 6 analysiert die Probleme und Grenzen der tiergestützten Pädagogik. Kapitel 7 diskutiert geeignete Tierarten für die tiergestützte Arbeit. Kapitel 8 stellt einen möglichen Versorgungsplan für einen Hund vor und erläutert das pädagogische Handeln in der Gruppe. Kapitel 9 behandelt die Elternarbeit, das Team, die Institutionen und den Umgang mit dem Tod des Tieres.
Schlüsselwörter
Tiergestützte Pädagogik, Jugendalter, Jugendwohngruppe, Mensch-Tier-Beziehung, Lernchancen, Grundbedingungen, Probleme, Grenzen, geeignete Tierarten, Versorgungsplan, Pädagogisches Handeln, Elternarbeit, Team, Institutionen, Tod des Tieres.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen tiergestützter Aktivität und tiergestützter Pädagogik?
Tiergestützte Pädagogik verfolgt im Gegensatz zur allgemeinen Aktivität konkrete pädagogische Ziele, wird von Fachpersonal durchgeführt und durch Protokolle dokumentiert, um die soziale und emotionale Entwicklung zu fördern.
Welche Tiere eignen sich besonders für die Arbeit in einer Jugendwohngruppe?
Besonders Hunde werden häufig eingesetzt. Wichtig ist, dass die Tiere domestiziert, speziell ausgebildet und charakterlich für die Arbeit mit Jugendlichen geeignet sind.
Welche Rahmenbedingungen müssen für tiergestützte Pädagogik erfüllt sein?
Es müssen ausreichende finanzielle Mittel, geeignete Räumlichkeiten, Zeit für die Pflege und das Training sowie geschultes Personal vorhanden sein. Auch der Tierschutz nach IAHAIO-Richtlinien ist essenziell.
Welche Lernchancen bietet der Umgang mit Tieren für Jugendliche?
Jugendliche können Empathie, Verantwortungsbewusstsein und soziale Kompetenzen entwickeln. Das Tier dient oft als "Eisbrecher" und wertfreier Partner im pädagogischen Prozess.
Wie wird mit dem Tod eines Therapietieres umgegangen?
Die Arbeit thematisiert den Tod des Tieres als Teil des pädagogischen Konzepts, um den Jugendlichen den Umgang mit Verlust und Trauer in einem begleiteten Rahmen zu ermöglichen.
- Citar trabajo
- Denise Hofmann (Autor), 2016, Tiergestützte Pädagogik in einer Jugendwohngruppe, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340944