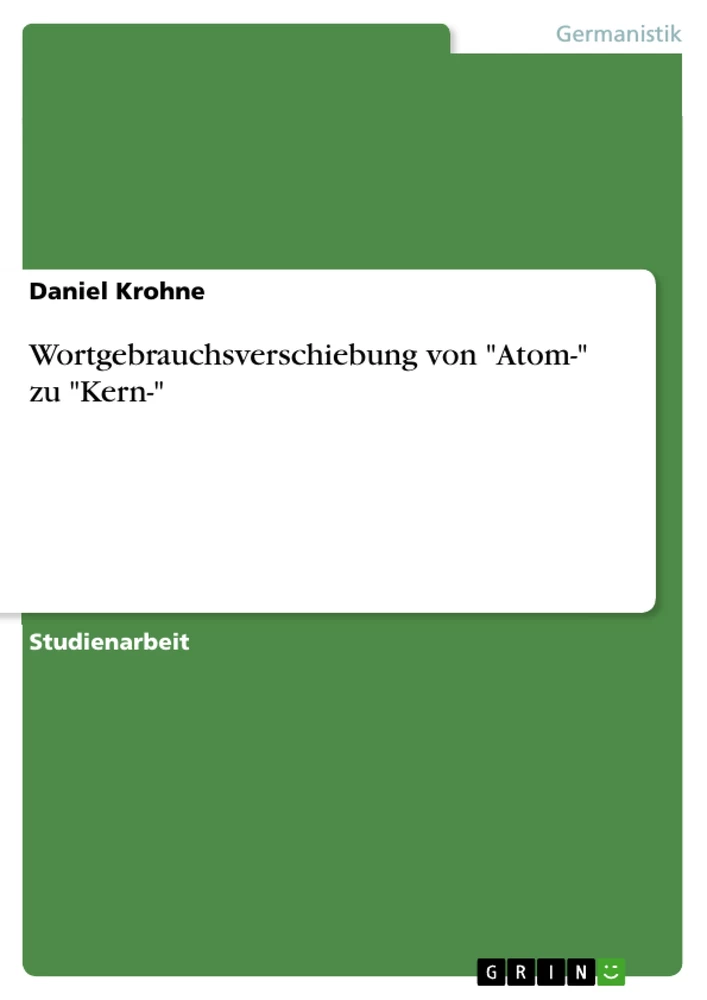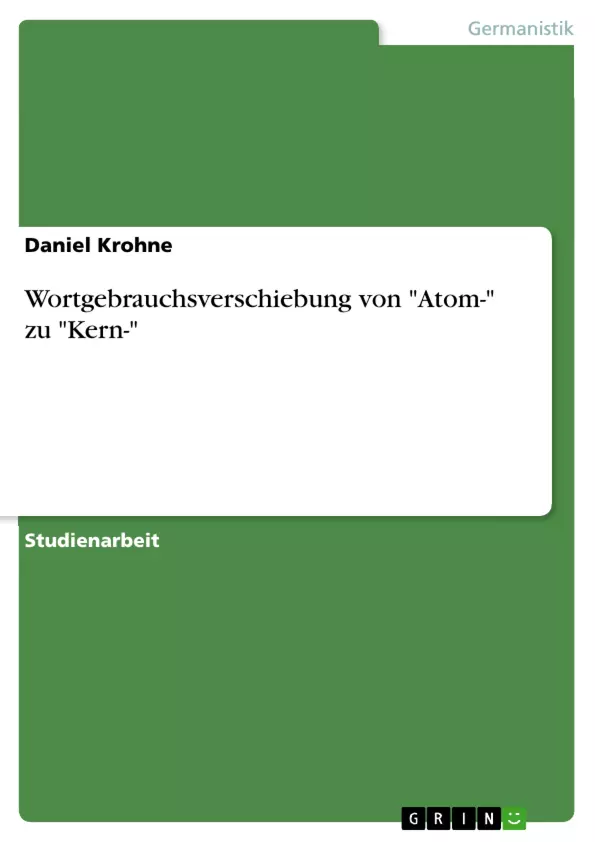Atom, das; a) kleinste mit chemischen Mitteln, jedoch mit physikalischen Mitteln noch weiter zerlegbare Einheit eines chemischen Elements, die noch die für das Element charakteristischen Eigenschaften besitzt: In den guten alten Zeiten hielt man das A. für das kleinste Elementarteilchen (Tempo 1, 1989, 88); winziges Teilchen, kaum wahrnehmbares Bruchstück: (Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden. 3.Auflage. Band1 1999, S.309)
Kern, der; [...] 2. (Biol.) kurz für Zellkern. 3. (Physik) kurz für Atomkern: leichte –e (Atomkern mit wenigen Protonen u. Neutronen); schwere –e (Atomkern mit vielen Protonen u. Neutronen); den Kern eines Atoms spalten; -e verschmelzen. (Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in zehn Bänden. 3. Auflage. Band5 1999, S.2098).
Trotz der gewaltigen Zerstörungskraft und dem Schrecken der Bevölkerung vor den Gefahren der Atombombe, gelingt es, die Erforschung und Entwicklung der Atomtechnik nach 1945 mit allgemeiner Zustimmung zu propagieren und zu finanzieren. So wird „In der Nachkriegszeit […] die friedliche Kernenergienutzung in der weltweiten Öffentlichkeit größtenteils akzeptiert“1. In der Bundesrepublik wird die praktische Nutzung der Atomtechnik mit der Wiedererlangung der staatlichen Souveränität möglich. Bis zu diesem Zeitpunkt ist es der Bundesrepublik durch die Alliierten verboten, sich auf dem Nukleargebiet zu betätigen. Man versteht die Atomenergie2 als Technologie der Zukunft und richtet im Oktober 1955 deshalb eigens ein Ministerium für Atomfragen dafür ein.3
Inhaltsverzeichnis
- Atom-/Kern-
- Trotz der gewaltigen Zerstörungskraft und dem Schrecken der Bevölkerung vor den Gefahren der Atombombe, gelingt es, die Erforschung und Entwicklung der Atomtechnik nach 1945 mit allgemeiner Zustimmung zu propagieren und zu finanzieren.
- „In der öffentlichen Meinung herrscht[e] Ende der 50er Jahre eine wahre Atomeuphorie[...]“, die unter anderem auch „das Ergebnis einer gezielten Informationspolitik“ ist.
- Bereits Ende der 50er Jahre beginnt aber auch der Versuch, Atom- durch den fachsprachlichen Terminus Kern- zu ersetzen.
- In den 60er Jahren beschränkt sich die Berichterstattung über Kernenergie vorwiegend auf den Bereich der Wirtschaft.
- Mitte der 70er Jahre nimmt die Berichterstattung der Medien und das öffentliche, überregionale Interesse an der Atomenergie wieder zu.
- Mit der „Anti-AKW-Bewegung‘ bildet sich bis 1977 auch ein neues spezifisches Umweltvokabular heraus, welches den „Nuklearjargon“ der Industrie und Politik in Frage stellt und auch von den Medien recht schnell aufgegriffen wird.
- Mit dem Unglück in Harrisburg und der vorübergehenden Aufgabe des Entsorgungszentrums in Gorleben ist zugleich der Höhepunkt als auch der vorläufige Endpunkt in der Nuklearkontroverse erreicht.
- Durch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26.4.1986 wird die Nukleardiskussion wieder ins öffentliche Interesse gerückt.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text untersucht die Entwicklung des Sprachgebrauchs in Bezug auf die Begriffe "Atom" und "Kern" in der deutschen Sprache im Kontext der nuklearen Entwicklungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Der Text analysiert, wie sich diese Begriffe in der öffentlichen und politischen Diskussion veränderten, wie sie in verschiedenen Kontexten verwendet wurden und welche Bedeutungswandel sie erlebten.
- Die Entwicklung und Verwendung der Begriffe "Atom" und "Kern" in der deutschen Sprache
- Die Rolle der Atomtechnik in der deutschen Gesellschaft und die öffentliche Meinung dazu
- Die Politisierung des Themas Kernenergie und der Sprachgebrauch in diesem Zusammenhang
- Die Bedeutung von Atom- und Kern-Komposita für die Darstellung der Atomenergie
- Die Verwendung von Atom- und Kern-Begriffen in der Medienberichterstattung
Zusammenfassung der Kapitel
- Atom-/Kern-: Dieser Abschnitt führt die beiden Kernbegriffe des Textes ein und erläutert ihre Bedeutung und Verwendung in der deutschen Sprache.
- Trotz der gewaltigen Zerstörungskraft und dem Schrecken der Bevölkerung vor den Gefahren der Atombombe, gelingt es, die Erforschung und Entwicklung der Atomtechnik nach 1945 mit allgemeiner Zustimmung zu propagieren und zu finanzieren.: Dieser Abschnitt beschreibt die Akzeptanz der Atomtechnik nach dem Zweiten Weltkrieg und die Entwicklung der Atomenergie in der Bundesrepublik Deutschland.
- „In der öffentlichen Meinung herrscht[e] Ende der 50er Jahre eine wahre Atomeuphorie[...]“, die unter anderem auch „das Ergebnis einer gezielten Informationspolitik“ ist.: Dieser Abschnitt beleuchtet die Atomeuphorie der 1950er Jahre und die damit verbundenen Neubildungen von Atomkomposita.
- Bereits Ende der 50er Jahre beginnt aber auch der Versuch, Atom- durch den fachsprachlichen Terminus Kern- zu ersetzen.: Dieser Abschnitt analysiert den Versuch, den Begriff "Atom" durch den fachsprachlichen Begriff "Kern" zu ersetzen und die damit verbundenen Gründe und Folgen.
- In den 60er Jahren beschränkt sich die Berichterstattung über Kernenergie vorwiegend auf den Bereich der Wirtschaft.: Dieser Abschnitt beschreibt die Berichterstattung über Kernenergie in den 1960er Jahren und die zunehmende Ablösung von "Atom" durch "Kern" im öffentlichen Sprachgebrauch.
- Mitte der 70er Jahre nimmt die Berichterstattung der Medien und das öffentliche, überregionale Interesse an der Atomenergie wieder zu.: Dieser Abschnitt thematisiert die wiedererwachte öffentliche Debatte über die Atomenergie in den 1970er Jahren, die durch Proteste gegen Kernkraftwerke und den Harrisburg-Unfall geprägt war.
- Mit der „Anti-AKW-Bewegung‘ bildet sich bis 1977 auch ein neues spezifisches Umweltvokabular heraus, welches den „Nuklearjargon“ der Industrie und Politik in Frage stellt und auch von den Medien recht schnell aufgegriffen wird.: Dieser Abschnitt beleuchtet die Entstehung einer neuen Umweltsprache in den 1970er Jahren, die sich gegen den "Nuklearjargon" der Industrie und Politik richtete.
- Mit dem Unglück in Harrisburg und der vorübergehenden Aufgabe des Entsorgungszentrums in Gorleben ist zugleich der Höhepunkt als auch der vorläufige Endpunkt in der Nuklearkontroverse erreicht.: Dieser Abschnitt analysiert den Einfluss des Harrisburg-Unfalls und der Gorleben-Debatte auf die Nuklearkontroverse.
- Durch die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26.4.1986 wird die Nukleardiskussion wieder ins öffentliche Interesse gerückt.: Dieser Abschnitt beschreibt die Folgen der Tschernobyl-Katastrophe für die öffentliche Diskussion über die Atomenergie und die Verwendung von "Atom" und "Kern" in diesem Zusammenhang.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe dieses Textes sind Atom, Kern, Atomtechnik, Kernenergie, Nukleardiskussion, Atomkraftwerk, Nuklearjargon, Atompolitik, Atomwaffen, Atomeuphorie, Atomangst, Umweltvokabular, Super-Gau. Der Text befasst sich mit der Entwicklung und Verwendung dieser Begriffe in der deutschen Sprache, insbesondere im Kontext der Atomtechnologie und den gesellschaftlichen und politischen Reaktionen auf diese Technologie.
Häufig gestellte Fragen
Warum verschob sich der Wortgebrauch von „Atom-“ zu „Kern-“?
Ende der 50er Jahre wurde versucht, das negativ besetzte Wort „Atom“ (verbunden mit der Atombombe) durch den fachsprachlichen Terminus „Kern“ zu ersetzen, um die friedliche Nutzung positiver darzustellen.
Was versteht man unter der „Atomeuphorie“ der 50er Jahre?
Es war eine Phase allgemeiner Zustimmung zur Erforschung der Atomtechnik, die als Technologie der Zukunft gefeiert wurde, was zur Gründung eines Ministeriums für Atomfragen 1955 führte.
Wie veränderte die Anti-AKW-Bewegung die Sprache?
Die Bewegung entwickelte ab Mitte der 70er Jahre ein spezifisches Umweltvokabular, das den „Nuklearjargon“ von Politik und Industrie kritisch hinterfragte.
Welchen Einfluss hatte die Katastrophe von Tschernobyl auf den Sprachgebrauch?
Durch das Unglück 1986 rückte die Nukleardiskussion wieder ins öffentliche Interesse, wobei Begriffe wie „Super-GAU“ und „Atomangst“ den Diskurs prägten.
Was war der „Nuklearjargon“ der Industrie?
Es handelte sich um eine technokratische Fachsprache, die oft dazu diente, die Risiken der Kernenergie durch abstrakte Begriffe zu versachlichen oder zu verharmlosen.
Was geschah nach dem Unglück in Harrisburg 1979?
Es markierte einen Höhepunkt der Nuklearkontroverse und verstärkte die mediale Berichterstattung sowie den öffentlichen Widerstand gegen Projekte wie das Entsorgungszentrum Gorleben.
- Citar trabajo
- Daniel Krohne (Autor), 2001, Wortgebrauchsverschiebung von "Atom-" zu "Kern-", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34105