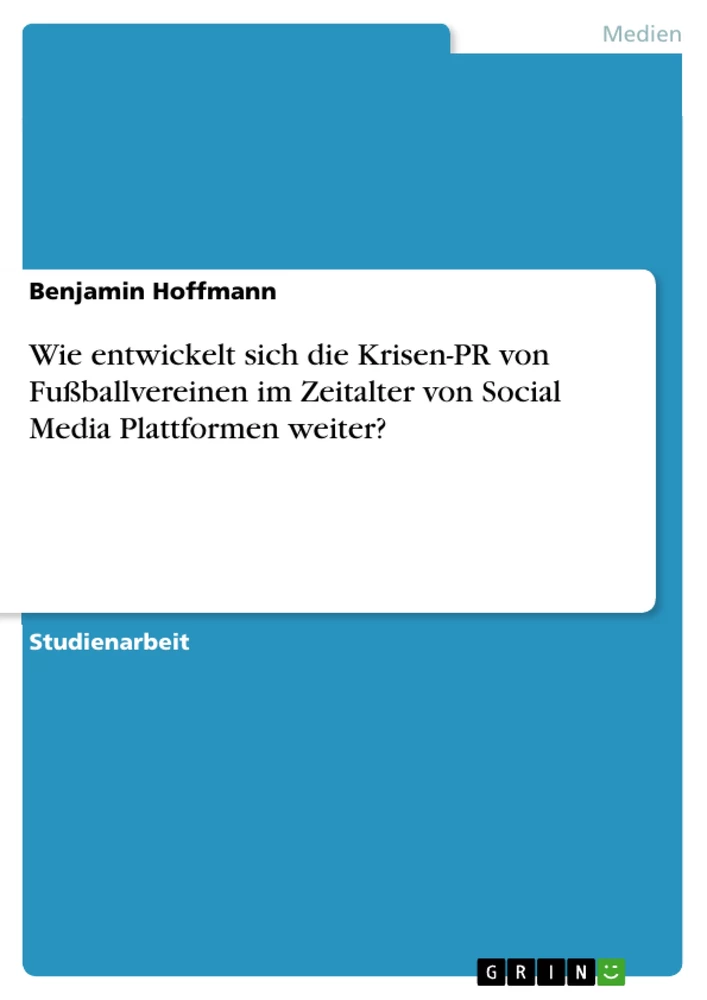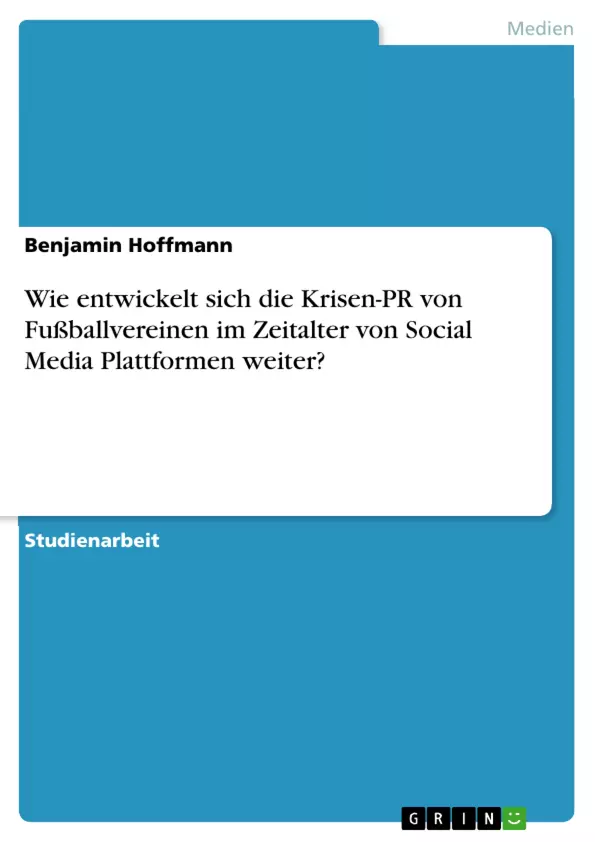Ich beschäftige mich in meiner Hausarbeit „Wie entwickelt sich die Krisen-PR von Fußballvereinen im Zeitalter von Social Media Plattformen weiter?“ mit der Frage, wie die Krisen-PR auf die „neuen“ Social Media Plattformen aufspringen kann, inwieweit ihre bisherigen Strategien auch im Online-Bereich funktionieren und welche Unterschiede es zu offline Strategien gibt. Beginnen werde ich mit der Begriffsbestimmung und den Grundlagen der Public Relations. Zudem werde ich am Beispiel der Gerüchteküche im Netz den Stellenwert der Krisen-PR in den Sozialen Medien erläutern. Anschließend gehe ich auf die allgemeine Krisenkommunikation im Social Web ein und stelle sie im Fazit gegenüber. Dieses Thema erachte ich als sehr wichtigen Bestandsteil aktueller Krisen, da sogenannte „Shitstorms“ im Social Web schon einige Unternehmen in kleinere bis große Krisen gestürzt hat, diese zum Teil durch Fehler der PR-Abteilung zurückzuführen sind, aber meistens an der mangelnden Beobachtung der Zielgruppen im Web ausgelöst worden sind.
Der Stellenwert von Social Media Plattformen nimmt in der Gesellschaft immer mehr zu. Wer heutzutage als Unternehmen nicht auf Facebook oder Twitter vertreten ist, hinkt der digitalen Gesellschaft hinterher. Solch ein Vereins-Account auf Facebook und anderen sozialen Plattformen bedeuten aber auch einen erheblichen Mehraufwand für die PR-Abteilung. Dieser Mehraufwand ist aber nötig um den Vereinsmitgliedern und Fans Informationen direkt vermitteln zu können und somit auf die „redaktionellen Torwächter“, den sogenannten Gatekeepern, den Journalisten, verzichten zu können. Dabei erreichen sie in Teilen weit mehr Rezipienten als über den Einsatz und die Publikation von Informationen über die klassischen Medien. Da es Online aber keine Gatekeeper gibt, sollte man Informationen und Gerüchte auf solchen Plattformen mit einer gewissen Skepsis gegenüberstehen. Hier ist seitens der PR-Abteilung Feingefühl gefordert, um aus einem Gerücht keine Krise zu machen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung und Definitionsdilemma
- Grundlagen der Public Relations
- Ziele und Aufgaben der Public Relations im Sport
- Krisen-PR im Sport
- Grundlagen der Krisenkommunikation
- Kennzeichen und Entwicklungsphasen einer Krise
- Strategien für den Krisenfall
- Fehler in der Krisenkommunikation
- Gerüchteküche: Externes Krisenfeld
- Krisenkommunikation im Social Web
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Entwicklung der Krisen-PR von Fußballvereinen im Zeitalter von Social Media Plattformen. Dabei wird analysiert, wie die etablierten PR-Strategien auf die neuen Online-Kanäle übertragen werden können und welche Besonderheiten die Krisenkommunikation im Social Web aufweist.
- Der Einfluss von Social Media auf die Krisen-PR von Fußballvereinen
- Die Herausforderungen der Krisenkommunikation im Social Web
- Die Bedeutung von Gerüchten und "Shitstorms" im Online-Bereich
- Die Rolle der PR-Abteilung in der Krisenprävention und -bewältigung
- Die Unterschiede zwischen offline und online Krisenkommunikationsstrategien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas dar und beschreibt den Forschungsgegenstand. Kapitel 2 beleuchtet die Begriffsbestimmung und die Definitionsdilemma der Public Relations. Kapitel 3 geht auf die verschiedenen Verständnisweisen von Public Relations ein und erläutert die Grundlagen des Fachgebiets. Kapitel 4 widmet sich den Zielen und Aufgaben der Public Relations im Sport, insbesondere im Kontext von Fußballvereinen. Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Krisen-PR im Sport, wobei die Grundlagen der Krisenkommunikation, die Kennzeichen und Entwicklungsphasen einer Krise sowie Strategien für den Krisenfall behandelt werden. Zudem wird auf Fehler in der Krisenkommunikation und die Rolle von Gerüchten im Netz eingegangen. Kapitel 6 analysiert die Krisenkommunikation im Social Web.
Schlüsselwörter
Krisen-PR, Fußballvereine, Social Media, Krisenkommunikation, "Shitstorms", Gerüchte, Online-Strategien, Public Relations, Gatekeeper, Medien, Fans.
Häufig gestellte Fragen
Wie verändert Social Media die Krisen-PR von Fußballvereinen?
Social Media ermöglicht die direkte Kommunikation mit Fans ohne journalistische „Gatekeeper“, erhöht aber auch die Gefahr von „Shitstorms“.
Was ist ein „Shitstorm“ im Kontext von Sportvereinen?
Eine lawinenartige Häufung negativer Kritik in sozialen Netzwerken, die oft durch mangelnde Beobachtung oder Fehler in der Kommunikation ausgelöst wird.
Welche Rolle spielen Gerüchte im Netz für die Krisen-PR?
Die digitale „Gerüchteküche“ erfordert schnelles Handeln und Feingefühl, um zu verhindern, dass aus Spekulationen echte Krisen entstehen.
Können klassische PR-Strategien online eins zu eins übernommen werden?
Nur bedingt; Online-Strategien müssen interaktiver, schneller und transparenter sein als klassische Offline-Methoden.
Was ist ein „Gatekeeper“ in der Kommunikation?
Traditionell sind dies Journalisten, die entscheiden, welche Informationen veröffentlicht werden. Im Social Web entfällt diese Kontrollfunktion weitgehend.
- Quote paper
- Benjamin Hoffmann (Author), 2016, Wie entwickelt sich die Krisen-PR von Fußballvereinen im Zeitalter von Social Media Plattformen weiter?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341136