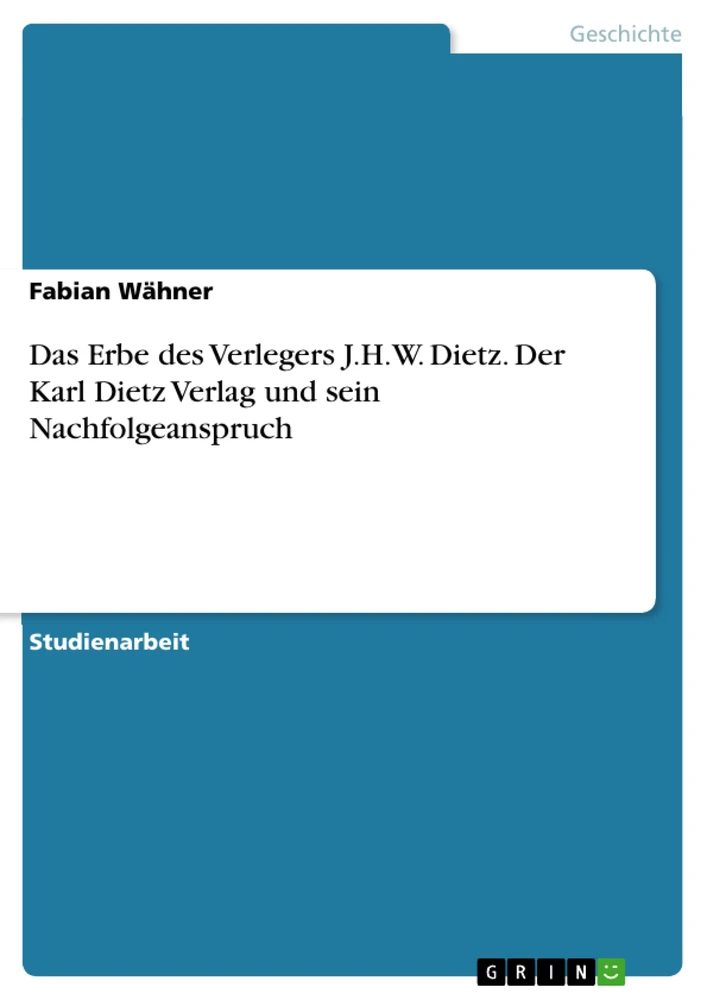Seit je her gilt die Frankfurter Buchmesse als eines der bedeutendsten jährlichen Ereignissedes Buchhandels. Selbst in wirtschaftlich schwachen Jahren, wie 1967, galt sie als Rekordmesse. Im Jahre 1967 sorgten jedoch andere Ereignisse im Vorfeld der Messe für nationales und internationales Aufsehen. Nach einer Verständigung mit westdeutschen Verlagen entschlossen sich die Messeverantwortlichen zu einem Zulassungsverbot für elf sogenannte "Parallelverlage" aus der DDR.
Ein Ereignis, welches das Kräftemessen zwischen den beiden deutschen Börsenvereinen aus Ost und West, dem Leipziger und dem Frankfurter Börsenverein, zum Ausdruck bringt. Nach vielem Hin und Her kam es im Juli 1967 letzten Endes zu einem Kompromiss. Der Leipziger Börsenverein sowie der Kulturminister der DDR, Klaus Gysi, mussten die Ablehnung der "Parallelverlage" hinnehmen. Ein Verlag, dem zuvor ebenfalls ein Messeverbot ausgesprochen wurde, überstand die Einigung und musste unter dem Zähneknirschen der Veranstalter zugelassen werden. Der Dietz Verlag konnte sich nach einem Rechtsstreit aus dem Jahre 1946 de jure als eigenständiger Verlag behaupten und so über die Klausel der "Parallelverlage" hinwegsetzten. Ihm wurde die Teilnahme an der Sonderausstellung "Schönste Bücher" zugesagt. Somit war der in der Presse als "Kalter Krieg mit Büchern" bezeichnete Konflikt vorerst überwunden.
Bestand vom juristischen Standpunkt her keine Verknüpfung des Karl Dietz Verlages mit dem J.H.W. Dietz Verlag der wilhelminischen Kaiserzeit, so war es den Verantwortlichen des Zentralkomitees der SED wichtig, ihn trotzdem de facto als dessen Nachfolger zu präsentieren.
Ein Vergleich zwischen diesen zwei Schwergewichten der Verlagsgeschichte erscheint auf den ersten Blick hin nicht leicht. Dennoch wird in der folgenden Arbeit versucht, Parallelen in der Verlagspolitik und -tätigkeit beider Verlage sowie deren Rolle auf den damaligen Buchmarkt zu ziehen. Nach einem kurzen Überblick über das Verlagswesen im jeweiligen historisch-politischen Kontext sowie die Vorstellung beider Verlage in ihrem Werdegang, erfolgt die Bewertung ihrer Bedeutung. Letzten Endes wird versucht, anhand der Erkenntnisse die Frage zu beantworten, wie der faktische Nachfolgeanspruch des Karl Dietz Verlag beurteilt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2.
- 2.1. Johann Heinrich Wilhelm Dietz - "Verleger der Sozialdemokratie"
- 2.2. Ist der Name gleich Programm? Der Karl Dietz Verlag als Nachfolger des J.H.W. Dietz Verlages
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Karl Dietz Verlag der DDR und seinen behaupteten Nachfolgeanspruch an den Verlag J.H.W. Dietz aus der wilhelminischen Kaiserzeit. Die Analyse zielt darauf ab, Parallelen in der Verlagspolitik und -tätigkeit beider Verlage aufzuzeigen und ihre Bedeutung für den jeweiligen Buchmarkt zu bewerten.
- Der J.H.W. Dietz Verlag und seine Rolle im Kontext des Sozialistengesetzes
- Der Karl Dietz Verlag als „Parteiverlag der SED“ in der DDR
- Vergleich der Verlagspolitik und -tätigkeit beider Verlage
- Bewertung des faktischen Nachfolgeanspruchs des Karl Dietz Verlages
- Die Bedeutung beider Verlage für die Verbreitung sozialistischer Ideen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Konflikt um die Zulassung von elf „Parallelverlagen“ aus der DDR zur Frankfurter Buchmesse 1967 und hebt den Dietz Verlag als einen Verlag hervor, der trotz anfänglichen Verbots aufgrund eines Rechtsstreits von 1946 teilnehmen durfte. Sie stellt die zentrale Frage nach dem faktischen Nachfolgeanspruch des Karl Dietz Verlages zum J.H.W. Dietz Verlag in den Mittelpunkt der Arbeit und skizziert den methodischen Ansatz des Vergleichs beider Verlage.
2.1. Johann Heinrich Wilhelm Dietz - "Verleger der Sozialdemokratie": Dieses Kapitel porträtiert Johann Heinrich Wilhelm Dietz als legendäre Figur des sozialistischen Verlagswesens. Es beschreibt die günstigen Rahmenbedingungen des Verlagswesens in der wilhelminischen Kaiserzeit, die durch das Urheberrechtsgesetz geschaffen wurden, aber auch den erheblichen Gegenwind durch staatliche Zensur und Boykott durch bürgerliche Buchhändler. Das „Sozialistengesetz“ von 1878 wird als ein entscheidender Faktor für die Herausforderungen des J.H.W. Dietz Verlags dargestellt. Das Kapitel betont die Reaktion der sozialistischen Bewegung auf diesen Druck, die zur Bildung einer sozialistischen Parallelgesellschaft des Buches führte und die enge Vernetzung der Sozialisten umso mehr festigte.
2.2. Ist der Name gleich Programm? Der Karl Dietz Verlag als Nachfolger des J.H.W. Dietz Verlages: (Kapitel fehlt im Originaltext. Eine Zusammenfassung kann hier nicht erstellt werden.)
Schlüsselwörter
J.H.W. Dietz Verlag, Karl Dietz Verlag, Sozialdemokratie, Sozialistengesetz, Verlagsgeschichte, Buchmarkt, wilhelminische Kaiserzeit, DDR, SED, Parteiverlag, Zensur, Arbeiterbewegung, sozialistische Parallelgesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Karl Dietz Verlag und seinem Verhältnis zum J.H.W. Dietz Verlag
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Karl Dietz Verlag der DDR und seinen behaupteten Nachfolgeanspruch an den Verlag J.H.W. Dietz aus der wilhelminischen Kaiserzeit. Die Analyse zielt darauf ab, Parallelen in der Verlagspolitik und -tätigkeit beider Verlage aufzuzeigen und ihre Bedeutung für den jeweiligen Buchmarkt zu bewerten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem den J.H.W. Dietz Verlag und seine Rolle im Kontext des Sozialistengesetzes, den Karl Dietz Verlag als „Parteiverlag der SED“ in der DDR, einen Vergleich der Verlagspolitik und -tätigkeit beider Verlage, die Bewertung des faktischen Nachfolgeanspruchs des Karl Dietz Verlages und die Bedeutung beider Verlage für die Verbreitung sozialistischer Ideen.
Wie beginnt die Arbeit?
Die Einleitung beschreibt den Konflikt um die Zulassung von elf „Parallelverlagen“ aus der DDR zur Frankfurter Buchmesse 1967 und hebt den Dietz Verlag als einen Verlag hervor, der trotz anfänglichen Verbots aufgrund eines Rechtsstreits von 1946 teilnehmen durfte. Sie stellt die zentrale Frage nach dem faktischen Nachfolgeanspruch des Karl Dietz Verlages zum J.H.W. Dietz Verlag in den Mittelpunkt der Arbeit und skizziert den methodischen Ansatz des Vergleichs beider Verlage.
Was wird im Kapitel über J.H.W. Dietz behandelt?
Kapitel 2.1 porträtiert Johann Heinrich Wilhelm Dietz als legendäre Figur des sozialistischen Verlagswesens. Es beschreibt die günstigen Rahmenbedingungen des Verlagswesens in der wilhelminischen Kaiserzeit, die durch das Urheberrechtsgesetz geschaffen wurden, aber auch den erheblichen Gegenwind durch staatliche Zensur und Boykott durch bürgerliche Buchhändler. Das „Sozialistengesetz“ von 1878 wird als ein entscheidender Faktor für die Herausforderungen des J.H.W. Dietz Verlags dargestellt. Das Kapitel betont die Reaktion der sozialistischen Bewegung auf diesen Druck, die zur Bildung einer sozialistischen Parallelgesellschaft des Buches führte und die enge Vernetzung der Sozialisten umso mehr festigte.
Was ist über Kapitel 2.2 bekannt?
Kapitel 2.2 ("Ist der Name gleich Programm? Der Karl Dietz Verlag als Nachfolger des J.H.W. Dietz Verlages") fehlt im Originaltext. Eine Zusammenfassung kann daher nicht erstellt werden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: J.H.W. Dietz Verlag, Karl Dietz Verlag, Sozialdemokratie, Sozialistengesetz, Verlagsgeschichte, Buchmarkt, wilhelminische Kaiserzeit, DDR, SED, Parteiverlag, Zensur, Arbeiterbewegung, sozialistische Parallelgesellschaft.
- Citation du texte
- Fabian Wähner (Auteur), 2015, Das Erbe des Verlegers J.H.W. Dietz. Der Karl Dietz Verlag und sein Nachfolgeanspruch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341269