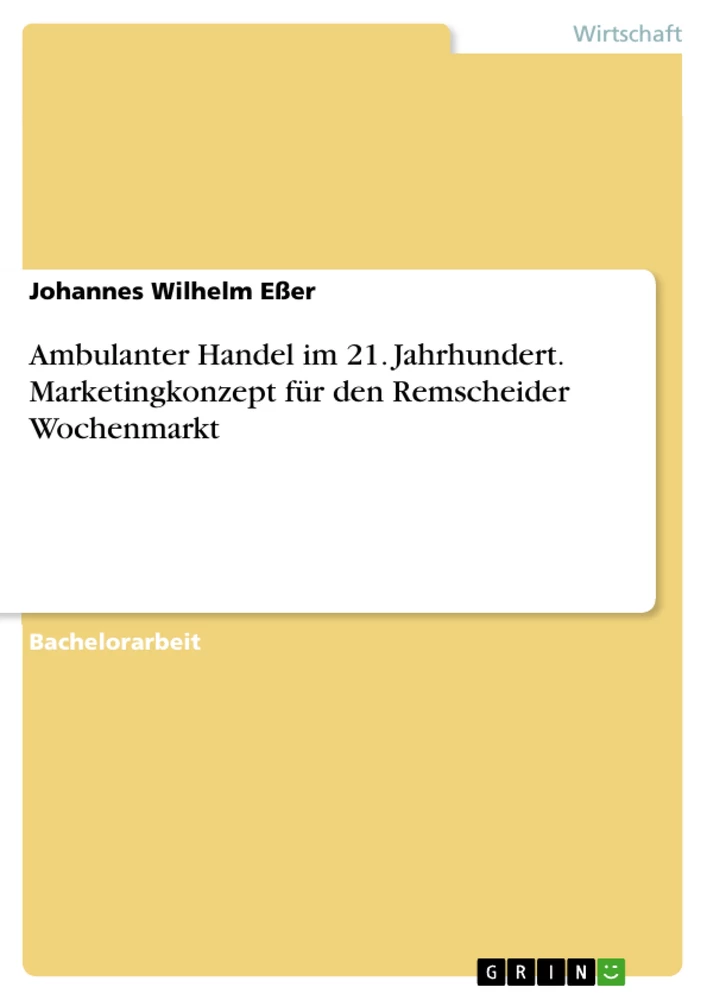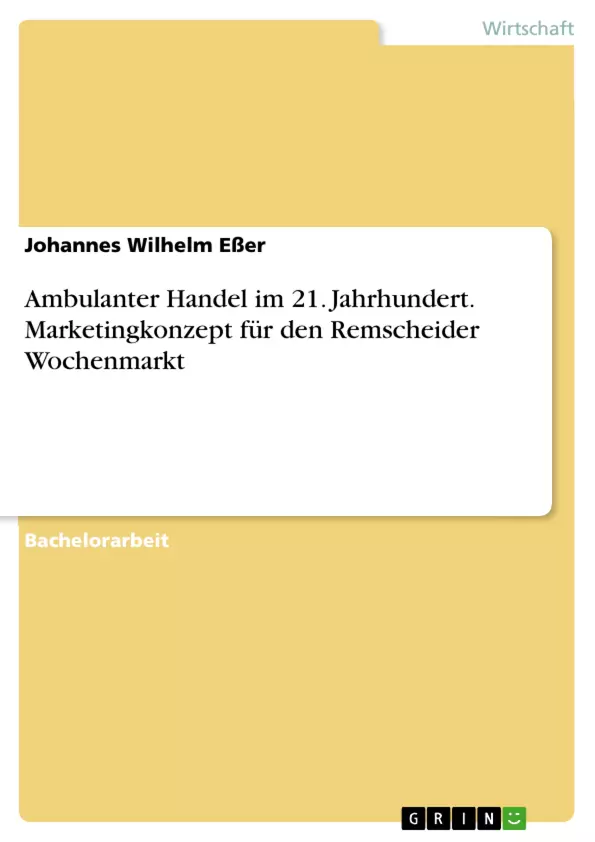Vorliegende Thesis behandelt die Entwicklung einer Marketingkonzeption für den Remscheider Wochenmarkt. Durch den angestrebten Bedeutungs- und Attraktivitätszuwachs des Marktes sollen städtische Interessen der Wirtschafts- und Imageförderung verfolgt und über eine Steigerung des Kundenaufkommens die Ertragslage der Marktbeschicker verbessert werden.
Die Situationsanalyse hat gezeigt, dass Marktbeschicker von einem Imagevorsprung bei Qualität und Frische, schlanken betrieblichen Strukturen, der Nähe zum Kunden (persönlicher Verkauf) und der Einzigartigkeit der Marktatmosphäre profitieren. Unterdes erschwert die geringe Mittelausstattung der Kleinstbetriebe individuelle Werbemaßnahmen und erfordert gemeinschaftlich finanzierte Projekte mit hohem Koordinations- und Abstimmungsbedarf.
Durch die entschleunigte altengerechte Verkaufskultur ergeben sich weitere Absatzchancen im demographischen Wandel, während wachsendes Umwelt-, Gesundheits- und Regionalbewusstsein die gebotene Herkunftstransparenz, Nahrungsmittelsicherheit und Naturbelassenheit der Markterzeugnisse in den Fokus der Verbraucher rückt. Schrumpfende Haushaltsgrößen, atypische Beschäftigungsverhältnisse und lose Tagesstrukturen sowie eine wachsende Discount- und Convenience-Mentalität sorgen unterdessen für einen abnehmenden Stellenwert der eigenständigen Nahrungsmittelzubereitung und mindern die Zukunftsfähigkeit des Frischwarenangebotes.
Vision und Mission des Marktes bestehen darin, als Kulturgut und attraktives Freiluft-Lebensmittelgeschäft ein Kauferlebnis zu bieten und den urbanen Raum mit dem Umland zu verbinden, um ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu fördern (Regionalmarketing).
Die Naturbelassenheit der Waren limitiert die Maximierung des Leistungsprogrammes auf das Strategiefeld der Marktdurchdringung. Kleine Produktionsmengen, der überschaubare Warenumschlag und die funktionale Austauschbarkeit der Lebensmittel erfordern eine Präferenz-Strategie (Leistungsdifferenzierung) mit ausgeprägter Service- und Erlebnisbetonung, Hoch-preispolitik und Platzierung einer eigenen Markenarchitektur mit überregionaler Dachmarke. Die Marktparzellierung hat die Zielgruppen der Organic, Health und Homegrown Enthusiasts sowie der preisbewussten Standardkonsumenten identifiziert. Während erstere die Kernziel-gruppe der einzelnen hochspezialisierten Anbieter bilden, ist die Ansprache der Normalverbraucher durch das Stadtmarketing elementar zur Wiederbelebung der Laufkundschaft.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einführung
- Beschreibung des Unternehmens
- Projektbeschreibung
- Problemstellung
- Methodik der Durchführung
- Ziele der Untersuchung
- Situationsanalyse
- Marktanalyse
- Umfeldanalyse
- Branchenstrukturanalyse
- Kundenanalyse
- Unternehmensanalyse
- Wertkettenanalyse
- Ressourcenanalyse
- SWOT-Matrix
- Strategisches Marketing
- Zielvorgaben
- Marktfeldstrategie
- Marktstimulierungsstrategie
- Marktparzellierungsstrategie
- Marktarealstrategie
- Operatives Marketing
- Leistungspolitik
- Distributionspolitik
- Standortpolitik
- Ladengestaltung
- Preispolitik
- Kommunikationspolitik
- Privatisierung der Marktverwaltung
- Ergebnisse und Schlussfolgerungen
- Empfehlungen und kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung einer Marketingkonzeption für den Remscheider Wochenmarkt. Durch die angestrebte Steigerung der Attraktivität und Bedeutung des Marktes soll die Ertragslage der Marktbeschicker verbessert und die städtischen Interessen der Wirtschafts- und Imageförderung gefördert werden.
- Die Analyse der aktuellen Situation des Remscheider Wochenmarktes
- Die Identifizierung von Chancen und Risiken für die Zukunft des Marktes
- Die Entwicklung von strategischen und operativen Marketingmaßnahmen zur Steigerung der Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Marktes
- Die Untersuchung der Möglichkeiten einer Privatisierung der Marktverwaltung
- Die Bedeutung des Marketings für die Zukunft des ambulanten Handels im 21. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Problematik des Remscheider Wochenmarktes im Kontext des Wandels des Lebensmittelhandels im 21. Jahrhundert dar. Kapitel 2 beschreibt den Gartenbaubetrieb Eßer, einen Marktbeschicker des Wochenmarktes Remscheid, und dessen Entwicklung. In Kapitel 3 wird die Projektbeschreibung mit Problemstellung, Methodik und Zielen vorgestellt. In Kapitel 4 wird eine umfassende Situationsanalyse des Remscheider Wochenmarktes durchgeführt. Kapitel 5 behandelt die strategische Marketingplanung, in der Zielvorgaben, Marktfeldstrategie, Marktstimulierungsstrategie, Marktparzellierungsstrategie und Marktarealstrategie erörtert werden. In Kapitel 6 wird der Einsatz des absatzpolitischen Instrumentariums im Rahmen des operativen Marketings behandelt. Kapitel 7 präsentiert die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Arbeit, und Kapitel 8 fasst die Empfehlungen zusammen und gibt eine kritische Würdigung.
Schlüsselwörter (Keywords)
Ambulanter Handel, Wochenmarkt, Marketingkonzeption, Remscheid, Situationsanalyse, SWOT-Analyse, Strategisches Marketing, Operatives Marketing, Preispolitik, Kommunikationspolitik, Privatisierung, Regionalmarketing, Bioprodukte, Convenience, Nachhaltigkeit, Kundenbedürfnisse, Zielgruppen, Image, Wettbewerbsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Marketingkonzepts für den Remscheider Wochenmarkt?
Ziel ist es, die Attraktivität des Marktes zu steigern, die Ertragslage der Beschicker zu verbessern und das Image der Stadt Remscheid zu fördern.
Welche Stärken haben die Marktbeschicker laut der Analyse?
Sie profitieren von einem Imagevorsprung bei Qualität und Frische, Kundennähe durch persönlichen Verkauf und der einzigartigen Marktatmosphäre.
Welche Herausforderungen bringt der demographische Wandel für den Markt mit sich?
Es ergeben sich Chancen durch eine altengerechte Verkaufskultur, aber auch Risiken durch schrumpfende Haushalte und eine wachsende Convenience-Mentalität.
Welche Zielgruppen stehen im Fokus des Marketings?
Identifiziert wurden "Organic, Health und Homegrown Enthusiasts" sowie preisbewusste Standardkonsumenten.
Wird eine Privatisierung der Marktverwaltung in Betracht gezogen?
Ja, die Arbeit untersucht im Rahmen des operativen Marketings auch die Möglichkeiten einer Privatisierung der Marktverwaltung.
Welche Rolle spielt das Regionalmarketing für den Wochenmarkt?
Der Markt soll als Kulturgut fungieren, das den urbanen Raum mit dem Umland verbindet und Nachhaltigkeit fördert.
- Citar trabajo
- Dipl.-Wirt.-Inf. (FH) Johannes Wilhelm Eßer (Autor), 2016, Ambulanter Handel im 21. Jahrhundert. Marketingkonzept für den Remscheider Wochenmarkt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341359