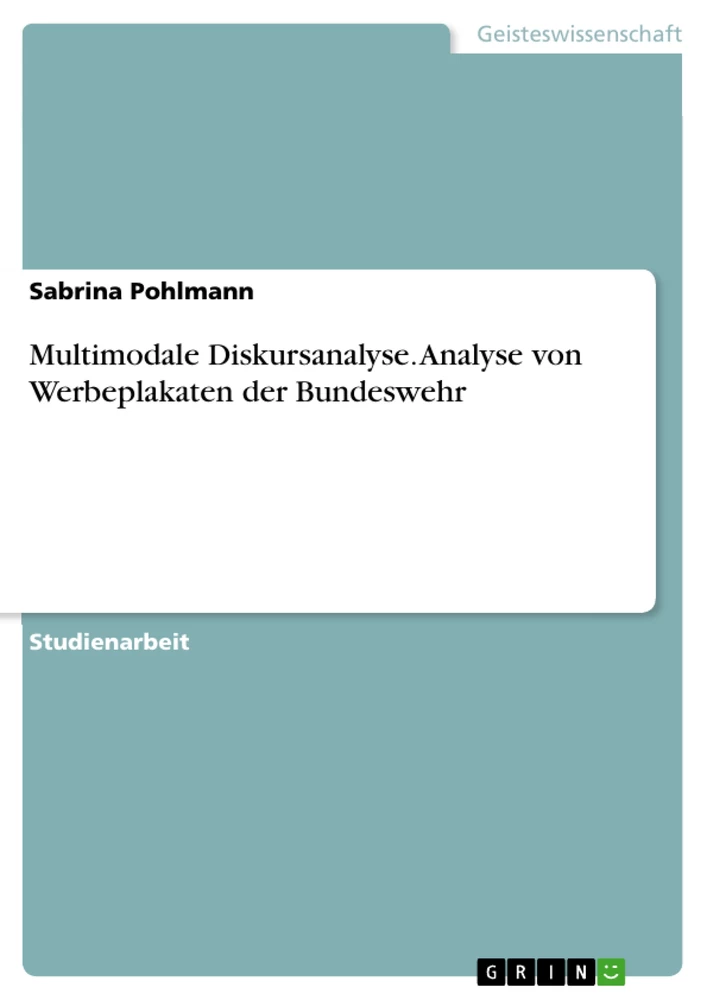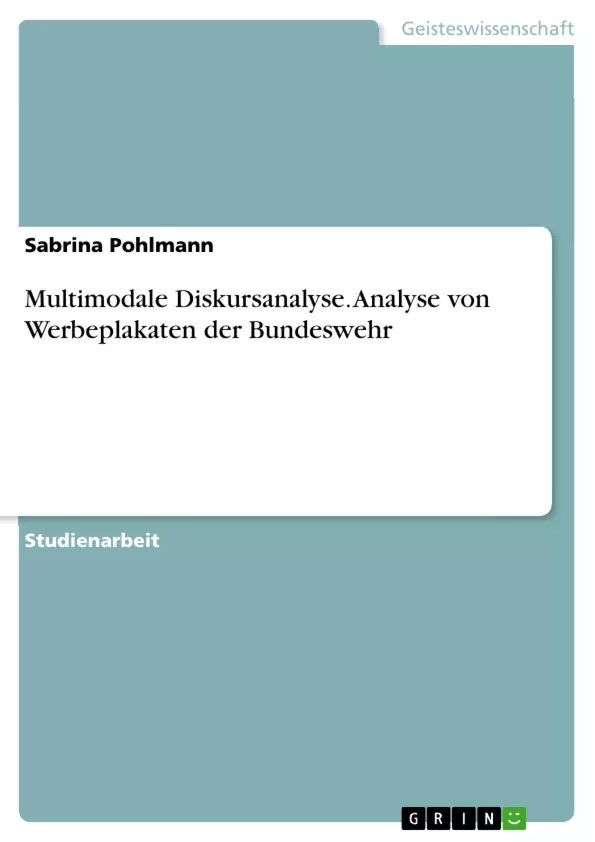In dieser Arbeit wird die Durchführung einer Diskursanalyse beschrieben. Als Material dienen dabei zehn Plakate, die die Bundeswehr im Rahmen einer größeren Kampagne seit November 2015 an öffentlichen Orten aushängt, um neue Mitarbeiter_innen zu gewinnen. Die Forschungsfragen der Analyse lauteten: Welche Strategie verfolgt die Bundeswehr bei der Anwerbung von Mitarbeiter_innen? Welcher (visueller und sprachlicher) Mittel bedient sie sich dabei? Welche Vorzüge, die potentielle Bewerber_innen überzeugen sollen, hebt sie hervor und welche Aspekte verschweigt sie? Weil es sich bei Plakatwerbung um reflexiv überhöhte Daten handelt, wurden die Forschungsfragen dementsprechend angepasst. Es war wichtig, darauf zu achten, welchen Zweck die Kampagne verfolgt. Es ist der Zweck der Anwerbung neuer Mitglieder für die Bundeswehr. Deswegen ist davon auszugehen, dass die Plakate das Ergebnis strategischen Handelns sind und ein bestimmtes, vorher definiertes Ziel erreichen möchten.
Bevor die Forschungsfragen beantwortet werden, werde ich jedoch zuerst die Methodik der Diskursanalyse(n) vorstellen. Um die Zielsetzung zu verstehen, ist es anfangs notwendig, kurz auf die Theorien von Michel Foucault eingehen, die zur Entwicklung des Forschungsfeldes der Diskursanalyse(n) geführt haben. Anschließend werden allgemeine Informationen über die praktische Arbeitsweise bei Diskursanalysen gegeben und auf die Besonderheiten von visuellen Diskursanalysen hingewiesen. Es folgt der Praxisteil, der neben der Analyse selbst, auch eine Zusammenfassung der Ergebnisse enthält. Außerdem wird im Praxisteil darauf eingegangen, wie die Vorgehensweise entwickelt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Methodik: Diskursanalyse
- Theoretische Grundlagen
- Diskursanalyse in der Forschungspraxis
- Besonderheiten von visuell orientierten Diskursanalysen
- Praxis: meine Forschung
- Entwicklung einer Vorgehensweise
- Analyse
- Zusammenfassung der Analyseergebnisse
- Reflexion
- Hilfreiche Strategien während des Forschungsprozesses
- Schwierigkeiten während des Forschungsprozesses
- Fazit
- Inhaltlich weiterführende Fragestellungen
- Methodisch weiterführende Fragestellungen
- Anhang
- Literaturverzeichnis
- Liste der Grafiken inklusive Quellenangaben
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die Erfahrungen der Autorin bei der Durchführung einer Diskursanalyse zu dokumentieren. Anhand von zehn Plakaten, die die Bundeswehr im Rahmen einer Anwerbekampagne verwendet, werden die Strategien der Bundeswehr bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeiter_innen untersucht. Die Analyse fokussiert auf die verwendeten visuellen und sprachlichen Mittel, die Vorzüge, die potenzielle Bewerber_innen überzeugen sollen, und die Aspekte, die verschwiegen werden.
- Strategien der Bundeswehr bei der Anwerbung von Mitarbeiter_innen
- Visuelle und sprachliche Mittel in der Plakatwerbung
- Vorzüge, die die Bundeswehr hervorhebt
- Aspekte, die die Bundeswehr verschweigt
- Diskursanalytische Methoden im Kontext visueller Daten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Diskursanalyse anhand von zehn Plakaten der Bundeswehr ein und erläutert die Forschungsfragen. Kapitel 2 widmet sich der Methodik der Diskursanalyse, wobei die theoretischen Grundlagen, die Anwendung in der Forschungspraxis sowie die Besonderheiten visueller Diskursanalysen beleuchtet werden. Im Praxis-Kapitel werden die Analyse der Plakate, die Zusammenfassung der Ergebnisse und die Entwicklung der Vorgehensweise beschrieben. Kapitel 4 reflektiert die Erfahrungen der Autorin während des Forschungsprozesses, einschließlich hilfreicher Strategien und Schwierigkeiten. Abschließend werden im Fazit inhaltlich und methodisch weiterführende Fragestellungen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Diskursanalyse, Bundeswehr, Plakatwerbung, Anwerbung, visuelle Kommunikation, Macht, Subjekt, Wissen, strategisches Handeln, visuelle Diskursanalyse, Forschungspraxis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine multimodale Diskursanalyse?
Es ist eine Untersuchungsmethode, die sowohl sprachliche als auch visuelle Zeichen (Bilder, Layout) analysiert, um dahinterliegende Machtstrukturen oder Strategien aufzudecken.
Welche Strategie verfolgt die Bundeswehr in ihrer Plakatwerbung?
Die Bundeswehr nutzt gezielt visuelle und sprachliche Mittel, um sich als attraktiver Arbeitgeber darzustellen und neue Mitarbeiter anzuwerben.
Welche Vorzüge hebt die Bundeswehr in der Kampagne hervor?
Hervorgehoben werden oft Aspekte wie Kameradschaft, Abenteuer, Technik und berufliche Sicherheit.
Was wird in der Werbung der Bundeswehr oft verschwiegen?
Kritische Aspekte wie Gefahren im Einsatz, psychische Belastungen oder die ethische Problematik des Waffengebrauchs werden in der Regel ausgeklammert.
Welche Rolle spielt Michel Foucault in dieser Arbeit?
Foucaults Theorien zu Macht, Wissen und Diskurs bilden die theoretische Grundlage für das Verständnis, wie Werbung gesellschaftliche Realitäten mitgestaltet.
Wie wurde die Analyse der Plakate durchgeführt?
Es wurden zehn Plakate einer Kampagne ab 2015 systematisch nach ihrer Bildsprache, Farbwahl und den verwendeten Slogans untersucht.
- Quote paper
- Sabrina Pohlmann (Author), 2016, Multimodale Diskursanalyse. Analyse von Werbeplakaten der Bundeswehr, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341550