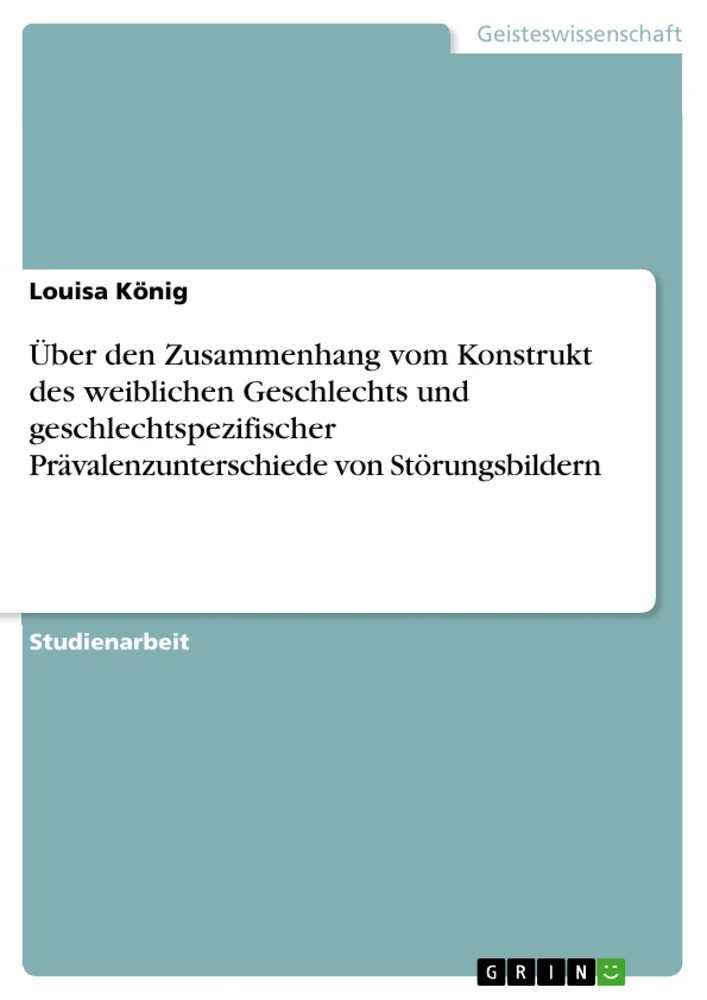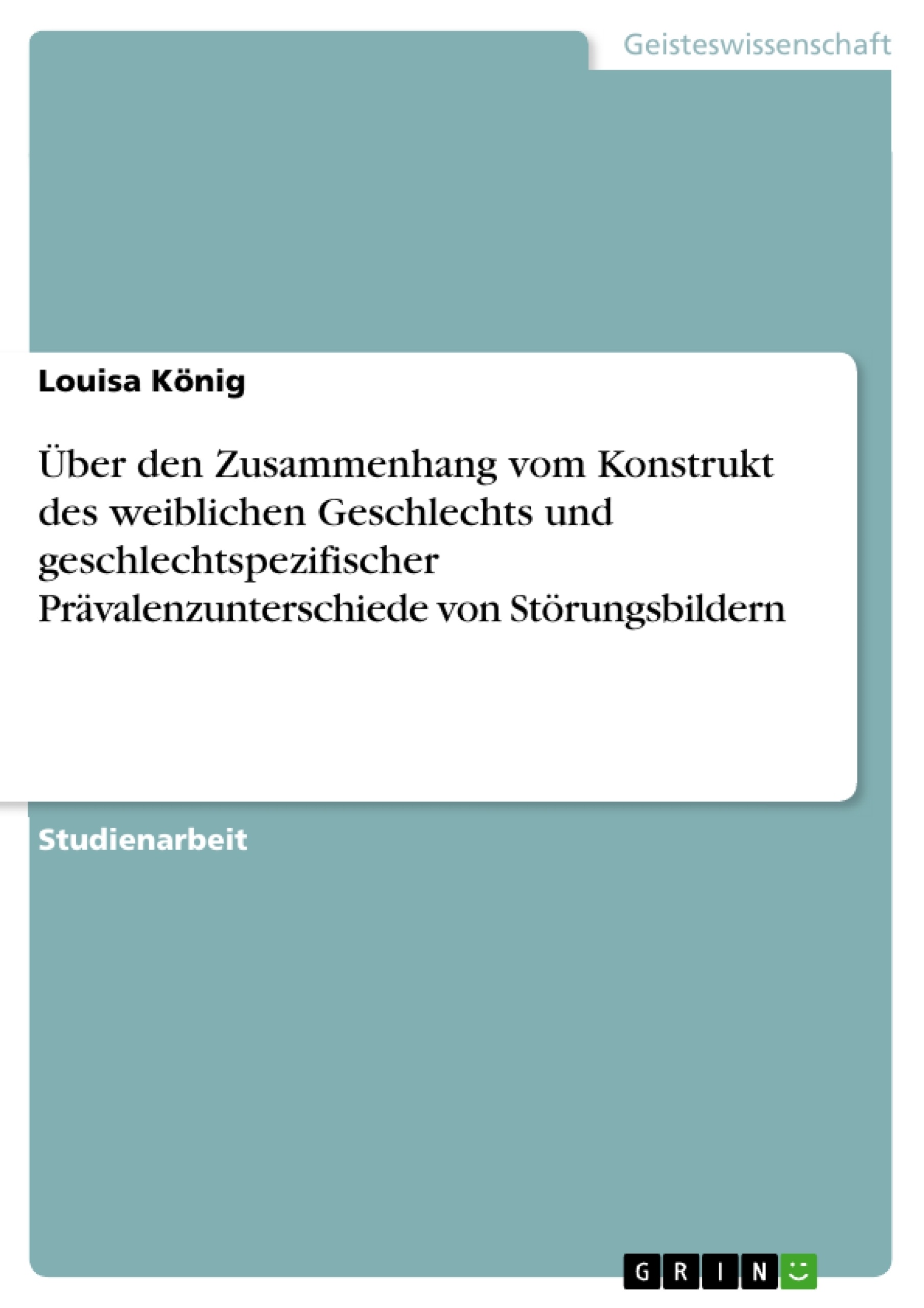Aus unterschiedlichen Studien geht hervor, dass ein erheblicher Prävalenzunterschied psychischer Störungen in den Gruppen von Männern und Frauen vorliegt. Im Vergleich zu Männern sind Frauen statistisch häufiger von internalisierenden Störungen betroffen, leiden öfters an Neurosen, Angst- und Essstörungen sowie somatoformen Störungen. Auch hinsichtlich einer Medikamentenabhängigkeit findet sich ein höherer Anteil bei Frauen.
Diese Prävalenzunterschiede können von vielen epidemiologischen Untersuchungen bestätigt werden, doch lassen sich in der Literatur zahlreiche Erklärungsansätze und Ursachenzuschreibungen finden. Oftmals beziehen sich die Hintergründe, die das geschlechtsspezifische Verhaltensrepertoire und die daraus resultierenden geschlechtsspezifischen Gesundheitskonzepte erklären sollen, jedoch lediglich auf genetische und neurobiologische Faktoren. Doch hinter den geschlechtsspezifischen Störungsbildern lassen sich auch Risikofaktoren identifizieren, die allein sozialepidemologisch erklärt werden können , bzw. biologische Ursachen ergänzen. Hinzukommend muss beachtet werden, dass in der Geschlechterforschung eine erhebliche Veränderung in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Die Herausforderung in der Untersuchung der geschlechtsspezifischen Störungsbilder liegt seither darin, Geschlecht als eine Dimension des Sozialen zu berücksichtigen.
Der französische Soziologe Pierre Bourdieu machte in seinen Theorien darauf aufmerksam, dass die binäre Geschlechtsklassifikation, so wie sie in unserer Gesellschaft vorzufinden ist, ein Bestandteil sozialer Ordnung ist, die soziale Welt durch die klassifikatorische Denkweise und durch die Einteilung in weibliches und männliches Geschlecht geprägt ist. Unter dem Hintergrund dieser theoretischen Konzepte stellt sich somit die Frage, inwiefern die Klassifikation von Geschlecht, die Manifestierung von typisch männlichem und weiblichem Verhalten, bzw. der geschlechtsspezifische Habitus die Prävalenzunterschiede psychischer Störungen bei den sozialen Geschlechtern Mann und Frau reproduziert.
Auf der Grundlage der Theorien Pierre Bourdieus und einigen epidemiologischen Studien soll im Folgenden der Zusammenhang zwischen typisch weiblichen Störungsbildern und dem Konstrukt des weiblichen Geschlechts untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vergeschlechtlicher und vergeschlechtlichender Habitus
- Männliche Herrschaft und die Situtation der Frau
- Internalisierende Störungen bei Frauen
- Kritik an Studien und Forschung
- Fazit
- Implikationen für die Forschung, Erziehungswissenschaft und Psychotherapie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen dem Konstrukt des weiblichen Geschlechts und geschlechtsspezifischen Prävalenzunterschieden von Störungsbildern. Sie analysiert, ob die soziale Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit unterschiedliche Risikofaktoren, geschlechtstypische Verarbeitungsmuster und Gesundheitsrisiken mit sich bringt. Dabei wird der Fokus auf die Frage gelegt, ob Frauen im Sozialisationsprozess unabhängig von ihren biologischen Voraussetzungen andere Ängste, Ressourcen, Emotionsregulierungen und Internalisierungen als Männer entwickeln, die das häufigere Auftreten von affektiven und psychosomatischen Störungen erklären.
- Das Konzept des Habitus und seine Relevanz für die Analyse von Geschlechterrollen
- Die Konstruktion von Geschlecht als soziale Kategorie
- Geschlechtsspezifische Prävalenzunterschiede psychischer Störungen
- Mögliche Risikofaktoren und Verarbeitungsmuster im Kontext von Geschlecht
- Implikationen für die Forschung, Erziehungswissenschaft und Psychotherapie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der geschlechtsspezifischen Prävalenzunterschiede psychischer Störungen dar und führt in die theoretischen Ansätze ein, die für die Untersuchung relevant sind.
- Vergeschlechtlicher und vergeschlechtlichender Habitus: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept des Habitus nach Pierre Bourdieu und stellt die Theorie dem traditionellen Rollenkonzept gegenüber. Es wird erläutert, wie der Habitus Geschlecht als eine fundamentale Dimension sozialer Ordnung begreift.
- Männliche Herrschaft und die Situation der Frau: Dieses Kapitel fokussiert auf die sozialen Strukturen, die zur Konstruktion von Geschlechterrollen und -hierarchien beitragen. Es analysiert die Auswirkungen männlicher Herrschaft auf die Situation der Frau.
- Internalisierende Störungen bei Frauen: Dieses Kapitel untersucht die häufigere Prävalenz von internalisierenden Störungen bei Frauen. Es wird die Frage gestellt, ob die sozialen Konstruktionen von Weiblichkeit diese Störungsbilder fördern.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Habitus, Geschlecht, Geschlechterrollen, Prävalenz, psychische Störungen, Internalisierung, Sozialisation, Risikofaktoren, Verarbeitungsmuster, Zweigeschlechtlichkeit, Geschlechterforschung.
Häufig gestellte Fragen
Warum sind Frauen häufiger von psychischen Störungen betroffen?
Statistiken zeigen höhere Prävalenzen bei Frauen für internalisierende Störungen (Ängste, Depressionen). Die Forschung sucht die Gründe hierfür sowohl in biologischen als auch in sozialen Risikofaktoren.
Welche Rolle spielt der „Habitus“ nach Pierre Bourdieu?
Der Habitus beschreibt verinnerlichte Denk- und Verhaltensmuster. Ein geschlechtsspezifischer Habitus kann dazu führen, dass Frauen im Sozialisationsprozess andere Bewältigungsstrategien (z.B. Internalisierung) entwickeln als Männer.
Was versteht man unter internalisierenden Störungen?
Internalisierende Störungen sind psychische Probleme, bei denen sich der Konflikt nach innen richtet, wie zum Beispiel bei Depressionen, Angststörungen oder Essstörungen.
Wie beeinflusst die soziale Ordnung die Gesundheit?
Die binäre Geschlechtsklassifikation und männliche Herrschaftsstrukturen prägen die soziale Welt und reproduzieren Rollenzuschreibungen, die unterschiedliche Gesundheitsrisiken für Männer und Frauen schaffen.
Welche Implikationen ergeben sich für die Psychotherapie?
Therapeuten sollten Geschlecht als soziale Dimension berücksichtigen, um geschlechtstypische Verarbeitungsmuster und die zugrunde liegenden gesellschaftlichen Erwartungen besser verstehen zu können.
- Citation du texte
- Louisa König (Auteur), 2015, Über den Zusammenhang vom Konstrukt des weiblichen Geschlechts und geschlechtspezifischer Prävalenzunterschiede von Störungsbildern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341619