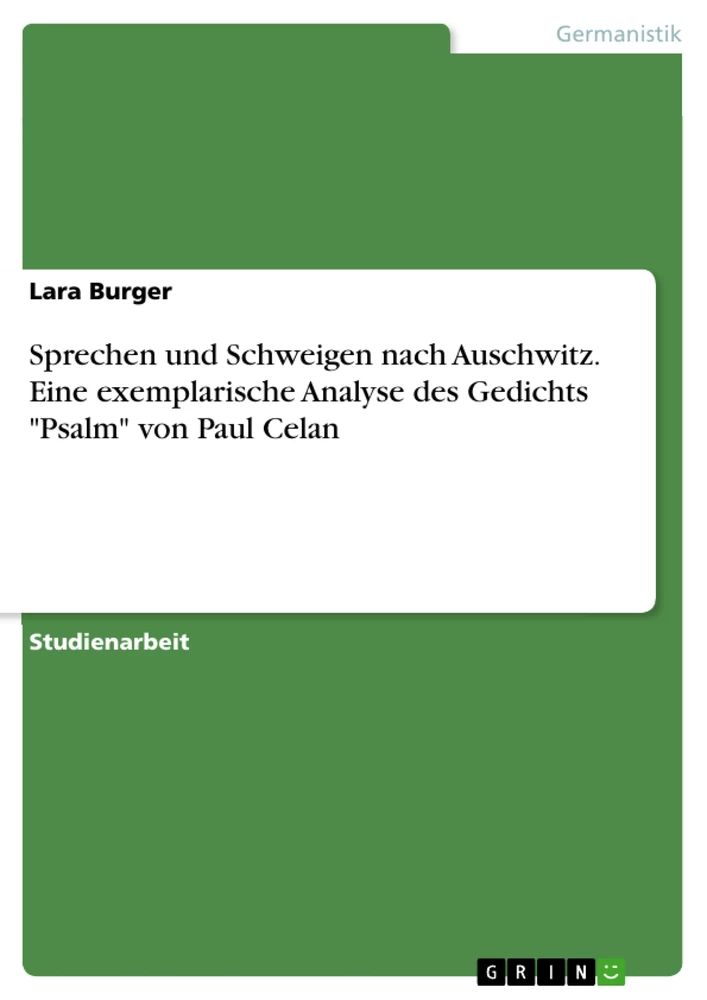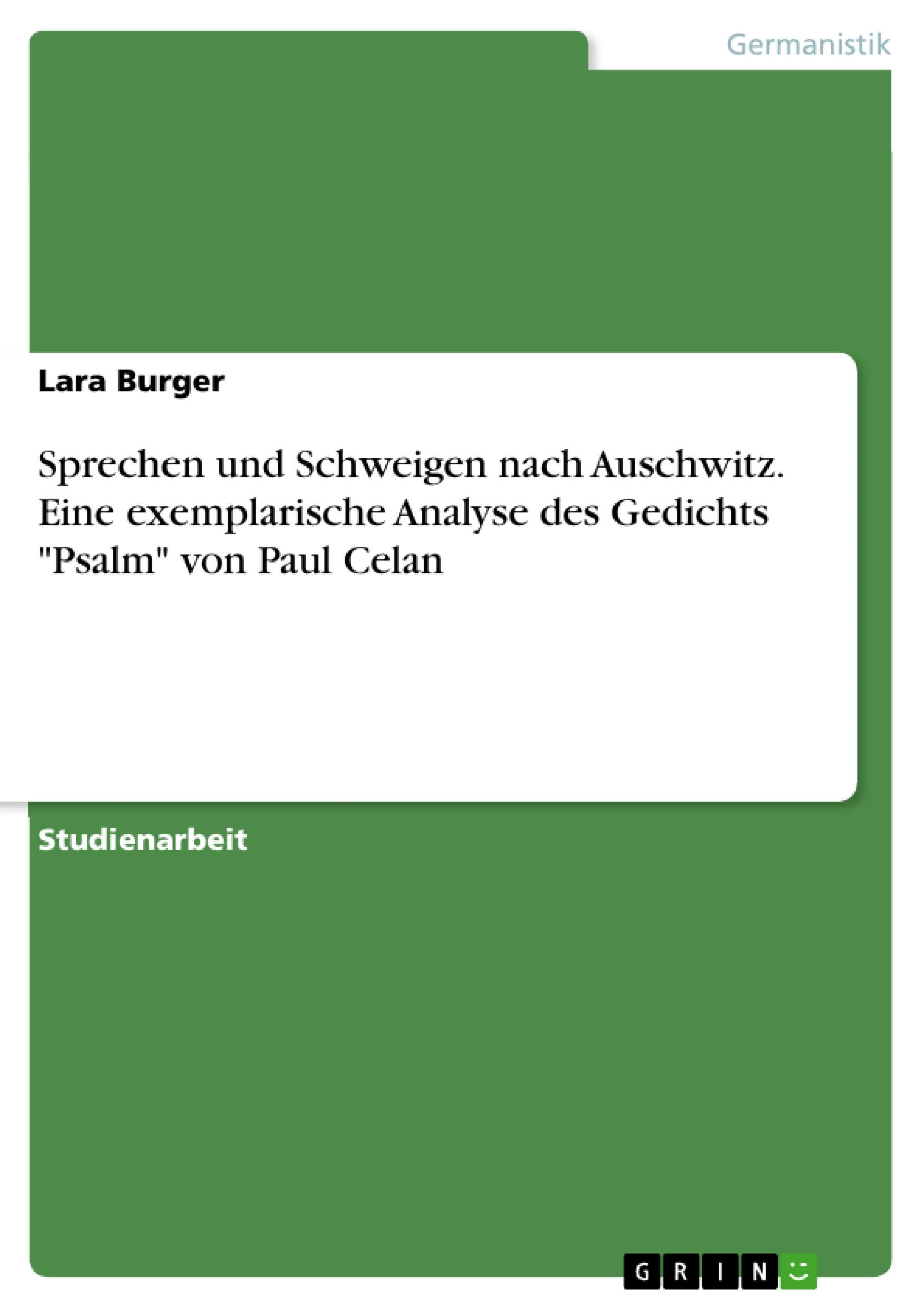Der Dichter Paul Celan zählt zu den bedeutendsten deutschsprachigen Dichtern der Nachkriegszeit. Seine verschlungene, mithin verschlossen scheinende Lyrik, mit denen er es als einer der Wenigen verstand, das Grauen des Holocaust anzusprechen, gibt der literaturwissenschaftlichen Forschung bis heute Rätsel auf. Die augenscheinlichste und für die vorliegende Arbeit zentrale Besonderheit des Celanschen Schaffens, der sich Zeit seines Lebens von einzig einem Ereignis im Januar 1942, herschrieb, ist die Tatsache, dass er trotz der vielfach in der literarischen Öffentlichkeit bekundeten Unmöglichkeit, nach Auschwitz zurück zu einer lyrischen Sprache zurück zu finden, genau das tat:
Celan fand durch die neu geschaffene Sprachidentität seiner Lyrik Worte für die grauenvolle Wirklichkeit, für das von Menschenhand begangene Verbrechen an der Menschlichkeit und verstand dabei seine Gedichte jedoch nie als Tatsachenbericht, sondern vielmehr als Daseinsentwürfe derer, die angesichts der Grauen von Auschwitz nach Antworten innerhalb finsteren Zeiten, in denen seine Lyrik entstand, suchten – ihn selbst miteingeschlossen: „Vielleicht darf man sagen, dass jedem Gedicht sein ‚20. Jänner‘ eingeschrieben bleibt? [...] Aber schreiben wir uns nicht alle von solchen Daten her? Und welchen Daten schreiben wir uns zu?“
Die vorliegende Arbeit versucht, sich einem bestimmten Gedicht Celans, dem ‚Psalm’, vor diesem Hintergrund zu nähern. Um eine Interpretation überhaupt möglich zu machen, soll zunächst die Frage nach der Möglichkeit einer Sprache nach Auschwitz und Celans Erwiderung in Form seiner ganz eigenen Dichtung hierbei im Vordergrund stehen. Eine eigene Dichtung – ein Ausdruck, der fast automatisch das Stichwort nach Hermetismus provoziert, das im Zusammenhang mit der Biographie des Dichters, dessen Überleben und zeitlebens damit verbundenes großes Schuldgefühl die Grundlage seines Schaffens bildete, im Laufe der Arbeit ebenfalls behandelt werden wird, bevor sich der letzte und größte Teil dem Versuch einer Interpretation des Gedichtes ‚Psalm’ widmet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprechen und Schweigen nach 1945
- Der Dichter Paul Celan
- Hermetische Lyrik?
- Versuch einer Interpretation
- Schlussbetrachtung
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Gedicht "Psalm" von Paul Celan und untersucht die Frage, wie der Dichter nach Auschwitz eine Sprache für das unermessliche Leid finden konnte. Die Arbeit analysiert die Besonderheiten der Celanschen Lyrik und beleuchtet die Paradoxie zwischen Sprechen und Schweigen, die im Gedicht "Psalm" deutlich wird.
- Die Möglichkeit einer Sprache nach Auschwitz
- Die Besonderheiten der Celanschen Lyrik
- Das Verhältnis von Sprechen und Schweigen im Gedicht "Psalm"
- Die Rolle des "Niemand" und des "Nichts" im Gedicht
- Die Beziehung zwischen Celans Lyrik und der Kabbala
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Einleitung stellt den Dichter Paul Celan und sein Werk im Kontext der Nachkriegszeit vor. Sie beleuchtet die Schwierigkeit, das Grauen des Holocaust in Sprache zu fassen und zeigt, wie Celan durch seine Lyrik einen neuen Weg fand, die Erfahrungen des Leidens auszudrücken.
2. Sprechen und Schweigen nach Auschwitz
Dieses Kapitel widmet sich der philosophischen und literarischen Debatte um die Möglichkeit einer Sprache nach Auschwitz. Es analysiert Theodor W. Adornos These, dass es nach Auschwitz unmöglich sei, Gedichte zu schreiben, und beleuchtet die verschiedenen Perspektiven auf diese Frage.
3. Der Dichter Paul Celan
Das Kapitel beleuchtet die Besonderheiten von Celans Lyrik und untersucht die Frage, ob seine Gedichte als "hermetische Lyrik" bezeichnet werden können. Es betrachtet Celans Biografie und die Rolle des Holocaust in seinem Werk.
4. Versuch einer Interpretation
Dieses Kapitel widmet sich der Interpretation des Gedichtes "Psalm". Es untersucht die Themen des Sprechens und Schweigens, die Bedeutung des "Niemand" und des "Nichts" im Gedicht und die Beziehung zwischen Celans Lyrik und der Kabbala.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Sprechen und Schweigen, Holocaust, Lyrik, Hermetismus, Kabbala, Paul Celan, "Psalm", "Niemand", "Nichts". Sie beleuchtet das schwierige Verhältnis zwischen Sprache und Wirklichkeit, das sich in Celans Werk besonders deutlich zeigt.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Paul Celans Lyrik so bedeutend?
Celan gilt als einer der wenigen Dichter, denen es gelang, das Grauen des Holocaust (Auschwitz) in einer neuen, verschlüsselten lyrischen Sprache auszudrücken.
Was thematisiert das Gedicht "Psalm"?
Es behandelt die Paradoxie zwischen Sprechen und Schweigen sowie die Abwesenheit Gottes, symbolisiert durch Begriffe wie "Niemand" und "Nichts".
Was bedeutet "Hermetische Lyrik" bei Celan?
Es beschreibt eine verschlossene, schwer zugängliche Dichtung, die sich einfachen Tatsachenberichten entzieht und stattdessen existenzielle "Daseinsentwürfe" bietet.
Welchen Einfluss hat die Kabbala auf Celans Werk?
Die Arbeit untersucht die mystischen Bezüge zur jüdischen Tradition (Kabbala), die Celan nutzte, um das Unaussprechliche des Leidens zu fassen.
Darf man nach Auschwitz noch Gedichte schreiben?
Die Arbeit setzt sich mit Adornos berühmter These auseinander und zeigt, wie Celan genau durch sein Schreiben eine Antwort auf diese Unmöglichkeit fand.
- Arbeit zitieren
- Lara Burger (Autor:in), 2016, Sprechen und Schweigen nach Auschwitz. Eine exemplarische Analyse des Gedichts "Psalm" von Paul Celan, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341634