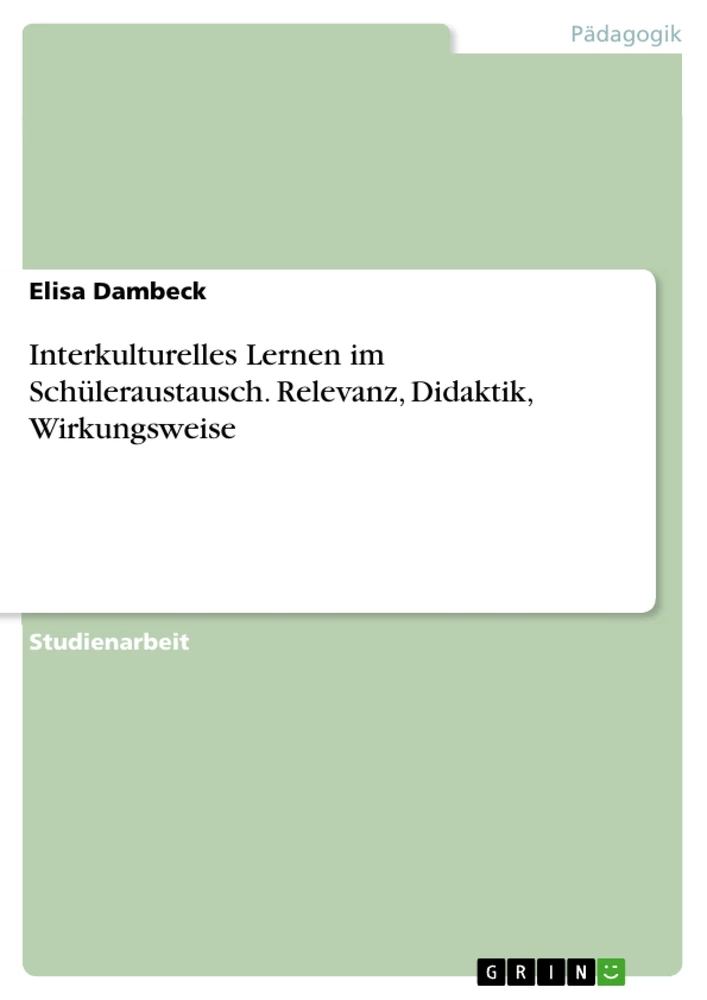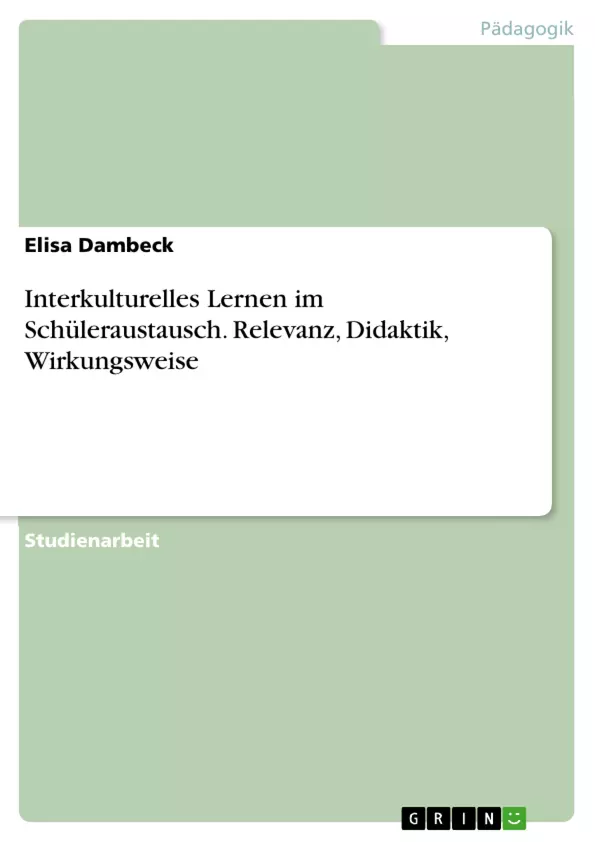Der Begriff „interkulturelle Kompetenz“ wird heutzutage unter Hochkonjunktur gebraucht und kennzeichnet sowohl die Fremdsprachendidaktik als auch die berufliche und universitäre Lehre zur Vorbereitung auf das moderne Leben unter den Bedingungen der internationalen Globalisierung und Migrationsbewegung. Interkulturelle Kompetenz gilt als ein entscheidendes Bildungsziel und wird von Erll & Gymnich (2007: 5) als „eine Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet. In Anbetracht einer zunehmenden Vernetzung über geographische, nationale, kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg, global agierender Firmen und Institutionen sowie weltweiten Reise-, Fortbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten wird die heutige Gesellschaft zunehmend mit „kultureller Diversität und Alterität“ (Antor, 2007: 111) konfrontiert. Deshalb gewinnen gerade für Berufstätige diejenigen Kompetenzen an Bedeutung, „die zur Bewältigung dieser neuen und komplexen internationalen und interkulturellen Handlungsfelder beitragen“ (Bernhard, 2002: 193). Somit entstehen im Kontext der Internationalisierung, Multikulturalität und Globalisierung neue qualifikatorische Anforderungen.
Vor diesem Hintergrund erfährt die schulische Fremdsprachendidaktik eine neue Legitimation ihrer unterrichtlichen Ausrichtung auf interkulturelles Lernen und die Ausbildung interkultureller Kompetenz. Genau damit soll sich in der vorliegenden Hausarbeit beschäftigt werden. Dazu soll interkulturelle Kompetenz zunächst als solche beleuchtet und definiert werden, um anschließend auf die Vermittlung im modernen Fremdsprachenunterricht einzugehen. Da interkulturelle Schüleraustauschprogramme als besonders fruchtbares Lernfeld gelten, soll sich der zweite Teil dieser Arbeit mit Empfehlungen einer geeigneten, didaktischen Umsetzung, der Vielfalt möglicher Austauschprogramme sowie der Wirkungsweise auf beteiligte Personen und den Austauschschüler selbst beschäftigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Interkulturelle Kompetenz
- Definition
- Umsetzung im Fremdsprachenunterricht
- Interkultureller Schüleraustausch
- Didaktische Umsetzung
- Dreiphasenmodell
- Themenorientierter Schüleraustausch
- Vielfalt
- Wirkungsweise interkultureller Schüleraustausche
- Bedeutung beteiligter Personen
- Bedeutung für teilnehmende Schüler
- Fremdsprachenkenntnisse
- Interkulturelle Kompetenz
- Persönliche Kompetenzen
- Biographische Auswirkungen
- Soziale Barrieren
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Bedeutung interkulturellen Lernens im Kontext von Schüleraustauschprogrammen. Sie beleuchtet die Relevanz interkultureller Kompetenz im 21. Jahrhundert, analysiert die didaktische Umsetzung im Fremdsprachenunterricht und erörtert die Wirkungsweise von Schüleraustauschprogrammen auf die beteiligten Personen.
- Definition und Bedeutung interkultureller Kompetenz
- Didaktische Ansätze für die Integration von interkulturellem Lernen im Fremdsprachenunterricht
- Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten von Schüleraustauschprogrammen
- Wirkungsweise von Schüleraustauschprogrammen auf die interkulturelle Kompetenz und die Persönlichkeitsentwicklung der Teilnehmer
- Soziale Barrieren und Herausforderungen im Kontext interkultureller Begegnungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz von interkultureller Kompetenz in der heutigen globalisierten Welt heraus und führt in die Thematik des Schüleraustauschs als Lernfeld für interkulturelles Lernen ein. Das erste Kapitel definiert interkulturelle Kompetenz und beleuchtet ihre Bedeutung für den Fremdsprachenunterricht. Das zweite Kapitel widmet sich der didaktischen Umsetzung von interkulturellem Lernen im Kontext von Schüleraustauschprogrammen. Es werden verschiedene Modelle und Ansätze vorgestellt, wie die Gestaltung von Austauschprogrammen die Entwicklung interkultureller Kompetenz fördern kann. Das dritte Kapitel analysiert die Wirkungsweise von Schüleraustauschprogrammen auf die beteiligten Personen, insbesondere auf die Teilnehmer selbst, und beleuchtet die Bedeutung dieser Erfahrungen für die Persönlichkeitsentwicklung und die Erweiterung der interkulturellen Kompetenz. Schließlich werden im vierten Kapitel die sozialen Barrieren und Herausforderungen im Kontext interkultureller Begegnungen diskutiert.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kompetenz, Schüleraustausch, Fremdsprachenunterricht, Didaktik, Globalisierung, Multikulturalität, interkulturelle Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, soziale Barrieren.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist interkulturelle Kompetenz heute eine Schlüsselkompetenz?
Aufgrund der Globalisierung, internationaler Zusammenarbeit und Migrationsbewegungen ist die Fähigkeit, mit kultureller Diversität umzugehen, für das Berufsleben und den Alltag unverzichtbar geworden.
Welchen Beitrag leistet der Schüleraustausch zum interkulturellen Lernen?
Er bietet ein besonders fruchtbares Lernfeld, da Schüler direkt in eine fremde Kultur eintauchen, ihre Sprachkenntnisse verbessern und Vorurteile durch persönliche Erfahrungen abbauen.
Was ist das „Dreiphasenmodell“ im Schüleraustausch?
Es beschreibt die didaktische Begleitung des Austauschs in drei Schritten: Vorbereitung, Durchführung (Begleitung vor Ort) und Nachbereitung zur Reflexion der Erfahrungen.
Welche Auswirkungen hat ein Austausch auf die Persönlichkeit der Schüler?
Neben Sprachkenntnissen fördert ein Austausch die Selbstständigkeit, das Selbstvertrauen und die Offenheit gegenüber Neuem, was oft lebenslange biographische Auswirkungen hat.
Welche sozialen Barrieren gibt es bei Schüleraustauschprogrammen?
Die Arbeit thematisiert Herausforderungen wie die Finanzierung, den Zugang für verschiedene soziale Schichten und die Bewältigung von Kulturschocks.
Wie kann interkulturelles Lernen im Fremdsprachenunterricht umgesetzt werden?
Durch die Integration von landeskundlichen Themen, Rollenspielen und der Vorbereitung auf reale Begegnungssituationen mit Muttersprachlern.
- Quote paper
- Elisa Dambeck (Author), 2016, Interkulturelles Lernen im Schüleraustausch. Relevanz, Didaktik, Wirkungsweise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341668