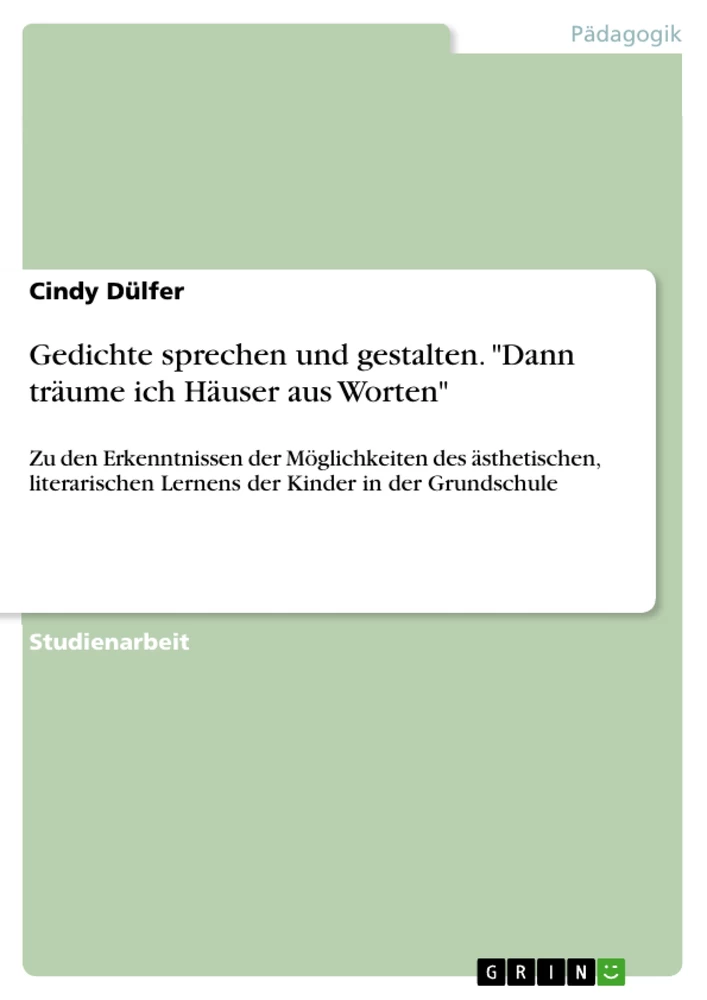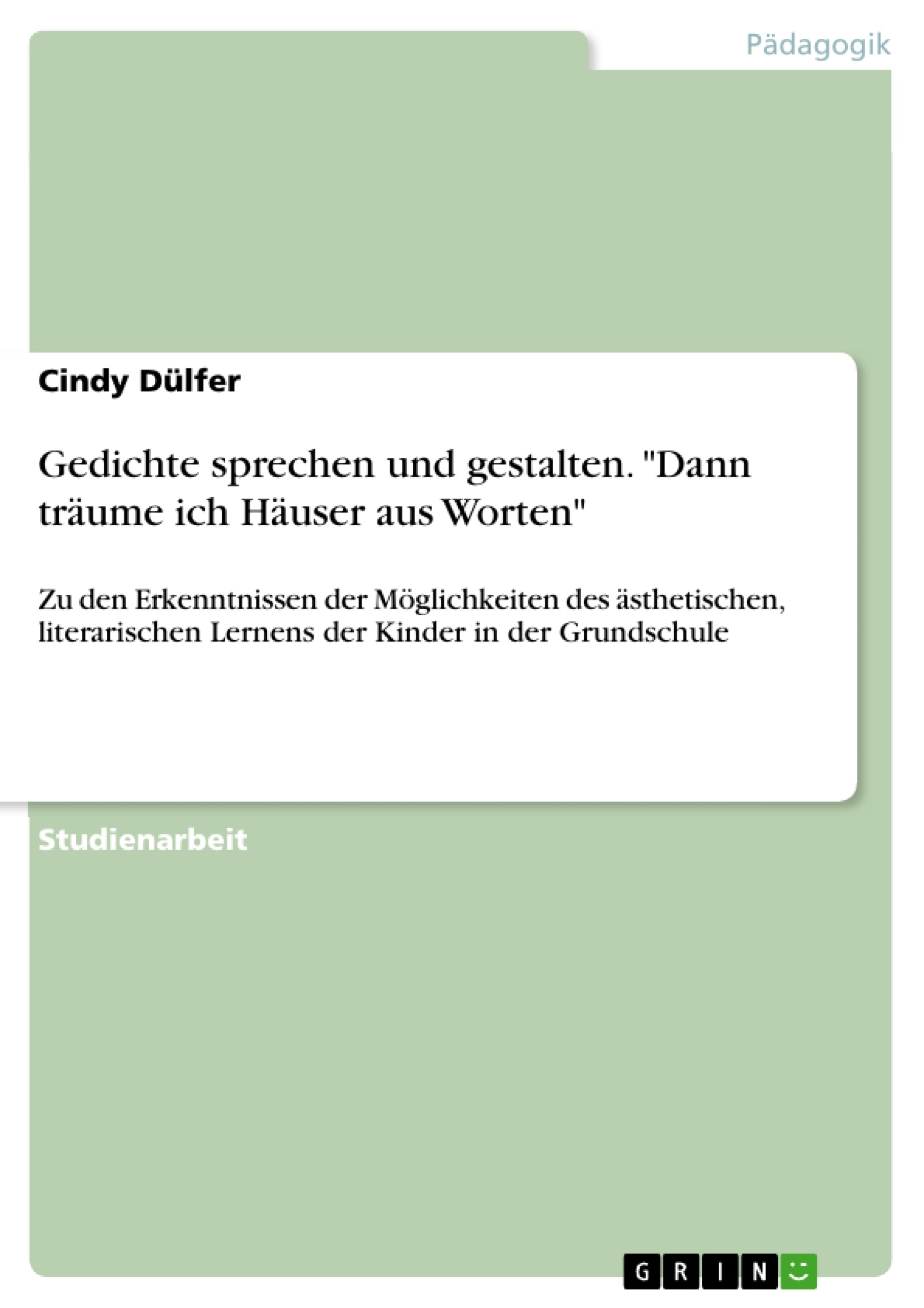„Dann träume ich mir Häuser aus Worten!“ - Ein jeder Mensch kennt Gedichte und konnte bisher unterschiedliche Erfahrungen sammeln, die sich entweder positiv oder negativ auf seine Haltung zur Lyrik ausgewirkt haben. Doch bezogen sich diese Erfahrungen zumeist grundlegend auf die aufwändige Analyse von Gedichten und ihren wenig Spielraum gewährenden Interpretationen oder auch auf das Auswendiglernen.
Dass es jedoch auch möglich ist, ästhetisch mit Gedichten zu arbeiten, offenbart eine ganz neue Perspektive auf Lyrik, die die wenigsten Menschen erfahren konnten. Die schier unbegrenzten Möglichkeiten des differenzierten Sprechens von Gedichten mit der Stimme, die unterschiedlichsten kreativen Gestaltungsformen von Gedichten und das bewusste Wahrnehmen von Worten, ihren Klängen und ihrer Bedeutung im Gedicht eröffnen einen ganz ungewohnten Zugang zu Gedichten, in welchem das Versuchen und Probieren, jedoch nicht das Besser- oder Perfektmachen im Vordergrund steht.
Dieser Zugang zur Lyrik bringt Spaß und Freude am eigenen Tun und Interesse für die Sache, dem Gedicht, hervor. Gerade aus diesen Gründen ist es wichtig, diesen Zugang auch Kindern der Grundschule zu gewähren und ihnen das Vergnügen der Sinneswahrnehmung, der Ästhetik, in der Welt der Lyrik zu schenken. Sowie Kinder als auch Erwachsene können sehr viel aus dieser Sichtweise vom Sprechen und Gestalten von Gedichten lernen und erfahren, dass sie diese nicht außen vor lassen müssen, indem sie diese auswendig lernen, sondern dass sie sie stattdessen „inwendig“ lernen und erfahren können als etwas, was Bedeutsamkeit hat und aus und mit ihnen etwas macht, während sie mit dem Gedicht arbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitender Kommentar
- Beschreibung und Reflexion der Sitzungen
- Beschreibung und Reflexion des Blocktermins am 15.01.2016
- Frage- und Austauschrunde
- Wahrnehmungsfeedback
- Exkurs zur Angst und zum Vortragen
- Beschreibung und Reflexion des Blocktermins am 16.01.2016
- Erkenntnisse aus der Einzelarbeit
- Erkenntnisse aus der Gruppenarbeit
- Beschreibung und Reflexion des Blocktermins am 17.01. 2016
- Erkenntnisse aus der Gruppenarbeit
- Erkenntnisse aus der Einzelarbeit
- Beschreibung und Reflexion des Blocktermins am 15.01.2016
- Die Gesamtreflexion
- Meine Erwartungen und Ziele bezüglich des Blockseminars
- Meine neuen Erkenntnisse / Das habe ich gelernt!
- Meine neuen Ziele
- Auswertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese reflektierende Hausarbeit zum Blockseminar „Gedichte sprechen und gestalten“ befasst sich mit der Frage, wie man einen neuen Zugang zur Lyrik erlangen kann. Sie analysiert, wie Gedichte durch unterschiedliche Sprechweisen gestaltet werden können, welche Möglichkeiten sich dabei eröffnen und was zu einem umfangreichen Sprecher-Repertoire zählt.
- Erforschung verschiedener Sprechweisen zur Gestaltung von Gedichten
- Identifizierung von Elementen, die zu einem umfassenden Sprecher-Repertoire gehören
- Reflexion der eigenen Erfahrungen mit Lyrik im Schulkontext
- Analyse der Bedeutung von Klang und Ästhetik in der Lyrik
- Untersuchung der Rolle von Emotionen und Staunen im Umgang mit Gedichten
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit beschreibt und reflektiert die Erfahrungen aus den drei Blockseminarterminen, um sich die Inhalte erneut vor Augen zu führen und zu sortieren. Der zweite Teil beinhaltet die Gesamtreflexion, in der die Erwartungen und Ziele vor dem Blockseminar, die gewonnenen Erkenntnisse und die persönliche Weiterentwicklung beleuchtet werden.
Das erste Kapitel beleuchtet die Frage- und Austauschrunde im ersten Blockseminar, die die eigene Schulzeit und die Erfahrungen mit Lyrik in den Mittelpunkt stellt. Es wird die Bedeutung des „Inwendiglernens“ gegenüber dem Auswendiglernen hervorgehoben und die Rolle von Klang und Ästhetik bei der Interpretation von Gedichten untersucht.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Wahrnehmungsfeedback, das den Studierenden die Möglichkeit gab, Gedichte vorzutragen und Feedback zu ihrer Stimme, Gestik, Mimik und Körperhaltung zu erhalten. Es werden die verschiedenen Aspekte des Sprechens und die Bedeutung von Experimenten und Kreativität im Umgang mit Gedichten hervorgehoben.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Exkurs zur Angst und zum Vortragen, der die Bedeutung von Mut und Selbstvertrauen im Zusammenhang mit der öffentlichen Präsentation von Gedichten beleuchtet. Es wird die Rolle von Angst als Hemmnis und die Notwendigkeit, sich von Gewohnheiten zu lösen, um neue Wege im Sprechen und Gestalten von Gedichten zu finden, diskutiert.
Das vierte Kapitel beschreibt die Erkenntnisse aus der Einzelarbeit im zweiten Blockseminar, die sich mit der individuellen Auseinandersetzung mit Gedichten und der Entwicklung von eigenen Interpretationen befasst. Es werden die verschiedenen Ansätze und Methoden der Einzelarbeit sowie die Bedeutung von Reflexion und Selbstreflexion im Prozess der Interpretation und Gestaltung von Gedichten hervorgehoben.
Das fünfte Kapitel behandelt die Erkenntnisse aus der Gruppenarbeit im zweiten Blockseminar, die sich mit der gemeinsamen Interpretation und Gestaltung von Gedichten in der Gruppe befasst. Es werden die verschiedenen Formen der Gruppenarbeit und die Bedeutung von Kommunikation, Austausch und Zusammenarbeit im Prozess der Interpretation und Gestaltung von Gedichten untersucht.
Das sechste Kapitel beschreibt die Erkenntnisse aus der Gruppenarbeit im dritten Blockseminar, die sich mit der Anwendung der im Seminar erlernten Methoden in der Praxis befasst. Es werden die verschiedenen Anwendungsfelder von Lyrik im Unterricht und die Bedeutung von Kreativität, spielerischem Umgang und emotionaler Ansprache bei der Vermittlung von Gedichten an Kinder hervorgehoben.
Das siebte Kapitel befasst sich mit den Erkenntnissen aus der Einzelarbeit im dritten Blockseminar, die sich mit der individuellen Reflexion der im Seminar gewonnenen Erkenntnisse und der Planung zukünftiger Aktivitäten im Bereich der Lyrik befasst. Es werden die persönlichen Ziele und Ambitionen der Studierenden im Bereich der Lyrik und die Bedeutung von kontinuierlicher Auseinandersetzung mit dem Thema hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Lyrik, Sprechen, Gestalten, Interpretation, Ästhetik, Klang, Emotionen, Staunen, Angst, Selbstvertrauen, Kreativität, Experiment, Einzelarbeit, Gruppenarbeit, Feedback, Unterricht, Kinder, Gedichte, Schulzeit, und Erfahrungen. Sie beleuchtet verschiedene Ansätze zur Gestaltung und Interpretation von Gedichten und die Bedeutung des „Inwendiglernens“ gegenüber dem Auswendiglernen.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheidet sich „Inwendiglernen“ vom klassischen Auswendiglernen?
Beim Inwendiglernen geht es darum, ein Gedicht durch intensives Sprechen, Gestalten und Erfahren so tief zu verinnerlichen, dass es eine persönliche Bedeutung gewinnt, anstatt nur Text mechanisch zu reproduzieren.
Welche Rolle spielen Stimme und Körper beim Vortragen von Gedichten?
Stimme, Mimik, Gestik und Körperhaltung sind entscheidende Werkzeuge, um die ästhetische Dimension und den Klang eines Gedichts erfahrbar zu machen und unterschiedliche Stimmungen zu erzeugen.
Warum ist ein ästhetischer Zugang zu Lyrik in der Grundschule wichtig?
Er ermöglicht Kindern einen spielerischen und freudvollen Zugang zu Sprache und Klang, jenseits von rein analytischem Druck, und fördert die Sinneswahrnehmung und Kreativität.
Was gehört zu einem umfassenden Sprecher-Repertoire?
Dazu zählen die Variation von Lautstärke, Tempo, Intonation sowie der bewusste Einsatz von Pausen und die Abstimmung zwischen sprachlichem Ausdruck und körperlicher Präsenz.
Wie kann man die Angst vor dem öffentlichen Vortragen abbauen?
Durch Experimentieren, gegenseitiges Wahrnehmungsfeedback in einem geschützten Rahmen und die Erkenntnis, dass es beim Gestalten nicht um Perfektion, sondern um den persönlichen Ausdruck geht.
- Citar trabajo
- Cindy Dülfer (Autor), 2015, Gedichte sprechen und gestalten. "Dann träume ich Häuser aus Worten", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341858