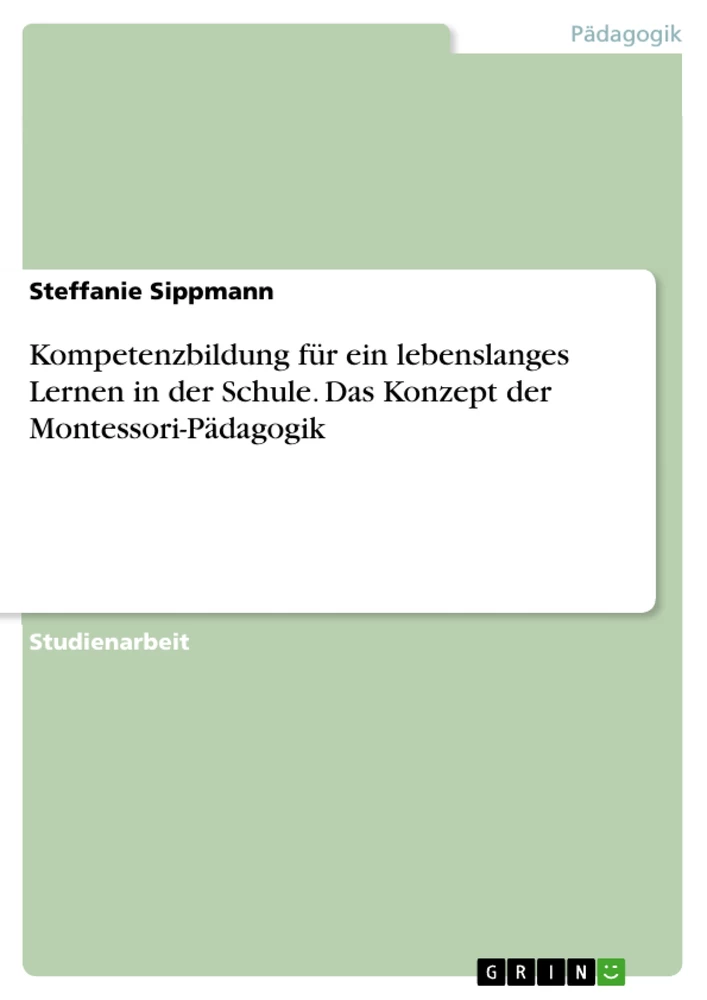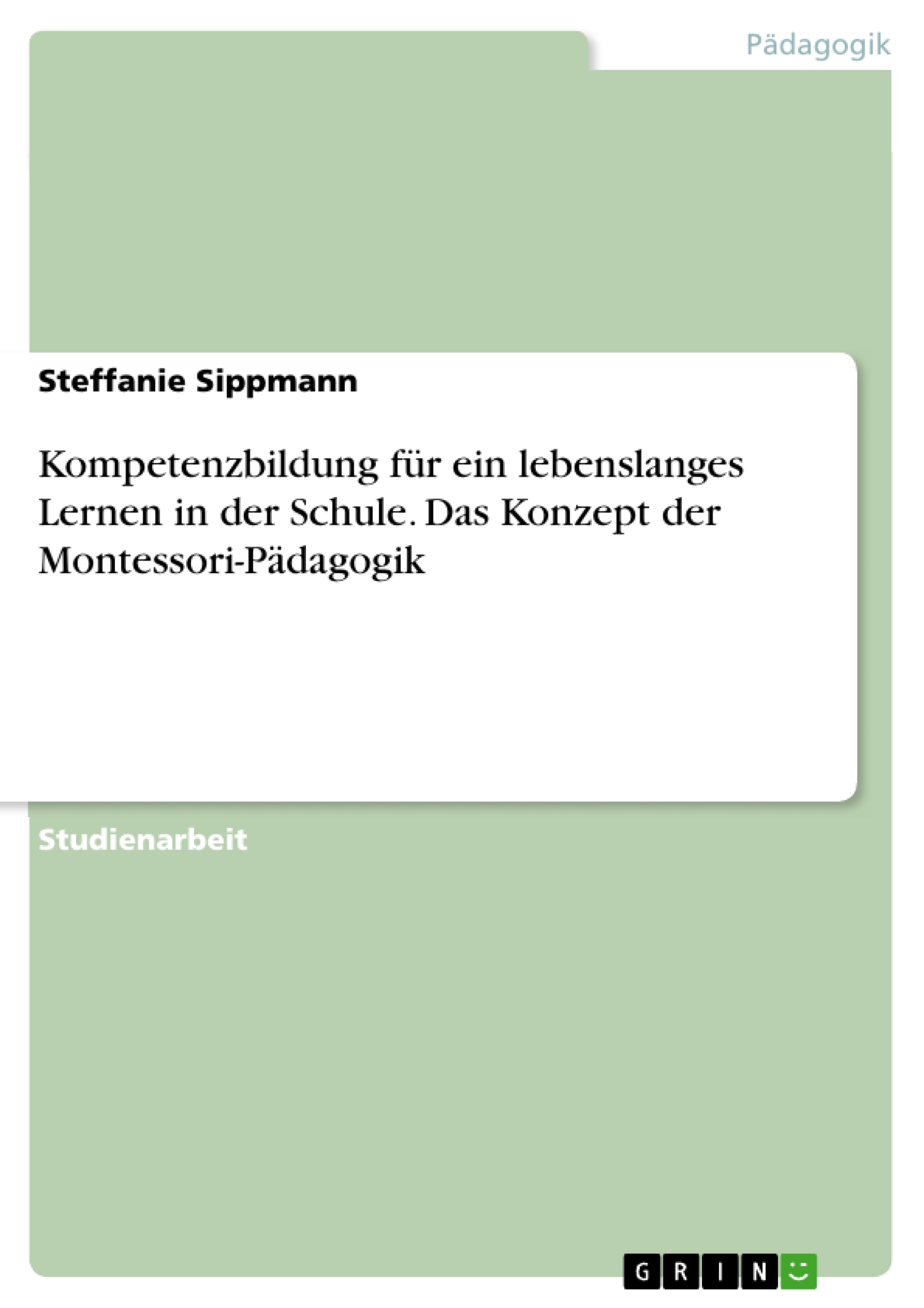In Zeiten der Globalisierung und des stetigen Fortschritts hat sich insbesondere die Arbeitswelt der heutigen westlichen Gesellschaft stark verändert, womit ihr ganz neue Herausforderungen gegenüber stehen, als noch vor wenigen hundert Jahren.
So ist die Bildung, vor allem im Sinne der Fort- und Weiterbildung, heute für eine Vielzahl der Menschen unabdingbar, um Erwerbsarbeit auf Dauer ausüben zu können, die in dieser Gesellschaft ein wichtiger Bezugspunkt oder Bestandteil des Lebensplans und Lebenssinns darstellt. Aus diesem Grund rückt auch das Konzept des Lebenslangen Lernens immer weiter in den Fokus, denn lebenslanges Lernen ist nicht mehr nur ein erstrebenswerter humboldtscher Bildungsgedanke, sondern vielmehr eine Notwendigkeit geworden.
Die Schule, als ausführende Instanz des Bildungssystems, hat unter anderem die Aufgabe, die Schüler auf eine Berufstätigkeit vorzubereiten, ihnen die nötige Allgemeinbildung und Kompetenzen zu vermitteln, um in der Arbeitswelt Fuß fassen oder auch bestehen zu können, d.h. sie soll ihre Qualifikationsfunktion erfüllen.
Nun zeigen die aktuellen PISA-Studien, die die erforderlichen Fähigkeiten und Kompetenzen von Schülern zum Ende ihrer Pflichtschulzeit prüfen, dass sich die Ergebnisse der deutschen Schülerinnen und Schüler seit PISA 2000 zwar verbessert haben, allerdings im internationalen Vergleich noch immer nur für das (inzwischen obere) Mittelfeld ausreichen. So kann der Verdacht aufkommen, dass die öffentliche Schule, die ihren Ursprung in Deutschland vor 250 Jahren und seither nur wenige Reformen durchlebt hatte, eventuell nur mäßig auf ein lebenslanges Lernen und somit auch auf eine Berufstätigkeit vorbereiten kann und Voraussetzungen dafür schafft.
Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Hausarbeit im Rahmen eines empirischen Forschungsberichts einer Einzelfallanalyse eine alternative freie Schule, die gegebenenfalls Anregungen für einen Perspektivwechsel im Bildungssystem geben kann und geht der Frage nach: Wie wirkt sich die Montessori-Pädagogik auf die Kompetenzentwicklung im Hinblick auf das Konzept des Lebenslangen Lernens aus. Hierfür wird ein problemzentriertes Interview mit einer Lernbegleiterin dieser Schule geführt und an-hand der Grounded Theory ausgewertet.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- THEORETISCHER TEIL
- Die Individualisierungstheorie nach Ulrich Beck
- Aktueller Forschungsstand
- Lebenslanges Lernen
- Montessori-Pädagogik
- Hypothesen
- EMPIRISCHER TEIL
- Das Problemzentrierte Interview nach Witzel
- Feldzugang
- Grounded Theory
- Offenes Kodieren
- Axiales Kodieren
- Selektives Kodieren
- Interpretation der Ergebnisse
- FAZIT UND AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht im Rahmen eines empirischen Forschungsberichts einer Einzelfallanalyse eine alternative freie Schule, die Montessori-Pädagogik, und beleuchtet deren Einfluss auf die Kompetenzentwicklung im Hinblick auf das Konzept des Lebenslangen Lernens. Ziel ist es, anhand eines problemzentrierten Interviews mit einer Lernbegleiterin dieser Schule und der Anwendung der Grounded Theory Erkenntnisse zu gewinnen, die einen Perspektivwechsel im Bildungssystem anregen können.
- Die Individualisierungstheorie nach Ulrich Beck als Theorierahmen
- Das Konzept des Lebenslangen Lernens im Kontext der sich wandelnden Arbeitswelt
- Die Montessori-Pädagogik als alternative Bildungseinrichtung
- Die Kompetenzentwicklung im Hinblick auf Lebenslanges Lernen
- Die Anwendung von problemzentrierten Interviews und der Grounded Theory als Forschungsmethoden
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Lebenslanges Lernen im Kontext der sich verändernden Arbeitswelt dar und führt in die Forschungsfrage ein. Der theoretische Teil beleuchtet die Individualisierungstheorie nach Ulrich Beck als Rahmen für die Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse und die Bedeutung von Bildung in diesem Kontext. Anschließend wird der aktuelle Forschungsstand zu Lebenslangem Lernen und Montessori-Pädagogik dargestellt und die Forschungslücke, die diese Arbeit untersucht, herausgearbeitet. Im empirischen Teil wird die Erhebungsmethode, das problemzentrierte Interview, sowie die Auswertungsmethode, die Grounded Theory, vorgestellt und deren praktische Anwendung erläutert. Abschließend werden die Ergebnisse interpretiert und in Kapitel 4 mit einem Fazit in Form einer Zusammenfassung und Methodenreflexion abgerundet.
Schlüsselwörter
Individualisierungstheorie, Lebenslanges Lernen, Montessori-Pädagogik, Kompetenzentwicklung, Problemzentriertes Interview, Grounded Theory, Bildungssystem, Arbeitswelt, gesellschaftlicher Wandel.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Montessori-Pädagogik?
Sie zielt darauf ab, Kinder zur Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu erziehen, wobei die Lehrkraft eher als Lernbegleiter fungiert.
Wie fördert Montessori lebenslanges Lernen?
Durch das Prinzip der freien Wahl der Arbeit entwickeln Schüler intrinsische Motivation und die Kompetenz, sich Wissen eigenständig anzueignen.
Was kritisiert die Arbeit am öffentlichen Schulsystem?
Es wird vermutet, dass traditionelle Schulen mit veralteten Strukturen nur mäßig auf die Anforderungen einer modernen, volatilen Arbeitswelt vorbereiten.
Welche Rolle spielt die Individualisierungstheorie von Ulrich Beck?
Sie dient als Rahmen, um zu erklären, warum Bildung heute für den individuellen Lebenssinn und die Erwerbsfähigkeit in einer globalisierten Welt unabdingbar ist.
Was ist die Grounded Theory in der Bildungsforschung?
Es ist eine Methode zur qualitativen Auswertung von Daten (z.B. Interviews), um daraus systematisch neue theoretische Erkenntnisse zu generieren.
- Quote paper
- Steffanie Sippmann (Author), 2015, Kompetenzbildung für ein lebenslanges Lernen in der Schule. Das Konzept der Montessori-Pädagogik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341863