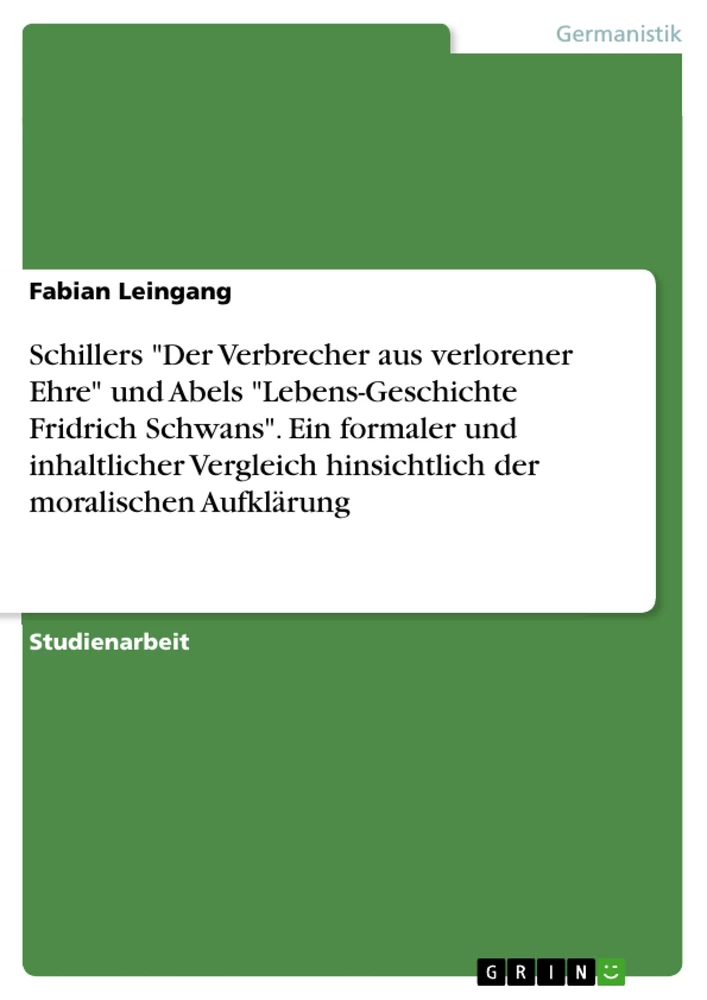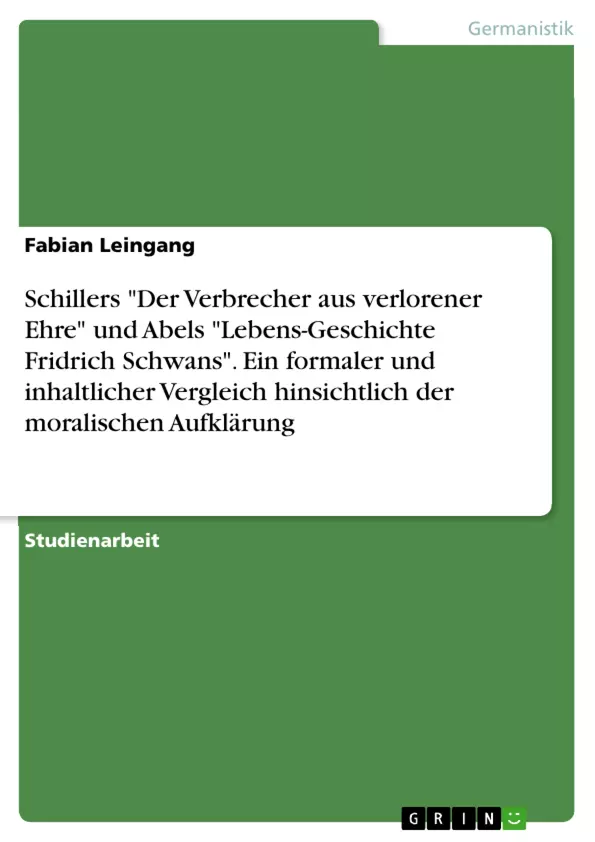„Die Richter sahen in das Buch der Gesetze, aber nicht einer in die Gemütsverfassung des Beklagten,“ so kritisiert Schiller schon zu Beginn seines Werkes die deutsche Strafrechtspflege des 18. Jahrhunderts, welche nicht nur für ihre außerordentliche Härte und Grausamkeit bekannt war, sondern auch für die fehlende Differenzierung des Strafmaßes. Das Augenmerk der Richter lag lediglich auf den jeweiligen Untaten, den Beweggründen dahinter wurde hierbei keine Beachtung geschenkt.
In dieser Zeit wurden zwei sehr verschiedene Texte veröffentlicht, welche sich beide auf dasselbe Referenzobjekt beziehen, den Fall und die Lebensgeschichte des Verbrechers Fridrich Schwan. Das erste Werk ist Der Verbrecher aus verlorener Ehre von Friedrich Schiller, welches 1786 erstmals veröffentlicht wurde, damals jedoch anonym unter dem Titel Verbrecher aus Infamie, mit dem Untertitel Eine wahre Geschichte. Bis heute gilt Schillers Text als erste Kriminalerzählung, zumindest in Deutschland. Beim zweiten Werk handelt es sich um eine Darstellung eben dieser Geschehnisse, geschrieben und publiziert von Friedrich Abel, Schillers Lehrer, welches 1787 veröffentlicht wurde und den Titel „Lebens-Geschichte Fridrich Schwans“ trägt. Beide Werke hatten die Mission das Warum hinter den Verbrechen des Fridrich Schwan zu beleuchten und sein Handeln dem Leser näher zu bringen. Jedoch geschieht dies auf sehr unterschiedliche Art und Weise.
Ziel dieser Arbeit ist es, beide Werke in ihrer Differenziertheit zu betrachten und die Auswirkungen eben dieser auf die Wirkung, welche der Leser erfährt, zu untersuchen. Es wird außerdem herausgearbeitet, welche Rolle der geneigte Leser annehmen kann. Das Hauptaugenmerk richtet sich hierbei aus Zeit- und Platzgründen auf Schillers „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“. Ein weiterer Grund für die Themenwahl ist, dass Schillers Prosawerke noch auf eine vertiefende Forschungsarbeit warten. Dazu muss noch erwähnt werden, dass nur auf einige der wichtigsten Punkte eingegangen werden kann, und nicht sämtliche Unterschiede aufgezählt werden können. Dies ist ebenfalls der kürze dieser Arbeit geschuldet.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen
- Einleitung
- Formaler Abriss und inhaltliche Analyse der Vorworte
- Inhaltlicher Vergleich und Differenzierung hinsichtlich der moralischen Aufklärung der beiden Haupttexte
- Unterschiede in den Darstellungen des Helden
- Wie die Gesellschaft Christian Wolf zum Dieb macht
- Analyse des Mordes und seiner Gründe
- Umbruch und Reue
- Wirkung des jeweiligen Endes
- Schlussteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht Schiller's "Der Verbrecher aus verlorener Ehre" und Abel's "Lebens-Geschichte Fridrich Schwans", beide basierend auf dem Fall Fridrich Schwan, hinsichtlich ihrer formalen und inhaltlichen Unterschiede im Kontext der moralischen Aufklärung. Das Hauptziel ist die Untersuchung der unterschiedlichen Wirkungen auf den Leser und die Rolle des Lesers im jeweiligen Werk. Der Fokus liegt dabei auf Schillers Erzählung.
- Formale Unterschiede zwischen Schillers und Abels Texten (Länge, Gliederung)
- Analyse der Vorworte und deren unterschiedlicher Ansprache des Lesers
- Vergleich der Darstellung des Protagonisten und seiner Entwicklung
- Untersuchung der gesellschaftlichen Einflüsse auf Schwans Handeln
- Die Rolle der moralischen Aufklärung in beiden Texten
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkungen: Dieser Abschnitt erläutert die verwendeten Textausgaben und gibt Hinweise zu möglichen Abweichungen bei anderen Ausgaben. Er betont die Verwendung der Reclam-Studienausgabe für die Primärliteratur und verweist auf die Online-Verfügbarkeit eines weiteren Dokumentes.
Einleitung: Die Einleitung kritisiert die deutsche Strafrechtspflege des 18. Jahrhunderts aufgrund ihrer Härte und fehlenden Differenzierung. Sie führt die beiden untersuchten Texte, Schillers "Der Verbrecher aus verlorener Ehre" (1786) und Abels "Lebens-Geschichte Fridrich Schwans" (1787), ein und betont deren gemeinsames Ziel: die Beleuchtung der Hintergründe von Schwans Verbrechen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Unterschiede beider Werke und deren Auswirkungen auf den Leser zu untersuchen, wobei der Schwerpunkt auf Schillers Text liegt.
Formaler Abriss und inhaltliche Analyse der Vorworte: Dieser Abschnitt vergleicht die formalen Unterschiede der beiden Texte, insbesondere die Länge und die Gliederung. Während Abels Text detailliert und in Kapitel unterteilt ist, ist Schillers Werk kürzer und weniger strukturiert. Der Vergleich der Vorworte hebt die unterschiedliche Ansprache des Lesers hervor: Abels Vorwort ist kurz und betont den lehrreichen Aspekt seines Werkes, während Schillers Vorwort länger ist und eine andere, komplexere Herangehensweise an das Thema impliziert.
Schlüsselwörter
Friedrich Schiller, Jacob Friedrich Abel, Fridrich Schwan, Kriminalerzählung, Moralische Aufklärung, 18. Jahrhundert, Rechtsprechung, Gesellschaft, Schuld, Reue, Vergleichende Literaturanalyse, Erzähltechnik.
Häufig gestellte Fragen zu: Vergleichende Analyse von Schillers "Der Verbrecher aus verlorener Ehre" und Abels "Lebens-Geschichte Fridrich Schwans"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit vergleicht Schiller's "Der Verbrecher aus verlorener Ehre" und Abels "Lebens-Geschichte Fridrich Schwans", beide basierend auf dem Fall Friedrich Schwan. Der Fokus liegt auf einem Vergleich der formalen und inhaltlichen Unterschiede beider Texte im Kontext der moralischen Aufklärung des 18. Jahrhunderts und deren unterschiedlicher Wirkung auf den Leser.
Welche Aspekte werden im Detail untersucht?
Die Analyse umfasst formale Unterschiede (Länge, Gliederung), einen Vergleich der Vorworte und deren Ansprache des Lesers, die Darstellung des Protagonisten und seiner Entwicklung, die gesellschaftlichen Einflüsse auf Schwans Handeln, und die Rolle der moralischen Aufklärung in beiden Texten. Besonderes Augenmerk liegt auf Schillers Erzählung.
Welche Texte werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht Friedrich Schillers "Der Verbrecher aus verlorener Ehre" (1786) und Jacob Friedrich Abels "Lebens-Geschichte Fridrich Schwans" (1787), beide inspiriert vom realen Fall Friedrich Schwans.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Vorbemerkungen, Einleitung, eine detaillierte inhaltliche und formale Analyse der Vorworte, einen Vergleich der beiden Texte hinsichtlich der moralischen Aufklärung (inkl. Unterschiede in der Darstellung des Helden, der gesellschaftlichen Einflüsse, des Mordes, des Umbruchs und der Reue, sowie der Wirkung des jeweiligen Endes) und einen Schlussteil.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit verwendet hauptsächlich die Reclam-Studienausgabe der Primärliteratur. Es wird auch auf ein online verfügbares Dokument verwiesen.
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist die Untersuchung der unterschiedlichen Wirkungen beider Texte auf den Leser und die Rolle des Lesers im jeweiligen Werk. Dabei wird die unterschiedliche Erzähltechnik und die verschiedenen Perspektiven auf Schuld und Reue analysiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Friedrich Schiller, Jacob Friedrich Abel, Fridrich Schwan, Kriminalerzählung, Moralische Aufklärung, 18. Jahrhundert, Rechtsprechung, Gesellschaft, Schuld, Reue, Vergleichende Literaturanalyse, Erzähltechnik.
Welche Kritik wird in der Einleitung geäußert?
Die Einleitung kritisiert die Härte und fehlende Differenzierung der deutschen Strafrechtspflege des 18. Jahrhunderts.
Wie werden die Unterschiede in der Darstellung des Protagonisten behandelt?
Die Arbeit vergleicht die Darstellung des Protagonisten Friedrich Schwan in beiden Texten, analysiert seine Entwicklung und untersucht, wie die jeweiligen Autoren die gesellschaftlichen Einflüsse auf sein Handeln darstellen.
- Quote paper
- Fabian Leingang (Author), 2016, Schillers "Der Verbrecher aus verlorener Ehre" und Abels "Lebens-Geschichte Fridrich Schwans". Ein formaler und inhaltlicher Vergleich hinsichtlich der moralischen Aufklärung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341966