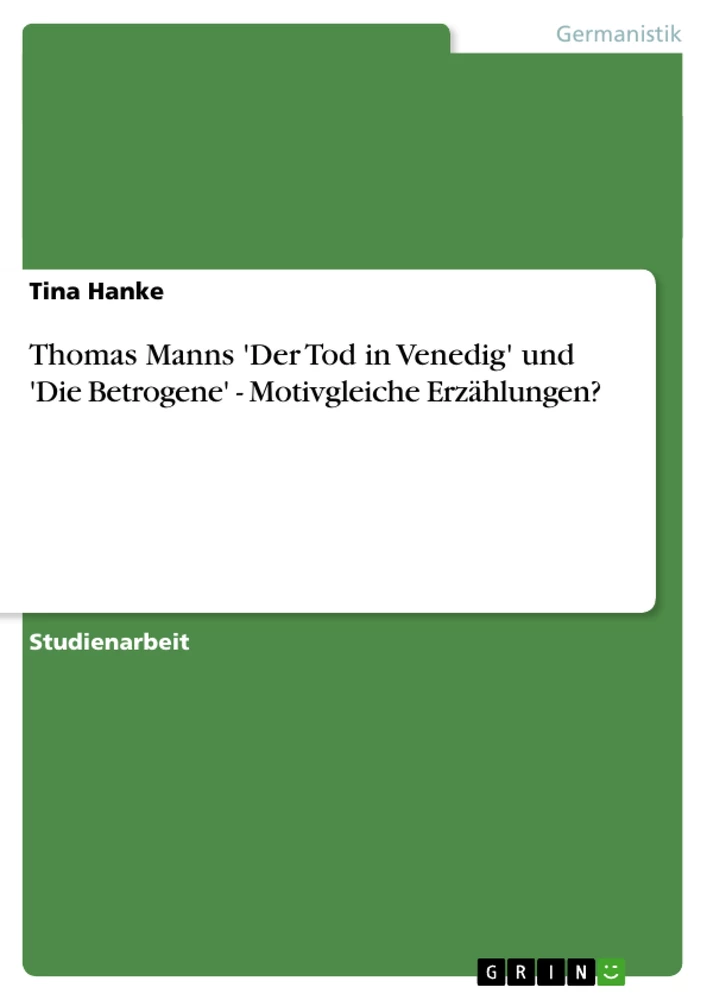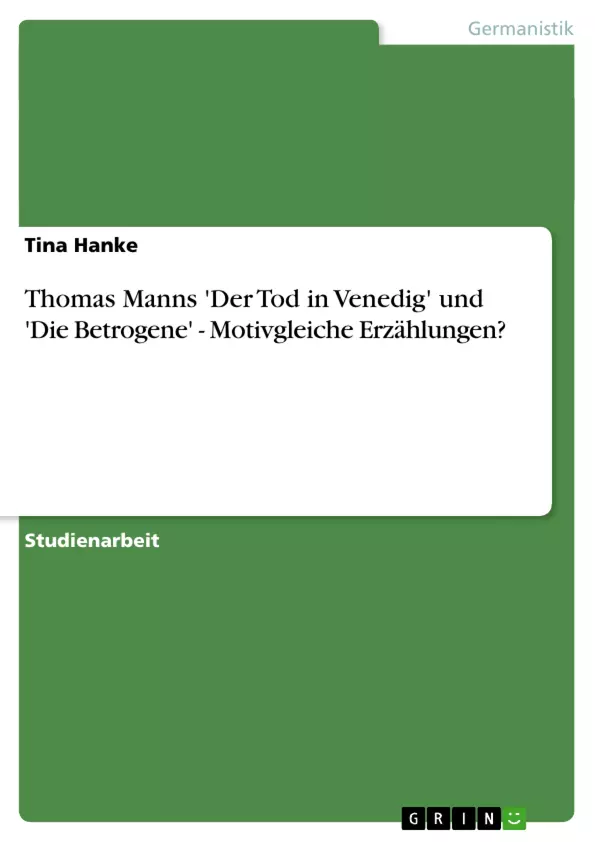Ein alternder Schriftsteller, der sich in einen jungen Knaben verliebt, auf der einen Seite, eine wechseljahrsgeplagte Naturliebhaberin, die sich in einen jungen Amerikaner verliebt, auf der anderen Seite. Die Erkenntnis, dass zum Wesen der Kunst nicht nur der Geist, sondern auch das Sinnliche gehört, als Pendant zur Erkenntnis, dass zum Wesen der Natur nicht nur das Schöne, sondern auch der Verfall gehört. Auf der einen Seite der Tod durch Cholera, auf der anderen Seite der Tod durch Gebärmutterkrebs: Kaum etwas liegt auf den ersten Blick wohl näher, als in den Novellen Der Tod in Venedig (1912) und Die Betrogene (1953) von Thomas Mann motivgleiche Erzählungen zu erkennen, auch wenn ihr Verfasser sich stets gegen Vergleiche dieser Art gewehrt hat. So schreibt Mann zu Die Betrogene: Es sind törichte Vergleiche damit angestellt worden. Mit dem „Tod in Venedig“ hat es gar nichts zu tun, weder nach seinem Gewicht, noch nach seiner Thematik. Es hat mit ihm nur gemein, daß es eben auch von mir ist, und zwar unverkennbar von mir. Gewisse Parallelen zwischen der wohl bekanntesten Erzählung von Manns Frühwerk und seiner letzten Novelle sind jedoch nicht von der Hand zu weisen. So bricht in beiden Erzählungen die Liebe rauschhaft-dionysisch in das bürgerliche Leben ein und führt zu einem Verhalten der beiden Hauptfiguren, das im großen Maße von der gesellschaftlichen Norm abweicht.
So verläuft das Leben des Schriftstellers Aschenbach in Der Tod in Venedig zunächst in sehr geregelten Bahnen. Nichts irritiert ihn in seinem immer gleichen Tagesablauf und seinem Glauben an die Macht des Geistes. Mit seiner fleißigen Arbeitsweise des „Durchhaltens“ wird er von der Gesellschaft hoch anerkannt, ja mit 50 Jahren sogar geadelt. Im Grunde weiß Aschenbach jedoch, dass es seinem Werk an Lebendigkeit mangelt respektive dass wahre Kunst nur unter Beteiligung des Sinnlichen entstehen kann. Als er dann eines Tages am Münchener Nordfriedhof einen etwas wild und exotisch aussehenden Wanderer trifft, brechen Aschenbachs unterdrückte Gefühle und Sehnsüchte hemmungslos hervor. Er entschließt sich zu einer Reise nach Venedig, wo er dem wunderschönen Knaben Tadzio verfällt. Mit dieser Liebe isoliert sich Aschenbach von der Gesellschaft. Nicht nur, dass der vierzehnjährige Tadzio vom Alter her sein Enkel sein könnte. Auch das homoerotische Moment ist von der Gesellschaft tabuisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eros und Thanatos
- Wagners Liebestod
- Tadzio und Ken als Todesboten
- Mythologische Symbolik
- Tod von Aschenbach und Rosalie
- Geist und Leben
- Apollinisches und Dionysisches bei Nietzsche
- Aschenbach und Rosalie/Anna als Vertreter des Dualismus'
- Farbsymbolik
- Tod des Künstlers
- Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Motivgleichheit der Novellen Der Tod in Venedig (1912) und Die Betrogene (1953) von Thomas Mann, indem sie die beiden Dualismen „Eros und Thanatos“ und „Geist und Leben“ sowie die zugehörige Symbolik analysiert. Ziel ist es, die Parallelen und Unterschiede zwischen den beiden Erzählungen aufzuzeigen und die innere Wandlung Thomas Manns im Laufe seines literarischen Schaffens darzustellen.
- Die Verbindung von Eros und Thanatos in Thomas Manns Werk
- Der Einfluss Richard Wagners auf Thomas Manns Werk
- Die Rolle der Liebe und des Todes im Leben der Protagonisten
- Die Symboliken der Farbsymbolik in den Erzählungen
- Der Künstler und sein Verhältnis zur Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit stellt die beiden Novellen Der Tod in Venedig und Die Betrogene vor und beschreibt die allgemeinen Parallelen zwischen den Erzählungen, die Thomas Mann trotz seiner Ablehnung von Vergleichen zwischen diesen Werken bestehen. Besonders die Liebe und das Verhältnis der Protagonisten zur Gesellschaft werden hier hervorgehoben.
Eros und Thanatos
Dieses Kapitel beleuchtet den Dualismus von Eros und Thanatos in den Novellen. Dabei wird zunächst der Einfluss Richard Wagners und dessen „Liebestod“ auf Thomas Manns Werk untersucht. Anschließend werden die Charaktere Tadzio und Ken Keaton als Todesboten sowie die mythologische Symbolik in den Novellen analysiert. Schließlich wird der Tod von Aschenbach und Rosalie im Kontext der beiden Dualismen betrachtet.
Geist und Leben
Dieses Kapitel analysiert den Dualismus von Geist und Leben in den Novellen. Es wird zunächst die Bedeutung des Apollinischen und Dionysischen bei Nietzsche für die beiden Erzählungen untersucht. Anschließend werden die Protagonisten Aschenbach und Rosalie als Vertreter des Dualismus' analysiert. Das Kapitel befasst sich zudem mit der Farbsymbolik und dem Tod des Künstlers in den Novellen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Thomas Mann, Der Tod in Venedig, Die Betrogene, Eros und Thanatos, Geist und Leben, Richard Wagner, Liebestod, Tod des Künstlers, Symbolik, Dualismus.
Welche Parallelen bestehen zwischen "Der Tod in Venedig" und "Die Betrogene"?
In beiden Erzählungen bricht die Liebe rauschhaft in ein geregeltes bürgerliches Leben ein, weicht von gesellschaftlichen Normen ab und führt letztlich zum Tod der Protagonisten.
Was symbolisiert der Dualismus von "Eros und Thanatos" bei Thomas Mann?
Er beschreibt die enge Verbindung von Begehren (Eros) und Tod (Thanatos). Die Liebe der Hauptfiguren zu jüngeren Personen wirkt als Katalysator für ihren physischen Verfall.
Welche Rolle spielt die Philosophie Nietzsches in diesen Novellen?
Mann nutzt Nietzsches Konzepte des Apollinischen (Ordnung, Geist) und des Dionysischen (Rausch, Sinnlichkeit), um den inneren Konflikt seiner Figuren darzustellen.
Wie werden Tadzio und Ken Keaton als "Todesboten" interpretiert?
Beide Jünglinge verkörpern die Schönheit, die den Protagonisten (Aschenbach und Rosalie) ihre eigene Sterblichkeit und den Mangel in ihrem bisherigen Leben vor Augen führt.
Warum wehrte sich Thomas Mann gegen den Vergleich der beiden Werke?
Mann betonte die unterschiedliche Thematik und das Gewicht der Werke, doch die literarische Analyse deckt deutliche motivische Übereinstimmungen in seinem Spätwerk auf.