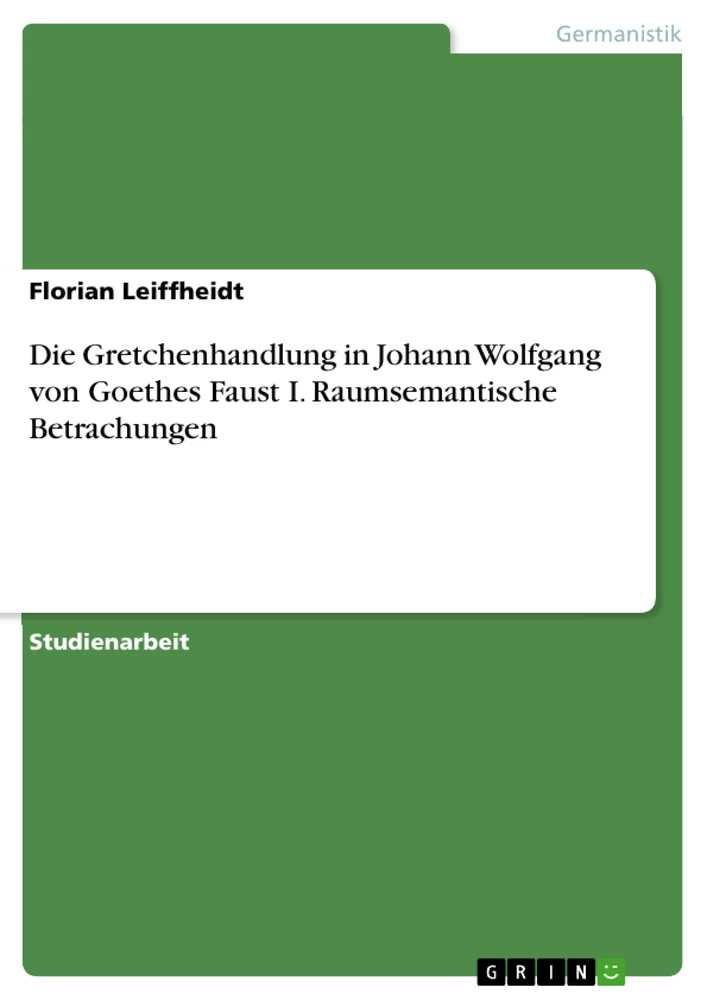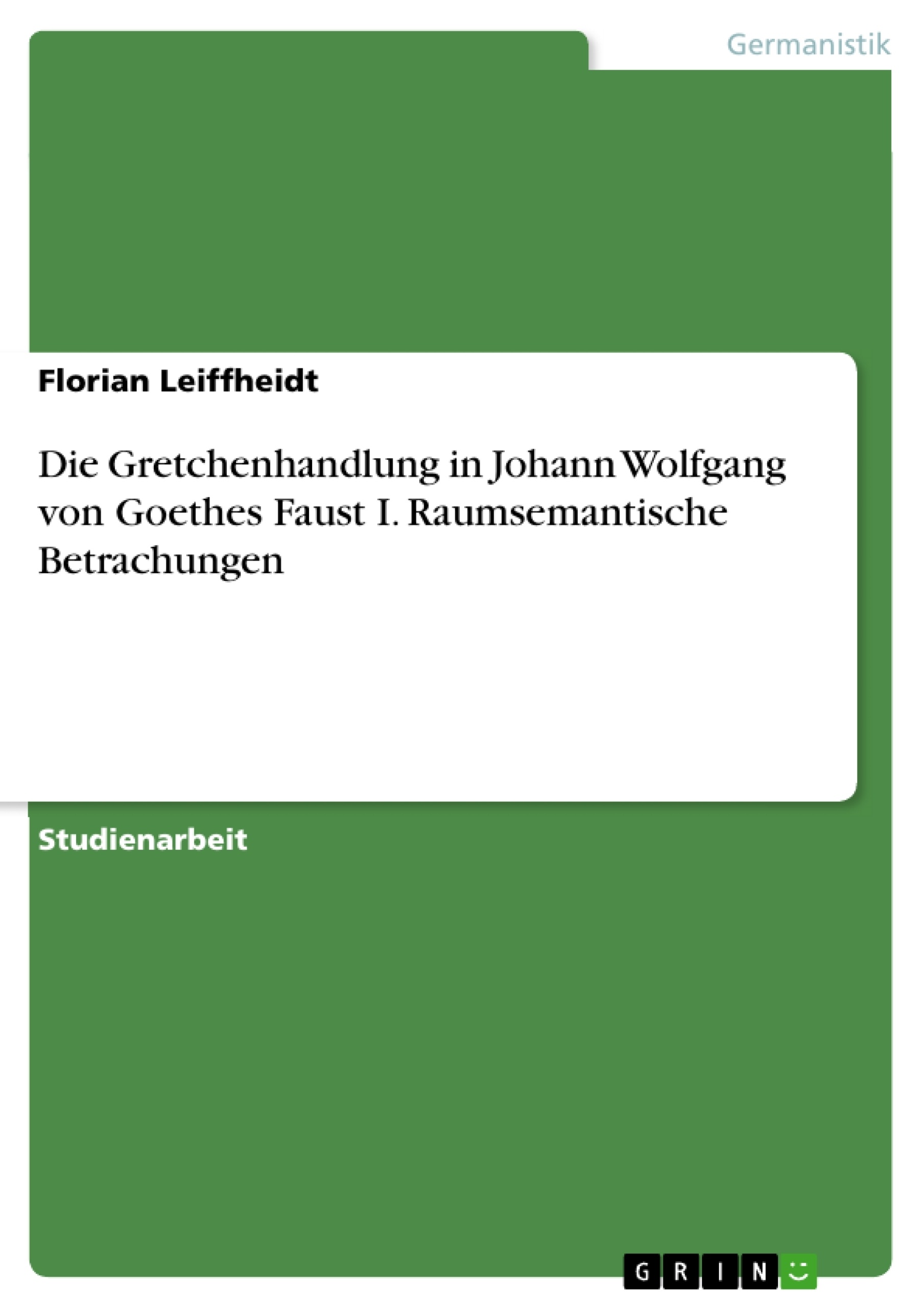„So schreitet in dem Bretterhaus / Den ganzen Kreis der Schöpfung aus, / Und wandelt mit bedächt'ger Schnelle / Vom Himmel durch die Welt zur Hölle.“ (V. 241 f.) Bereits dieses Eingangszitat aus dem Vorspiel auf dem Theater des Faust I von Johann Wolfgang von Goethe verdeutlicht die ungemeine Fülle an zu erkundenden Räumen, Plätzen und Orten innerhalb des Bühnenwerkes. Straßen, Stuben, Gärten, sakrale wie weltliche oder gar heidnisch-okkulte Schauplätze – sie alle finden ihren Platz im Drama des ewig strebenden Faust. In ihnen wird monologisiert, reflektiert und ebenso agiert wie interagiert.
Doch welche Bedeutungen besitzen die vorhandenen Räume für die in ihnen geschehenden Handlungen und die in ihnen agierenden Figuren? Welche semantischen Beziehungen lassen sich zwischen einzelnen Szenen bzw. Szenengruppen konstatieren? Entstehen letztlich die Handlungen 'lediglich' durch mögliche Überschreitungen räumlicher oder sozialer Grenzen?
Auf diese Fragen soll der vorliegende Text den Versuch einer Antwort wagen, wobei keineswegs der gesamte Faust, nicht einmal der gesamte erste Teil, sondern lediglich eine der wesentlichen Handlungen im Zentrum stehen soll: Die Handlung um Faust und Margarete, genannt Gretchen. Hierfür soll die Theorie der Raumsemantik nach Lotman auf die Gretchenhandlung angewendet werden, um mögliche (raum)semantische Bezüge innerhalb des Handlungsverlaufes ausmachen und darstellen zu können.
Hierzu soll zunächst in einem theoretischen Abschnitt sowohl die Raumsemantik nach Lotman erläutert als auch an einem Beispiel veranschaulicht werden. Anschließend folgen Aussagen zur Gretchenhandlung und ihrem Inhalt innerhalb des Faust I. Im Zentrum des Textes soll ein raumsemantischer Streifzug durch die Gretchenhandlung stehen, dessen Ziel es sein ist, anhand beispielhafter Szenen semantische Beziehungen gemäß der Theorie von Lotman zu beschreiben und durch Sekundärliteratur zu belegen. An die Betrachtungen raumsemantischer Art schließt sich eine Betrachtung der Gretchenhandlung unter dem Aspekt der Grenzüberschreitungen an. Schließlich werden die durch diesen Text erlangten Einsichten noch einmal zusammenfassend und abschließend formuliert. Einsichten in ein Thema, möglicherweise aber auch neue Einsichten in alte, seit langem bestehende Räume.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Vorbemerkungen
- Raumsemantik nach LOTMAN
- Handlung als Grenzüberschreitung
- Inhalt der Gretchenhandlung innerhalb des Faust I
- Raumsemantische Betrachtungen innerhalb der Gretchenhandlung
- Stadt, Garten, Natur - eine raumsemantische Trias?
- Privatheit und Öffentlichkeit als raumsemantische Opposition
- Grenzüberschreitungen im Verlauf der Gretchenhandlung
- Faust
- Margarete/Gretchen
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text untersucht die Gretchenhandlung in Goethes Faust I unter Anwendung der Raumsemantik nach Lotman. Ziel ist es, die Bedeutung von Raum und räumlichen Beziehungen für die Handlung und die Figuren zu analysieren und die Rolle von Grenzüberschreitungen im Handlungsverlauf herauszuarbeiten.
- Raumsemantische Analyse der Gretchenhandlung
- Bedeutung räumlicher Oppositionen (z.B. öffentlich/privat)
- Grenzüberschreitungen als handlungskonstituierendes Element
- Semantische Beziehungen zwischen verschiedenen Szenen
- Anwendung der Lotmanschen Theorie auf ein literarisches Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und benennt die Forschungsfrage: Welche Bedeutung haben Räume und räumliche Grenzüberschreitungen für die Gretchenhandlung in Goethes Faust I? Der Text kündigt die Anwendung der Raumsemantik nach Lotman an und skizziert den methodischen Aufbau. Ein Zitat aus dem Vorspiel auf dem Theater unterstreicht die Bedeutung von Räumen im gesamten Werk.
Theoretische Vorbemerkungen: Dieses Kapitel erläutert die Raumsemantik nach Lotman. Lotman erweitert den Raumbegriff über die reine Topographie hinaus und betont die semantische Aufladung von Räumen mit verschiedenen Bedeutungsebenen (sozial, religiös, politisch). Er beschreibt die Bedeutung von Oppositionen (z.B. hoch/niedrig, offen/geschlossen) und wie diese semantisch aufgeladen werden. Der zweite Unterabschnitt beleuchtet die Grenzüberschreitung als handlungskonstituierendes Element. Hier wird argumentiert, dass Handlung oft durch das Überschreiten räumlicher oder sozialer Grenzen entsteht, was anhand von Beispielen illustriert wird, wie der Balkonszene in Romeo und Julia.
Inhalt der Gretchenhandlung innerhalb des Faust I: (Annahme: Dieses Kapitel beschreibt den Handlungsverlauf der Gretchenhandlung im Detail, ohne Raumsemantik.) Eine Zusammenfassung dieses Kapitels würde den Handlungsverlauf der Gretchenhandlung in Faust I detailliert beschreiben, die wichtigsten Ereignisse und Beziehungen zwischen den Figuren nachzeichnen, und den Platz der Handlung innerhalb des Gesamtwerkes beleuchten. Der Fokus liegt dabei auf der narrativen Struktur und den zentralen Ereignissen der Handlung.
Raumsemantische Betrachtungen innerhalb der Gretchenhandlung: Dieses Kapitel analysiert die Gretchenhandlung unter raumsemantischen Gesichtspunkten. Es untersucht die verschiedenen Schauplätze (Stadt, Garten, Kirche, etc.) und deren jeweilige Bedeutung im Kontext der Handlung. Der Fokus liegt auf der Analyse semantischer Oppositionen und deren Funktion für die Deutung der Handlung. Die Analyse wird anhand konkreter Beispiele aus dem Text illustriert.
Grenzüberschreitungen im Verlauf der Gretchenhandlung: Dieses Kapitel untersucht die Grenzüberschreitungen, die sowohl von Faust als auch von Gretchen vollzogen werden. Die Analyse beleuchtet die verschiedenen Arten von Grenzüberschreitungen (räumlich, sozial, moralisch) und deren Konsequenzen für die Handlung. Es wird herausgearbeitet wie diese Überschreitungen zur Handlung beitragen und die Tragik der Geschichte formen.
Schlüsselwörter
Raumsemantik, Lotman, Goethe, Faust I, Gretchenhandlung, Grenzüberschreitung, Handlung, Raum, Semantik, Opposition, Privatheit, Öffentlichkeit, Literaturwissenschaft, Literaturanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Raumsemantischen Analyse der Gretchenhandlung in Goethes Faust I
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Gretchenhandlung in Goethes Faust I unter Anwendung der Raumsemantik nach Jurij Lotman. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Raum und räumlichen Beziehungen für die Handlung und die Figuren sowie auf der Rolle von Grenzüberschreitungen im Handlungsverlauf.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet die Raumsemantik nach Lotman als analytisches Werkzeug. Lotmans Theorie erweitert den Raumbegriff über die reine Topographie hinaus und betont die semantische Aufladung von Räumen mit verschiedenen Bedeutungsebenen (sozial, religiös, politisch). Die Analyse untersucht semantische Oppositionen (z.B. öffentlich/privat) und Grenzüberschreitungen als handlungskonstituierende Elemente.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, theoretische Vorbemerkungen (inkl. Erläuterung der Raumsemantik nach Lotman und Grenzüberschreitung als Handlungselement), eine Beschreibung des Inhalts der Gretchenhandlung, eine raumsemantische Betrachtung der Gretchenhandlung (inkl. Analyse von Räumen wie Stadt, Garten, Natur), eine Analyse der Grenzüberschreitungen bei Faust und Gretchen und abschließende Schlussbemerkungen.
Welche konkreten Fragestellungen werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung räumlicher Oppositionen (z.B. öffentlich/privat) innerhalb der Gretchenhandlung, die Rolle von Grenzüberschreitungen (räumlich, sozial, moralisch) als handlungskonstituierendes Element, die semantischen Beziehungen zwischen verschiedenen Szenen und die Anwendung der Lotmanschen Theorie auf ein literarisches Werk.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Raumsemantik, Lotman, Goethe, Faust I, Gretchenhandlung, Grenzüberschreitung, Handlung, Raum, Semantik, Opposition, Privatheit, Öffentlichkeit, Literaturwissenschaft, Literaturanalyse.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird geboten?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über die einzelnen Abschnitte der Arbeit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage. Die theoretischen Vorbemerkungen erläutern die Raumsemantik nach Lotman. Das Kapitel zum Inhalt der Gretchenhandlung beschreibt den Handlungsverlauf. Die raumsemantische Betrachtung analysiert die verschiedenen Schauplätze und ihre Bedeutung. Das Kapitel zu Grenzüberschreitungen untersucht die von Faust und Gretchen vollzogenen Grenzüberschreitungen und deren Konsequenzen. Die Schlussbemerkungen fassen die Ergebnisse zusammen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Bedeutung von Raum und räumlichen Beziehungen für die Handlung und die Figuren in der Gretchenhandlung zu analysieren und die Rolle von Grenzüberschreitungen im Handlungsverlauf herauszuarbeiten. Es soll gezeigt werden, wie die Raumsemantik nach Lotman zur Interpretation literarischer Texte angewendet werden kann.
- Citation du texte
- Florian Leiffheidt (Auteur), 2016, Die Gretchenhandlung in Johann Wolfgang von Goethes Faust I. Raumsemantische Betrachungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342100