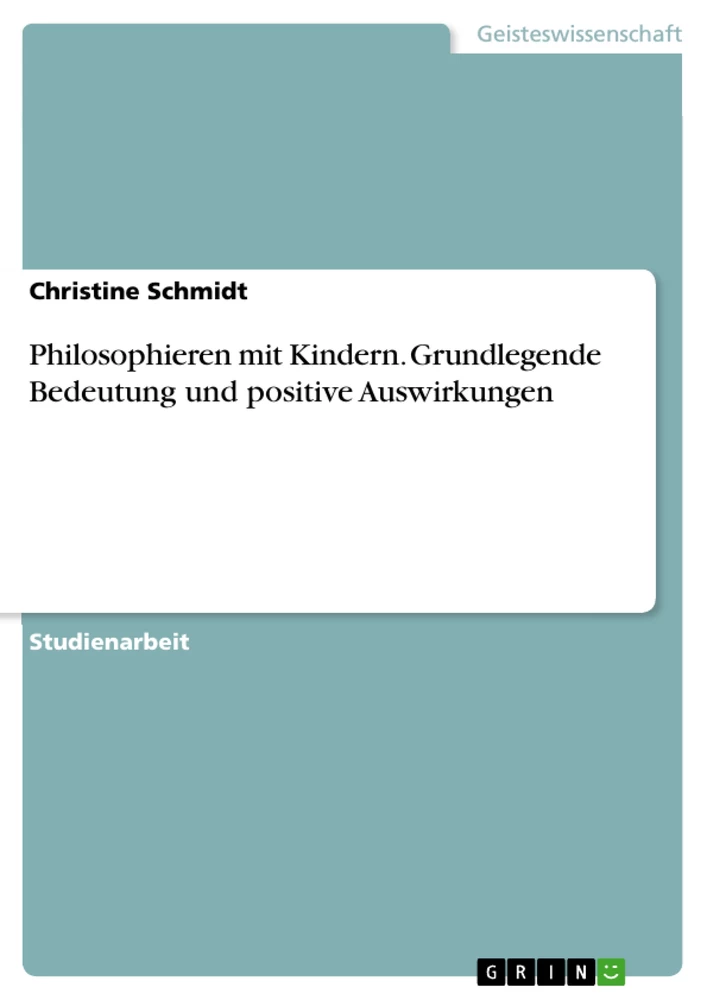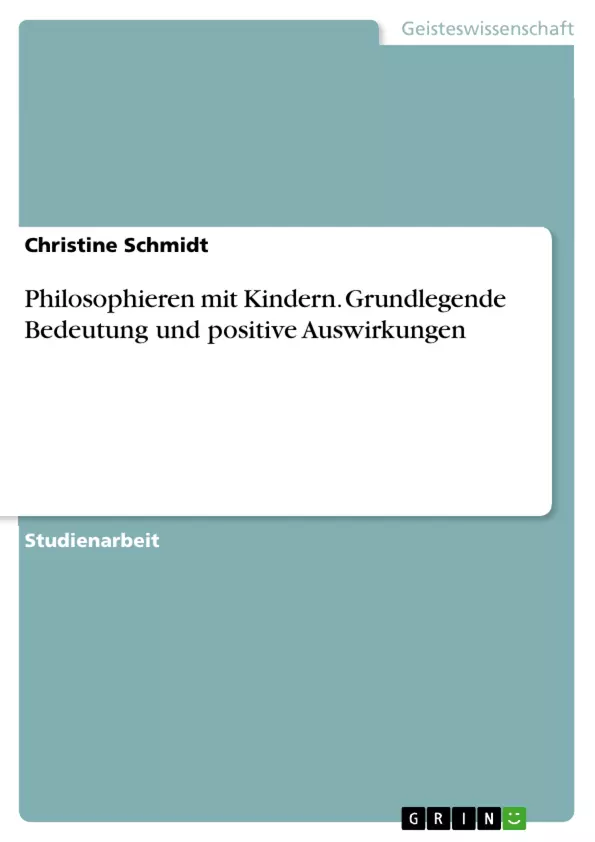Kinder und Philosophie – diese beiden Begrifflichkeiten könnten auf den ersten Blick kaum weiter voneinander entfernt liegen. Die Philosophie, die den Ruf einer komplexen abstrakten Wissenschaft hat und sich höchstens für gebildete und lebenserfahrene Menschen eignet, passt scheinbar nicht in die Lebenswelt eines Kindes. Historisch betrachtet lässt sich ein gewisser Hype Anfang der 1990er Jahre feststellen, als der philosophische Kinder- und Jugendroman „Sophies Welt“ publiziert wurde und das Thema Philosophie für Kinder und Jugendliche in der Öffentlichkeit populär machte. Dazu kam überdies, dass sinnvolle Alternativen zum konventionellen Religionsunterricht angeboten werden mussten, sodass der Ethikunterricht mitsamt seiner Teildisziplin des Philosophierens und der Werte- und Normenerziehung Einzug in das Leben vieler Jugendlicher und Kinder hielt.
Im Zuge der vergangenen reformpädagogischen Welle begegnete man Kindern wie kleinen Erwachsenen, begann sie ernst zu nehmen und sich mehr für ihre ganz eigene und besondere Denkweise zu interessieren. Es gab darum wachsende Bemühungen, Kindern philosophisches Gedankengut näherzubringen. Wichtige Meilensteine in diesem Bereich sind auf deutscher Seite insbesondere den Ansätzen von Ekkehard Martens, Helmut Schreier und Hans-Ludwig Fresse und denen der beiden amerikanischen Philosophen Matthew Lipman und Gareth B. Matthew zu Beginn der 1970er Jahre zu verdanken.
Die Ausarbeitung beginnt mit einem einleitenden Teil, in welchem kurz sowohl die grundlegende Bedeutung als auch die positiven Auswirkungen der Kinderphilosophie vorgestellt werden sollen. Ein Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Frage, ob Kinder überhaupt philosophieren können und sollen. Im Hinblick auf die dargelegten Elemente erfolgt anschließend ein Einblick in die didaktische Umsetzung im Kindergarten anhand des philosophischen Themas der Freundschaft. Es soll aufgezeigt werden, wie konkret mit Kindern philosophisch gearbeitet werden kann, um sie zu einer Einsicht zu führen. Zum Abschluss wird die gesamte Thematik kritisch beleuchtet und mit einer Schlussbetrachtung abgerundet.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Bedeutung des Philosophierens mit Kindern
- 2.1 Ziele des Philosophierens
- 3 Können Kinder Philosophen sein?
- 4 Philosophieren in der Praxis – vom Fragen zur Umsetzung
- 4.1 Zum Philosophieren über die Freundschaft
- 5 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung und Praxis des Philosophierens mit Kindern, insbesondere im Kontext der Freundschaft. Sie beleuchtet die Frage nach der Fähigkeit von Kindern zum philosophischen Denken und analysiert didaktische Ansätze zur Umsetzung im Kindergarten. Der Fokus liegt auf der gemeinsamen, dialogischen Erkundung philosophischer Fragen und der Förderung der kindlichen Entwicklung.
- Bedeutung und Praxis des Philosophierens mit Kindern
- Fähigkeit von Kindern zum philosophischen Denken
- Didaktische Ansätze zur Umsetzung im Kindergarten
- Philosophie der Freundschaft im Kontext der Kinderphilosophie
- Förderung von Sprachentwicklung, Kreativität und sozialer Kompetenz
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die scheinbar gegensätzliche Verbindung von Kindern und Philosophie dar und beleuchtet den historischen Kontext, der zu einem verstärkten Interesse am Philosophieren mit Kindern führte. Sie erwähnt den Einfluss von „Sophies Welt“ und die Notwendigkeit von Alternativen zum Religionsunterricht. Die Arbeit wird kurz umrissen, mit dem Schwerpunkt auf der Frage der Fähigkeit von Kindern zum Philosophieren und der didaktischen Umsetzung am Beispiel der Freundschaft.
2 Bedeutung des Philosophierens mit Kindern: Dieses Kapitel definiert "Philosophieren mit Kindern" und differenziert zwischen verschiedenen Begriffen wie "Kinderphilosophie" und "Philosophie für Kinder". Es betont den Ansatz von Gareth B. Matthew, der das Philosophieren als gemeinsame Tätigkeit von Kindern und Erwachsenen sieht, die durch methodisches Denken und Argumentieren zu Erkenntnissen gelangt. Der Fokus liegt nicht auf der wissenschaftlichen Philosophie, sondern auf dem eigenständigen Nachdenken über philosophische Fragen des Lebens.
2.1 Ziele des Philosophierens: Dieses Kapitel beschreibt die positiven Auswirkungen des Philosophierens auf Kinder: kritische Hinterfragung von Selbstverständlichkeiten, Förderung der autonomen Persönlichkeit, Entwicklung der Sprachfähigkeit und Kreativität. Es betont die Förderung sozialer Kompetenz, demokratischer Erziehung, Toleranz und Empathiefähigkeit. Der Spaß am gemeinsamen dialogischen Denken, Reflektieren und dem Finden von Lösungen wird hervorgehoben. Der wettkämpferische Aspekt philosophischer Debatten und die Notwendigkeit der Anleitung durch Erwachsene werden ebenfalls angesprochen.
Schlüsselwörter
Kinderphilosophie, Philosophie für Kinder, Philosophieren mit Kindern, didaktische Umsetzung, Freundschaft, methodisches Denken, Argumentation, soziale Kompetenz, Sprachentwicklung, Kreativität, demokratische Erziehung, Toleranz, Empathie.
Häufig gestellte Fragen zu: Philosophieren mit Kindern - Eine Einführung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung und Praxis des Philosophierens mit Kindern, insbesondere im Kontext der Freundschaft. Sie beleuchtet die Frage nach der Fähigkeit von Kindern zum philosophischen Denken und analysiert didaktische Ansätze zur Umsetzung im Kindergarten. Der Fokus liegt auf der gemeinsamen, dialogischen Erkundung philosophischer Fragen und der Förderung der kindlichen Entwicklung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung und Praxis des Philosophierens mit Kindern, die Fähigkeit von Kindern zum philosophischen Denken, didaktische Ansätze zur Umsetzung im Kindergarten, die Philosophie der Freundschaft im Kontext der Kinderphilosophie sowie die Förderung von Sprachentwicklung, Kreativität und sozialer Kompetenz.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, die den Kontext und die Forschungsfrage darstellt. Es folgt ein Kapitel zur Bedeutung des Philosophierens mit Kindern, unterteilt in die Ziele des Philosophierens. Ein weiteres Kapitel widmet sich der Frage, ob Kinder Philosophen sein können, gefolgt von einem Kapitel zur praktischen Umsetzung des Philosophierens mit Kindern, am Beispiel der Freundschaft. Die Arbeit schließt mit einer Schlussbetrachtung.
Was versteht man unter "Philosophieren mit Kindern"?
Die Arbeit definiert "Philosophieren mit Kindern" und differenziert zwischen verschiedenen Begriffen wie "Kinderphilosophie" und "Philosophie für Kinder". Es betont den Ansatz von Gareth B. Matthew, der das Philosophieren als gemeinsame Tätigkeit von Kindern und Erwachsenen sieht, die durch methodisches Denken und Argumentieren zu Erkenntnissen gelangt. Der Fokus liegt nicht auf der wissenschaftlichen Philosophie, sondern auf dem eigenständigen Nachdenken über philosophische Fragen des Lebens.
Welche Ziele werden durch das Philosophieren mit Kindern verfolgt?
Das Philosophieren mit Kindern soll die kritische Hinterfragung von Selbstverständlichkeiten, die Förderung der autonomen Persönlichkeit, die Entwicklung der Sprachfähigkeit und Kreativität unterstützen. Es fördert soziale Kompetenz, demokratische Erziehung, Toleranz und Empathiefähigkeit. Der Spaß am gemeinsamen dialogischen Denken, Reflektieren und dem Finden von Lösungen steht im Vordergrund.
Wie wird das Philosophieren mit Kindern in der Praxis umgesetzt?
Die Arbeit analysiert didaktische Ansätze zur Umsetzung des Philosophierens mit Kindern im Kindergarten. Ein Beispiel hierfür ist die Auseinandersetzung mit der Thematik Freundschaft. Es wird betont, dass das Philosophieren mit Kindern eine Anleitung durch Erwachsene benötigt, um einen konstruktiven und gewinnbringenden Dialog zu ermöglichen. Der wettkampforientierte Aspekt philosophischer Debatten wird ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Kinderphilosophie, Philosophie für Kinder, Philosophieren mit Kindern, didaktische Umsetzung, Freundschaft, methodisches Denken, Argumentation, soziale Kompetenz, Sprachentwicklung, Kreativität, demokratische Erziehung, Toleranz und Empathie.
Welche Bedeutung hat die Freundschaft im Kontext der Kinderphilosophie?
Die Freundschaft dient in dieser Arbeit als Beispielthema für die praktische Umsetzung des Philosophierens mit Kindern. Die Auseinandersetzung mit philosophischen Fragen rund um die Freundschaft soll die Entwicklung der Kinder auf verschiedenen Ebenen fördern.
- Quote paper
- Christine Schmidt (Author), 2015, Philosophieren mit Kindern. Grundlegende Bedeutung und positive Auswirkungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342146