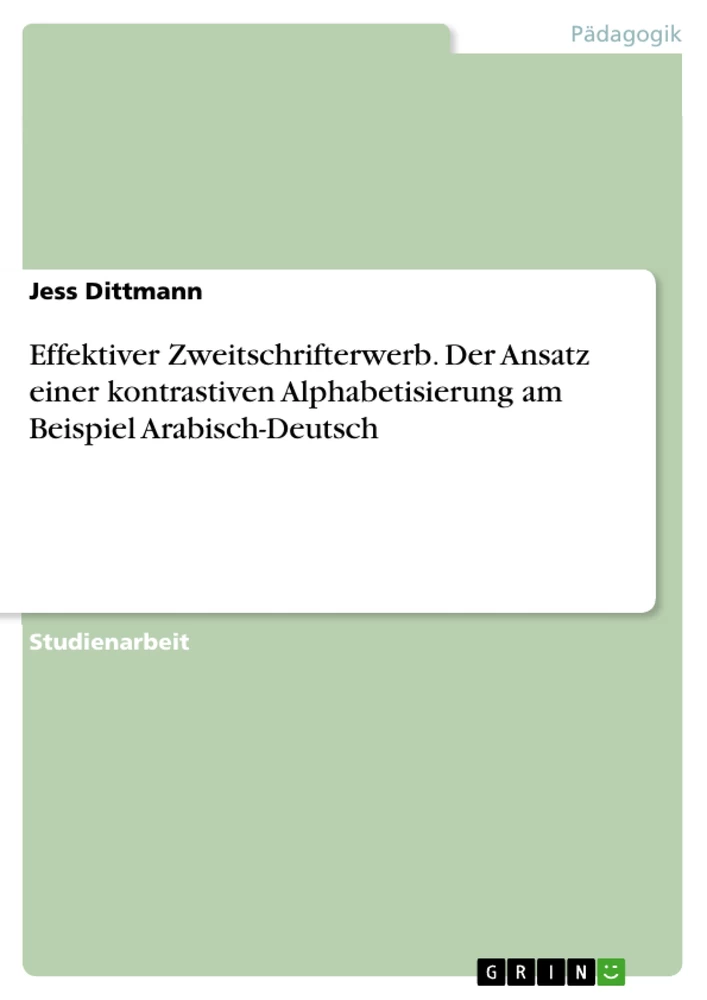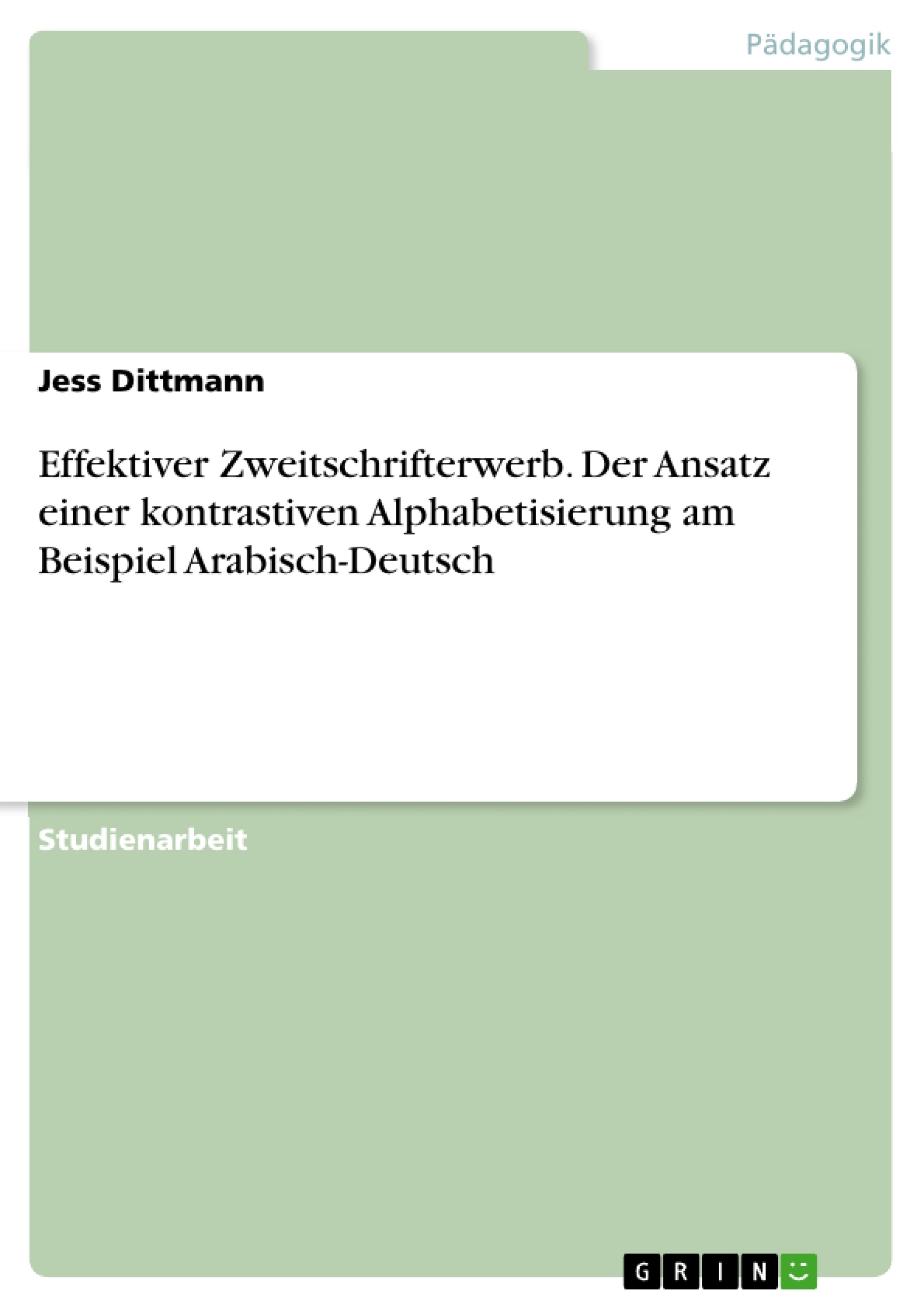Das Thema der vorliegenden Ausführungen ist die Alphabetisierung von arabischsprachigen Personen in der Fremdsprache Osten. Dabei soll es um Personen gehen, die bereits im arabischen Schriftsystem literarisiert sind, jedoch nicht in einem lateinischen Schriftsystem wie dem deutschen. Zu diesem Personenkreis zählen beispielsweise erwachsene Asylsuchende oder Migranten.
Die Beherrschung von Schrift in einer literalen Gesellschaft, wie sie in Deutschland vorzufinden ist, ist sehr wichtig. Für jüngere Menschen ist die deutsche Schriftsprache alleine schon aus dem Grund unabdingbar, um in der Schule bestehen zu können. Aber auch für Erwachsene gibt es eine Vielzahl von Grpnden fur die Notwendigkeit einer Alphabetisierung. In der deutschen Schrift alphabetisiert zu sein, ist ein wichtiger Faktor, um sich für die Arbeitswelt zu qualifizieren. Gerade aufgrund des technologischen Wandels ist eine Schriftkompetenz immer häufiger grundlegende Voraussetzung. Zudem ist eine intensivere Teilhabe am wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen sowie politischen Leben möglich. Die Fähigkeit lesen zu können, vereinfacht des Weiteren die Orientierung im öffentlichen Leben.
Die zentralen Fragen der Arbeit lauten: Welche Besonderheiten ergeben sich dadurch, dass nicht nur eine fremde Schrift, sondern zur gleichen Zeit auch eine fremde Sprache erlernt wird? Welche Besonderheiten ergeben sich aufgrund der bereits erfolgten Erstalphabetisierung? Welche Besonderheiten ergeben sich in Anbetracht der involvierten Sprachen Deutsch und Arabisch?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Formen des Analphabetismus
- 3. Methoden der Alphabetisierung
- 3.1. Die synthetische Methode
- 3.2. Die analytische Methode
- 3.3. Methodenwahl beim Schrifterwerb in der Fremdsprache
- 4. Erst- und Zweitschrifterwerb
- 5. Das arabische und das deutsche Schrift-und Lautsystem.
- 5.1. Das arabische Schrift- und Lautsystem
- 5.2. Das deutsche Schrift- und Lautsystem
- 6. Die kontrastive Alphabetisierung
- 6.1. Die kontrastive Alphabetisierung Arabisch-Deutsch
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Alphabetisierung von arabischsprachigen Personen in der deutschen Sprache, insbesondere im Kontext von erwachsenen Asylsuchenden und Migranten, die bereits im arabischen Schriftsystem literalisiert sind, aber nicht in einem lateinischen Schriftsystem. Die Arbeit untersucht die Herausforderungen des Zweitschrifterwerbs in einer fremden Sprache und einem fremden Schriftsystem und beleuchtet die Rolle der kontrastiven Alphabetisierung als effektiver Ansatz.
- Herausforderungen des Zweitschrifterwerbs in der deutschen Sprache für Personen, die bereits im arabischen Schriftsystem literalisiert sind.
- Die Rolle der kontrastiven Alphabetisierung bei der Bewältigung dieser Herausforderungen.
- Unterschiede zwischen dem arabischen und dem deutschen Schrift- und Lautsystem.
- Die Relevanz von Schriftkompetenz im deutschen Kontext für die Integration und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
- Die Suche nach effektiven und zeitsparenden Methoden zur Alphabetisierung der Zielgruppe.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die Relevanz des Zweitschrifterwerbs für arabischsprachige Personen in Deutschland, insbesondere im Kontext von Asylbewerbern. Kapitel 2 beschreibt verschiedene Formen des Analphabetismus und erklärt, warum der Begriff „Zweitschrifterwerb“ für die in dieser Arbeit thematisierte Personengruppe angemessener ist.
Kapitel 3 beleuchtet verschiedene Methoden der Alphabetisierung, sowohl im Allgemeinen als auch im Kontext der Zielgruppe. Es diskutiert die Frage, ob der Spracherwerb vor dem Schrifterwerb stattfinden sollte und stellt die Vorteile eines simultanen Erwerbs von Schrift und Sprache heraus.
Kapitel 4 fokussiert auf die Besonderheiten des Erst- und Zweitschrifterwerbs. Es werden Faktoren erläutert, die für eine effiziente Alphabetisierung im Zweitschrifterwerb berücksichtigt werden sollten.
Kapitel 5 widmet sich dem arabischen und dem deutschen Schrift- und Lautsystem und beleuchtet die Unterschiede zwischen beiden Schriftsystemen.
Kapitel 6 führt das Konzept der kontrastiven Alphabetisierung ein und erläutert, wie diese Methode für die Alphabetisierung von arabischsprachigen Personen in der deutschen Sprache eingesetzt werden kann.
Schlüsselwörter
Zweitschrifterwerb, kontrastive Alphabetisierung, Arabisch-Deutsch, Analphabetismus, Schriftkompetenz, Integration, Teilhabe, Asylbewerber, Migranten, Schrift- und Lautsystem, effektive Methoden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Erst- und Zweitschrifterwerb?
Erstalphabetisierung ist der Prozess, bei dem eine Person zum ersten Mal ein Schriftsystem erlernt. Zweitschrifterwerb bezieht sich auf Personen, die bereits in einer Schrift (z.B. Arabisch) lesen und schreiben können, aber nun ein zweites System (z.B. das lateinische Alphabet) erlernen.
Was versteht man unter kontrastiver Alphabetisierung?
Die kontrastive Alphabetisierung nutzt die bereits vorhandenen Kenntnisse des Lernenden in seiner Erstschrift (hier Arabisch), um gezielt Unterschiede und Gemeinsamkeiten zur Zweitschrift (Deutsch) herauszuarbeiten und den Lernprozess so effizienter zu gestalten.
Welche Herausforderungen gibt es beim Wechsel vom arabischen zum deutschen Schriftsystem?
Zentrale Unterschiede liegen in der Schreibrichtung (rechts-nach-links vs. links-nach-rechts), der Darstellung von Vokalen und den unterschiedlichen Laut-Buchstaben-Zuordnungen beider Sprachen.
Warum ist die Alphabetisierung für Migranten so wichtig?
Schriftkompetenz ist in einer literalen Gesellschaft wie Deutschland die Voraussetzung für die Qualifizierung für den Arbeitsmarkt, die Orientierung im öffentlichen Raum und die aktive Teilnahme am sozialen und politischen Leben.
Sollte der Spracherwerb vor dem Schrifterwerb stattfinden?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Ansätze und hebt die Vorteile eines simultanen Erwerbs von Sprache und Schrift hervor, da dies den Integrationsprozess beschleunigen kann.
- Quote paper
- Jess Dittmann (Author), 2016, Effektiver Zweitschrifterwerb. Der Ansatz einer kontrastiven Alphabetisierung am Beispiel Arabisch-Deutsch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342264