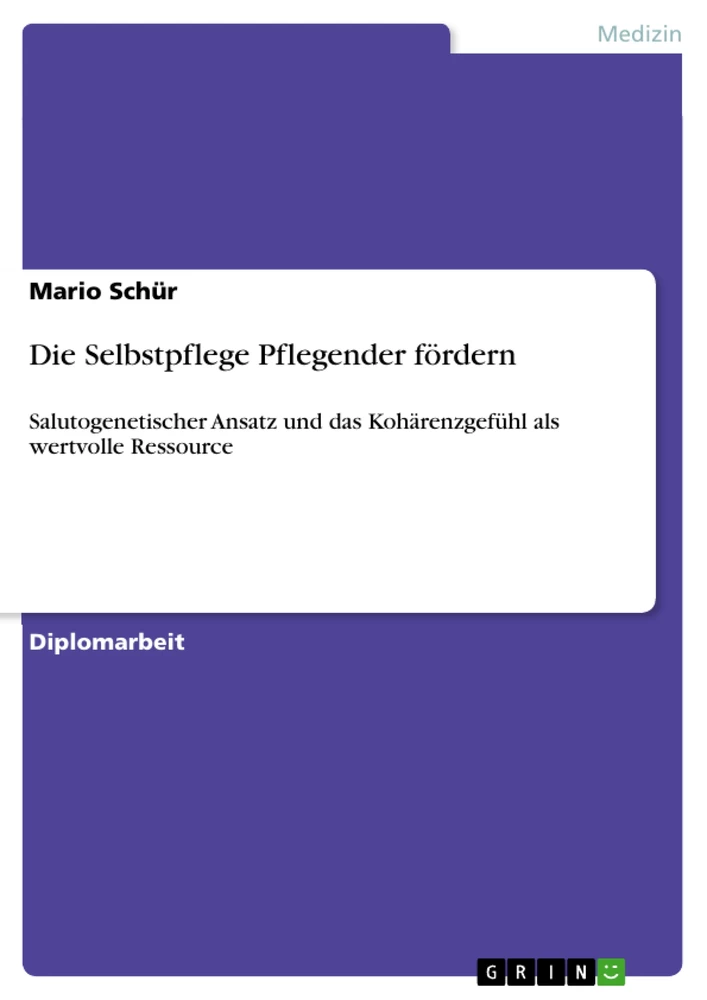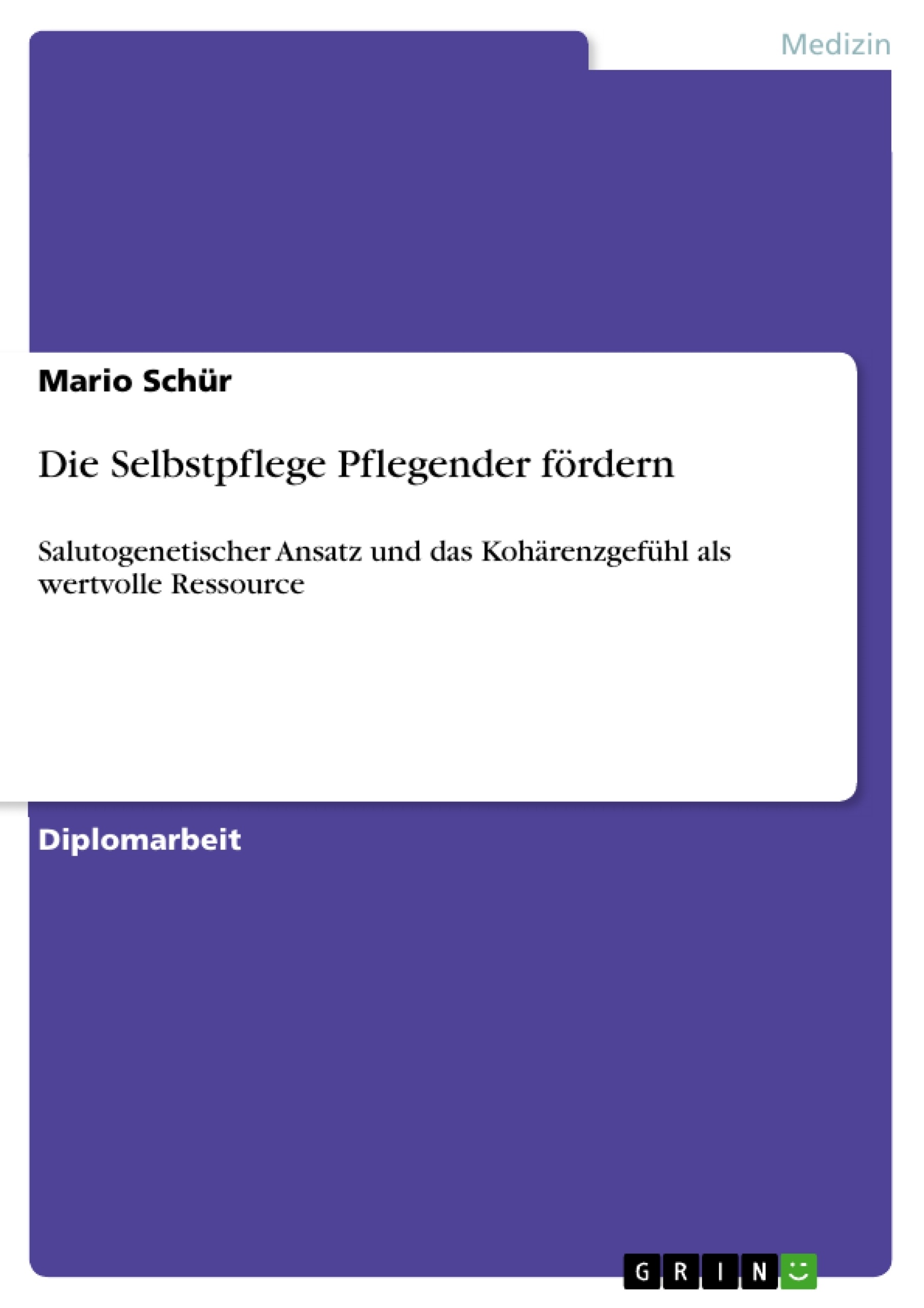Kontext: Psychosoziale Risiken sind eine große Herausforderung für Manager in Gesundheitsunternehmen. Mit dem salutogenetischen Modell, können wir diesen Herausforderungen mit einer positiven Einstellung entgegentreten. Daraus resultiert folgende Forschungsfrage: Wie können pflegerische Dienstleiter das Konzept ‚Kohärenzgefühl‘ nach Antonovsky nutzen, um das Wohlbefinden der Pflegekräfte zu fördern?
Methode: Quellen sind Forschungsartikel aus den Datenbanken der Universität Lüttich und Medline. Die sechs analysierten Artikel verbinden die salutogenetische Orientierung und das Thema Wohlbefinden von Pflegekräften. Der theoretische Hintergrund setzt sich zusammen aus dem Modell der Salutogenese, einer Begriffsbestimmung für den Begriff Wohlbefinden und arbeitsbezogenen Verhaltensmustern.
Ergebnisse: Die analysierten Studien zeigen eine Vielzahl an Ressourcen, die sich anhand einer Tabelle in die Komponenten ‚Verstehbarkeit‘, ‚Handhabbarkeit‘ und ‚Bedeutsamkeit‘ des Kohärenzgefühls eingliedern lassen und einen Einfluss auf diese haben. Es wird ein Zusammenhang zwischen Kohärenzgefühl, Treue zum Arbeitsplatz, mentaler Gesundheit, sozialer Unterstützung und arbeitsbezogener Verhaltens- und Erlebensmuster hergestellt.
Schlussfolgerung: Das Konzept des Kohärenzgefühls lässt sich als Leitschema für pflegerische Dienstleiter zur Förderung des Wohlbefindens nutzen. Spezifische Widerstandsressourcen, die sich in die drei Komponenten des Kohärenzgefühls aufteilen und eingliedern lassen, können zur Evaluation des Arbeitsplatzes herangezogen werden. Je nach arbeitsbezogenem Verhaltens- und Erlebensmuster der Mitarbeiter kann dieses Schema genutzt werden, um das Wohlbefinden eines jeden Mitarbeiters gezielt zu fördern. Ob diese Förderung zum Erfolg führt, hängt unter anderem von der Qualität des sozialen Stützsystems innerhalb sowie außerhalb der Arbeitsstelle ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Auftragsklärung
- Methodologie
- Theoretischer Bezugsrahmen
- Salutogenese
- Zur Person von Aaron Antonovsky
- Entstehung des Modells „Salutogenese“
- Definition
- Entwicklung des Modells
- „Senses of coherence“ oder Kohärenzgefühl
- Erfassung und Stabilität des Kohärenzgefühls
- Generalisierte Widerstandsressourcen
- Wohlbefinden am Arbeitsplatz
- Begriffsbestimmung
- Wohlbefinden messen
- Antonovsky und Wohlbefinden
- Arbeitsbezogene Verhaltensmuster
- Resultate
- Einleitung
- Ressourcen für ein gutes Wohlbefinden von Pflegekräften am Arbeitsplatz
- Einfluss des Kohärenzgefühls auf das Wohlbefinden am Arbeitsplatz
- Das Kohärenzgefühl von Pflegekräften stärken
- Diskussion
- Einleitung
- Ressourcen für ein gutes Wohlbefinden von Pflegekräften am Arbeitsplatz
- Einfluss des Kohärenzgefühls auf das Wohlbefinden am Arbeitsplatz
- Das Kohärenzgefühl von Pflegekräften stärken
- „Verstehbarkeit“ stärken
- „Handhabbarkeit“ stärken
- „Bedeutsamkeit“ stärken
- Kohärenzgefühl stärken
- Grenzen bei der Förderung des Wohlbefindens am Arbeitsplatz
- Schlussfolgerung
- Danksagung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht, wie pflegerische Dienstleiter das Konzept des Kohärenzgefühls nach Antonovsky nutzen können, um das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter zu fördern. Die Arbeit analysiert den Zusammenhang zwischen psychosozialen Risiken im Pflegeberuf und dem salutogenetischen Ansatz. Die Hauptziele sind die Identifizierung von Ressourcen zur Verbesserung des Wohlbefindens und die Entwicklung von Strategien zur Stärkung des Kohärenzgefühls bei Pflegekräften.
- Salutogenetische Förderung des Wohlbefindens von Pflegekräften
- Das Kohärenzgefühl als Ressource im Arbeitskontext
- Analyse von Ressourcen zur Verbesserung des Wohlbefindens
- Zusammenhang zwischen Kohärenzgefühl und Arbeitszufriedenheit
- Entwicklung von Strategien zur Stärkung des Kohärenzgefühls
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Herausforderungen psychosozialer Risiken im Pflegebereich und die daraus resultierende Forschungsfrage: Wie können pflegerische Dienstleiter das Kohärenzgefühl nach Antonovsky nutzen, um das Wohlbefinden der Pflegekräfte zu fördern? Der Abschnitt beleuchtet die Relevanz des Themas vor dem Hintergrund von Burnout, Depressionen und Fehlzeiten im Pflegeberuf und führt in die Methodik der Arbeit ein. Die persönliche Motivation des Autors, basierend auf langjähriger Berufserfahrung, wird ebenfalls dargelegt. Der Bezug zum europäischen Projekt „Arbeitswelt2020“ wird hergestellt, welches salutogene Arbeitsbedingungen in der Pflege zum Ziel hat.
Salutogenese: Dieses Kapitel beleuchtet das salutogenetische Modell von Aaron Antonovsky, einschließlich seiner Biografie und der Entstehung des Modells. Es definiert den Begriff der Salutogenese und beschreibt die Entwicklung des Modells, mit besonderem Fokus auf das Kohärenzgefühl („Sense of Coherence“) als zentralen Bestandteil. Die Erfassung und Stabilität des Kohärenzgefühls werden ebenso erörtert, wie die Bedeutung generalisierter Widerstandsressourcen. Der Abschnitt liefert ein umfassendes Verständnis des theoretischen Fundaments der Arbeit.
Wohlbefinden am Arbeitsplatz: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Messung von Wohlbefinden im Arbeitskontext. Es wird auf den Zusammenhang zwischen dem Modell der Salutogenese und dem Wohlbefinden eingegangen und die Relevanz von Antonovskys Arbeit für die Thematik des Wohlbefindens am Arbeitsplatz herausgestellt. Es legt die Grundlage für die Analyse der Ergebnisse im Kontext des Wohlbefindens der Pflegekräfte.
Arbeitsbezogene Verhaltensmuster: Dieser Abschnitt untersucht, wie arbeitsbezogene Verhaltensmuster das Wohlbefinden beeinflussen und wie diese Muster im Zusammenhang mit dem Kohärenzgefühl stehen. Es liefert den Kontext für die Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf die Interaktion von individuellen Verhaltensweisen und dem generellen Wohlbefinden.
Resultate: Die Resultate präsentieren die Ergebnisse der Analyse verschiedener Studien zum Thema Wohlbefinden von Pflegekräften und deren Zusammenhang mit dem Kohärenzgefühl. Es werden die identifizierten Ressourcen dargestellt und deren Einfluss auf die drei Komponenten des Kohärenzgefühls (Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Bedeutsamkeit) beschrieben. Der Abschnitt stellt die empirischen Fundamente der Arbeit dar.
Diskussion: Die Diskussion interpretiert die Ergebnisse und setzt sie in einen breiteren Kontext. Sie vertieft die Analyse der Ressourcen, welche das Wohlbefinden von Pflegekräften fördern und beleuchtet den Einfluss des Kohärenzgefühls auf dieses Wohlbefinden. Spezifische Strategien zur Stärkung des Kohärenzgefühls in seinen drei Komponenten werden vorgestellt und mögliche Grenzen der Wohlbefindensförderung werden diskutiert. Die Diskussion integriert die Ergebnisse der Resultate mit dem theoretischen Hintergrund und gibt eine umfassende Bewertung des Forschungsstandes.
Schlüsselwörter
Salutogenese, Kohärenzgefühl, Wohlbefinden, Krankenpflege, Arbeitszufriedenheit, Ressourcen, Stressmanagement, psychosoziale Risiken, Pflegekräfte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Salutogenetische Förderung des Wohlbefindens von Pflegekräften
Was ist das Hauptthema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie pflegerische Dienstleiter das Konzept des Kohärenzgefühls nach Antonovsky nutzen können, um das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter zu fördern. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen psychosozialen Risiken im Pflegeberuf und dem salutogenetischen Ansatz.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Hauptziele sind die Identifizierung von Ressourcen zur Verbesserung des Wohlbefindens und die Entwicklung von Strategien zur Stärkung des Kohärenzgefühls bei Pflegekräften. Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Kohärenzgefühl und Arbeitszufriedenheit.
Welche Konzepte werden in der Arbeit behandelt?
Zentrale Konzepte sind die Salutogenese nach Antonovsky, das Kohärenzgefühl ("Sense of Coherence"), Wohlbefinden am Arbeitsplatz, psychosoziale Risiken im Pflegeberuf und Ressourcen zur Stressbewältigung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Salutogenese, ein Kapitel zum Wohlbefinden am Arbeitsplatz, ein Kapitel zu arbeitsbezogenen Verhaltensmustern, ein Kapitel mit den Resultaten, eine Diskussion und eine Schlussfolgerung. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick.
Was wird im Kapitel "Salutogenese" behandelt?
Dieses Kapitel erklärt das salutogenetische Modell von Aaron Antonovsky, einschließlich seiner Biografie und der Entstehung des Modells. Es definiert die Salutogenese und beschreibt das Kohärenzgefühl als zentralen Bestandteil. Die Erfassung und Stabilität des Kohärenzgefühls sowie die Bedeutung generalisierter Widerstandsressourcen werden erörtert.
Was wird im Kapitel "Wohlbefinden am Arbeitsplatz" behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition und Messung von Wohlbefinden im Arbeitskontext und untersucht den Zusammenhang zwischen dem Modell der Salutogenese und dem Wohlbefinden. Die Relevanz von Antonovskys Arbeit für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz wird herausgestellt.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Resultate präsentieren die Ergebnisse der Analyse verschiedener Studien zum Thema Wohlbefinden von Pflegekräften und deren Zusammenhang mit dem Kohärenzgefühl. Identifizierte Ressourcen und deren Einfluss auf die drei Komponenten des Kohärenzgefühls (Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Bedeutsamkeit) werden beschrieben.
Welche Strategien zur Stärkung des Kohärenzgefühls werden vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt Strategien zur Stärkung des Kohärenzgefühls in seinen drei Komponenten (Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Bedeutsamkeit) vor. Mögliche Grenzen der Wohlbefindensförderung werden ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Salutogenese, Kohärenzgefühl, Wohlbefinden, Krankenpflege, Arbeitszufriedenheit, Ressourcen, Stressmanagement, psychosoziale Risiken, Pflegekräfte.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für pflegerische Dienstleiter, Mitarbeiter im Gesundheitswesen, Wissenschaftler und alle, die sich mit dem Thema Wohlbefinden und Stressmanagement im Pflegebereich befassen.
- Quote paper
- Mario Schür (Author), 2016, Die Selbstpflege Pflegender fördern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342274