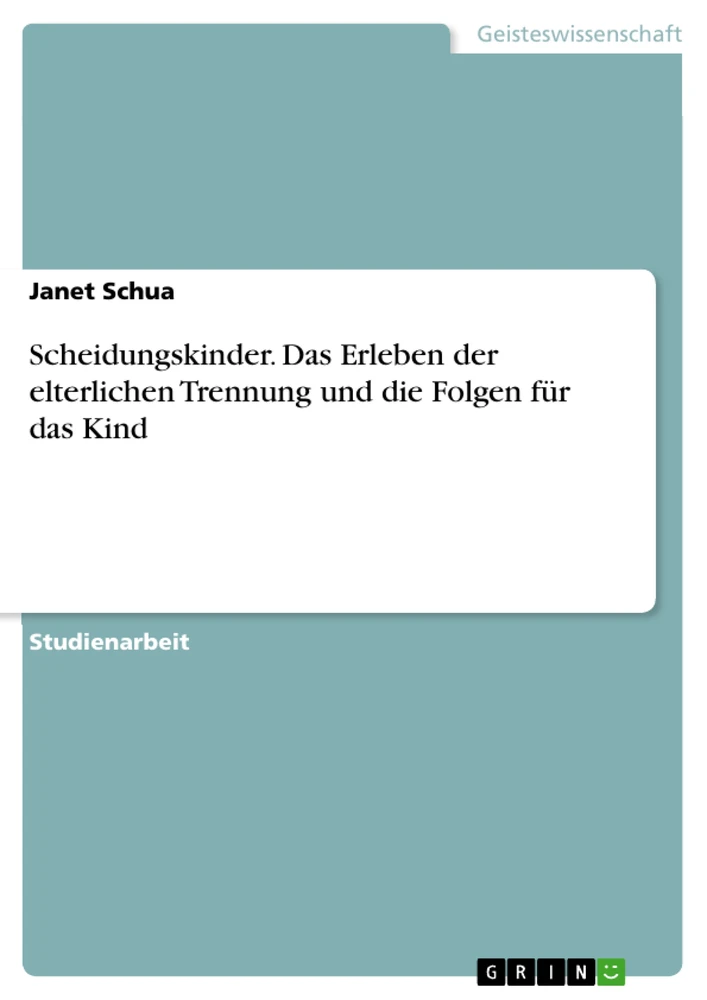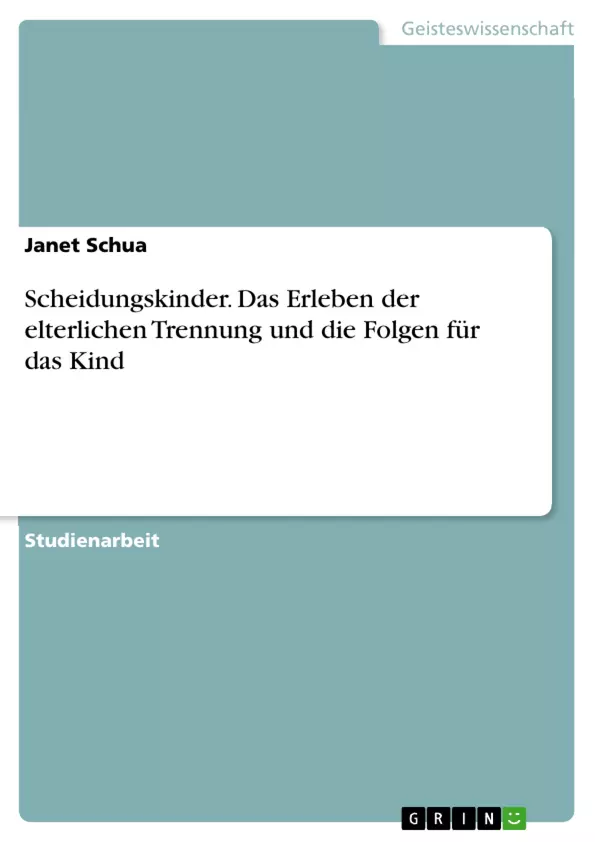Wenn von Scheidung gesprochen wird, denkt man üblicherweise zuerst an ein Ehepaar das sich trennt. Auch bei den rechtlichen Regelungen und dem juristischen Verfahren sind die Bedürfnisse und Belange der betroffenen Ehepartner meist zentral. Oft gerät dabei in den Hintergrund, dass eine Trennung die Auflösung einer gesamten Familie bedeutet, in die das gemeinsame Kind unweigerlich mit verstrickt ist. Dadurch bleiben die Emotionen des Kindes oftmals ungeachtet und werden unterdrückt.
In Wahrheit stellt die Scheidung jedoch für jedes einzelne Kind einen Schicksalsschlag und Einschnitt in seiner Biographie dar, wenngleich auch jedes Kind mit der Situation unterschiedlich gut oder schlecht zurechtkommt; denn letztendlich ist wie jede Scheidung, auch jedes Scheidungskind einzigartig.
Dennoch möchte ich in dieser Arbeit auf das tendenzielle Erleben einer Scheidung aus Kindersicht eingehen und meinen Schwerpunkt auf die möglichen Folgewirkungen richten, die diese belastendende Krisensituation mit sich bringen können. Auf theoretischer Ebene werde ich hierfür zunächst auf das veränderte Konzept und die Bedeutung der Ehe auf soziologischer, als auch auf wissenschaftlicher Ebene eingehen und anschließend einen Überblick über die aktuellen Scheidungszahlen liefern. Darauf folgend werde ich auf das Drei-Phasen-Modell einer Scheidung vorstellen und gleichzeitig der Frage nachgehen, wie betroffene Kinder diese akuten Scheidungsphasen erleben und welche Emotionen damit verknüpft sind.
Die Perspektive der Eltern wird hierbei weitestgehend ausgeblendet. Im weiteren Verlauf der Arbeit widme ich mich den unmittelbaren und langfristigen Folgen einer Scheidung für das Kind. Welche tendenziellen kurzfristigen Symptome weisen Kinder, abhängig von Alter und Geschlecht auf? Welche Faktoren tragen zu traumatischen, langfristigen Wirkungen bei und wie sehen diese aus? Aber auch die versöhnliche, positive Seite einer Scheidung wird abschließend im Blick der Arbeit stehen und einen hoffnungsvollen Ausblick liefern. Hierfür werde ich einige Faktoren nennen, die einen positiven Verarbeitungsprozess begünstigen und somit die Frage nachgehen, was dazu beiträgt, dass betroffene Kinder die Scheidung unbelastet und zufrieden überstehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Definition und Differenzierung von Trennung und Scheidung aus der psychologischen Perspektive des Kindes
- 2. Ehe und Scheidung im Wandel der Zeit
- 2.1 Veränderte Beweggründe zur Eheschließung- und Scheidung
- 2.2 Gewandelte Scheidungsmodelle in der soziowissenschaftlichen Forschung
- 2.3 Zahlen und Fakten in der historischen Entwicklung
- 3. Phasen der Scheidung
- 3.1 Die Vorscheidungsphase
- 3.2 Die Scheidungsphase
- 3.3 Die Nachscheidungsphase
- 4. Die Konsequenzen einer Scheidung für das Kind
- 4.1 Kurzfristige Folgen
- 4.1.1 Altersspezifische Symptome
- 4.1.2 Geschlechtsspezifische Symptome
- 4.2 Langfristige Folgen und Traumata
- 4.2.1 Traumatische Faktoren
- 4.2.2 Andauernde Symptome
- 4.1 Kurzfristige Folgen
- 5. Faktoren für einen positiven Verarbeitungsprozess
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Erleben von Scheidung aus der Perspektive des Kindes. Ziel ist es, die Folgen der Trennung der Eltern für das Kind aufzuzeigen und zu analysieren, wie es mit dieser belastenden Situation zurechtkommt.
- Definition von Trennung und Scheidung aus psychologischer Sicht des Kindes
- Die Entwicklung der Ehe und Scheidung im Wandel der Zeit
- Phasen einer Scheidung und deren Auswirkungen auf das Kind
- Kurz- und langfristige Folgen einer Scheidung für Kinder
- Faktoren, die einen positiven Verarbeitungsprozess fördern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Scheidung und dessen Auswirkungen auf Kinder in den Mittelpunkt. Im ersten Kapitel wird die Definition von Trennung und Scheidung aus der Perspektive des Kindes erläutert und von anderen Trennungsformen abgegrenzt. Kapitel 2 beleuchtet den Wandel von Ehe und Scheidung im Laufe der Zeit und analysiert die veränderten Beweggründe zur Eheschließung und Scheidung. Kapitel 3 widmet sich den Phasen einer Scheidung und geht auf das Erleben der Kinder in diesen Phasen ein. In Kapitel 4 werden die kurz- und langfristigen Folgen einer Scheidung für das Kind dargestellt. Das Kapitel beinhaltet auch eine Analyse der Ursachen für traumatische Folgen und deren Auswirkungen. Schlussendlich wird in Kapitel 5 auf Faktoren eingegangen, die einen positiven Verarbeitungsprozess der Scheidung fördern können.
Schlüsselwörter
Scheidung, Kinder, Trennung, elterliche Trennung, Folgen, Trauma, Verarbeitungsprozess, psychologische Perspektive, sozialer Wandel, Bedeutungswandel der Ehe, Familienrecht, Scheidungsmodelle, Traumatische Faktoren, Positive Verarbeitung, elterliche Unterstützung.
- Citation du texte
- Janet Schua (Auteur), 2014, Scheidungskinder. Das Erleben der elterlichen Trennung und die Folgen für das Kind, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342301