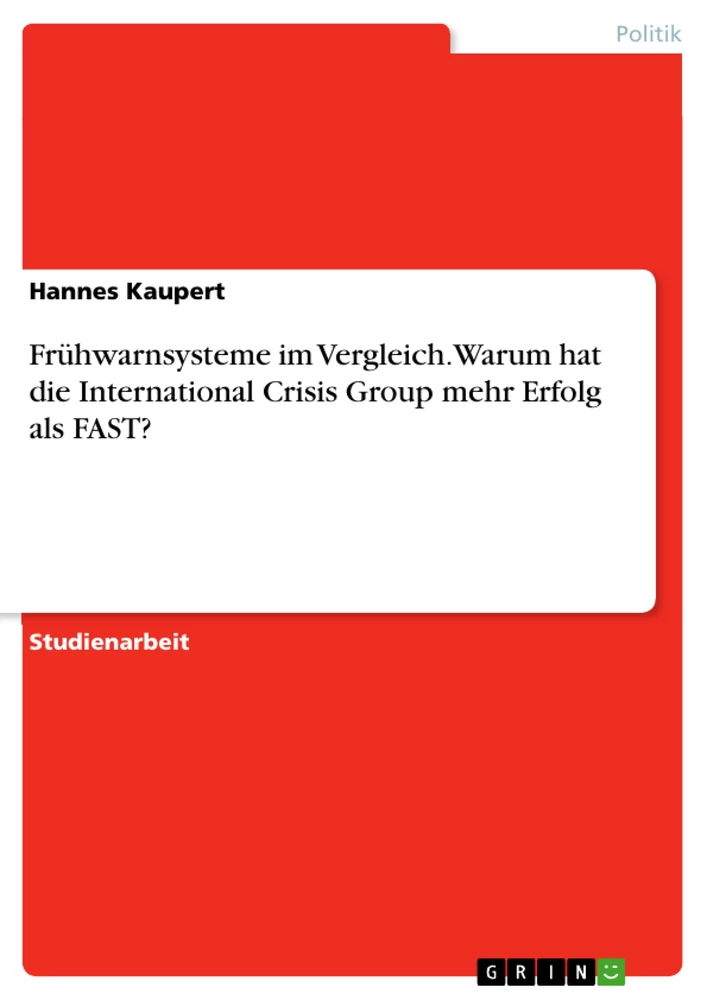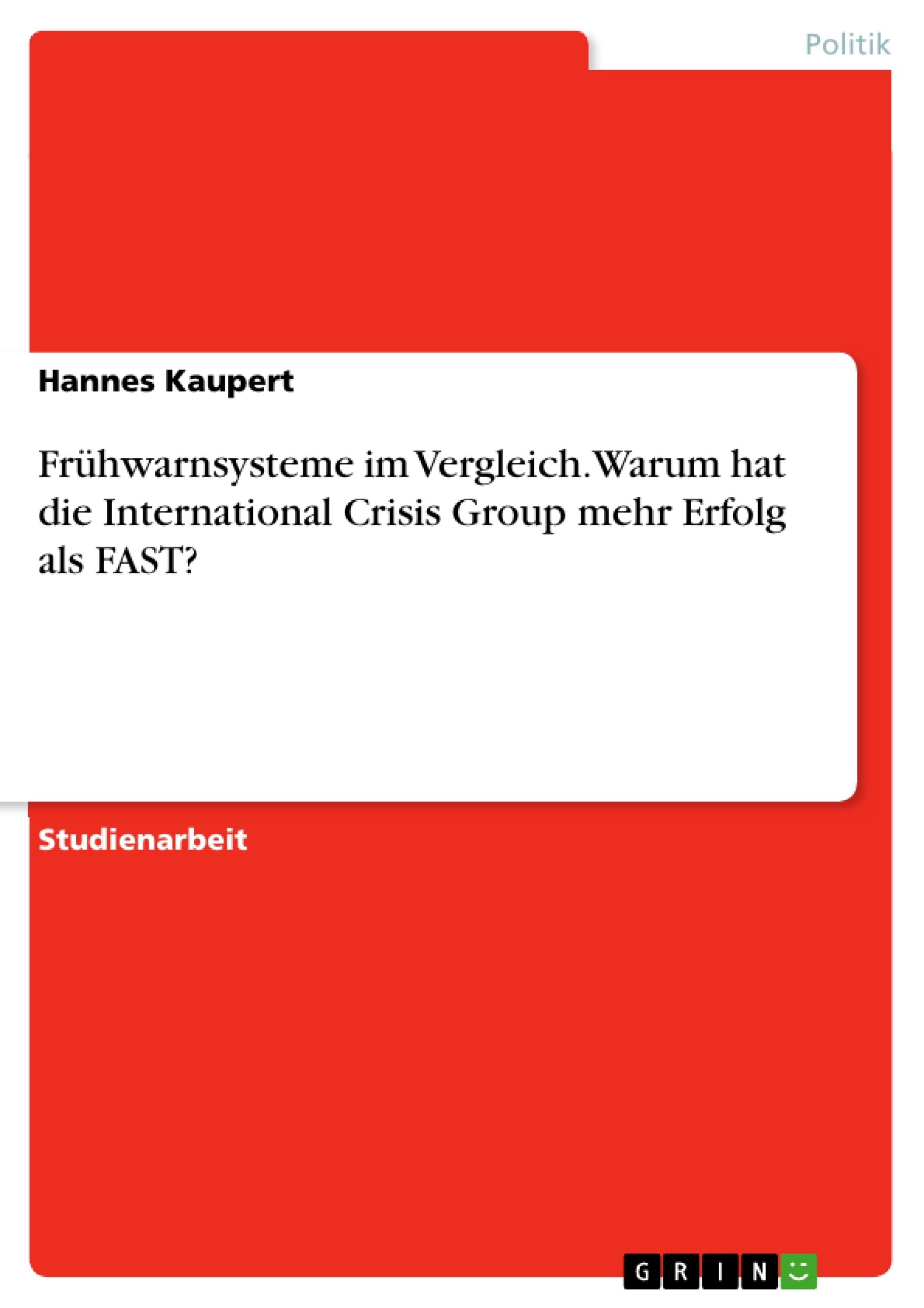Krisenprävention wird immer wichtiger im internationalen Geschehen. Vor allem das Ende des Kalten Krieges brachte eine Wende im internationalen Konfliktgeschehen, denn es sind nicht mehr nur Staaten, die Konflikte gegeneinander austragen, sondern auch immer mehr innerstaatliche Krisenherde vorzufinden. Staaten betreiben intensive und kostspielige Präventionsprogramme und -strategien, um Staatszerfallsprozesse, Genozide, Bürgerkriege oder „ethnische Säuberungen“ zu verhindern.
Trotzdem sah sich die Entwicklungspolitik mehr in der Rolle eines „Reparaturbetriebes“, der die Kriegsschäden zu beheben versuchte. Die Suche nach kostengünstigen und effektiven Lösungen für dieses Problem wurden teilweise in der „Agenda für den Frieden“ 1992 festgeschrieben, welche u.a. Frühwarnung als einen wichtigen Punkt der Friedensschaffung herausfilterte.
In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit Frühwarnsystemen und werde zwei Systeme miteinander vergleichen, die unterschiedlich arbeiten, bzw. gearbeitet haben: Die International Crisis Group und das schweizerische System FAST. Ich werde zunächst eine kleine theoretische Einführung in das Thema Frühwarnsysteme geben, danach die beiden gewählten FWS vorstellen und im letzten Schritt einen Vergleich anhand verschiedener Kriterien aufstellen. Ein wichtiger Punkt des Vergleiches wird die Verwendung von Materialien sein, welche FAST und ICG zu den Konflikten in Somalia ausgearbeitet haben. Trotz der Aktualität dieses Themas sind die Analysen aus den Jahren 2005 bis 2007, da sich in diesem Zeitrahmen beide FWS mit dem Bürgerkrieg in Somalia beschäftigt haben. Durch die Gegenüberstellung werde ich die Beantwortung meiner Fragestellung vollziehen und versuchen herauszufinden, warum die International Crisis Group so erfolgreich und etabliert arbeitet und welche Gründe das System FAST zum Einstellen der Arbeit brachten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Frühwarnsysteme
- 2.1 Qualitative Frühwarnung
- 2.2 Quantitative Frühwarnung
- 2.3 Dualform
- 2.4 Netzwerke
- 2.5 Funktionsprozess
- 3 International Crisis Group
- 4 FAST
- 5 Vergleich
- 5.1 Einordnung nach Untersuchungsgegenstand
- 5.2 Einordnung nach Untersuchungsmethode
- 5.3 Verbindung in politische Entscheidungsebenen
- 6 Warum scheitert FAST? Warum ist die ICG erfolgreich?
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Funktionsweise von Frühwarnsystemen (FWS) und vergleicht zwei unterschiedliche Ansätze: die International Crisis Group (ICG) und das Schweizer System FAST. Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Methoden und Schwerpunkte der beiden FWS und analysiert, warum die ICG im Vergleich zu FAST einen größeren Erfolg im Bereich der Krisenprävention erzielt.
- Analyse der Funktionsweise von Frühwarnsystemen
- Vergleich der Methoden und Schwerpunkte der ICG und FAST
- Untersuchung der Faktoren, die zum Erfolg der ICG beitragen
- Bewertung der Effektivität von FWS in der Krisenprävention
- Analyse der Rolle von FWS in der internationalen Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der Krisenprävention ein und beleuchtet die Bedeutung von Frühwarnsystemen im Kontext des internationalen Konfliktgeschehens. Kapitel 2 bietet eine theoretische Einführung in die Funktionsweise von FWS, wobei verschiedene Ansätze und Methoden der Frühwarnung vorgestellt werden. Kapitel 3 und 4 widmen sich der Vorstellung der International Crisis Group (ICG) und des Schweizer Systems FAST, wobei die jeweiligen Arbeitsweisen und Schwerpunkte der beiden FWS im Detail dargestellt werden. Kapitel 5 vergleicht die beiden Systeme anhand verschiedener Kriterien, wie dem Untersuchungsgegenstand, der Untersuchungsmethode und der Verbindung zu politischen Entscheidungsebenen. Kapitel 6 analysiert die Gründe für den Erfolg der ICG und die Schwierigkeiten des FAST-Systems. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Bedeutung von Frühwarnsystemen für die internationale Politik.
Schlüsselwörter
Frühwarnsysteme, Krisenprävention, International Crisis Group (ICG), FAST, Konfliktforschung, Konfliktanalyse, politische Entscheidungsprozesse, internationale Politik, Somalia, Bürgerkrieg, Ethnopolitische Konflikte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Aufgabe von Frühwarnsystemen (FWS) in der Politik?
FWS dienen dazu, drohende Krisen, Genozide oder Bürgerkriege frühzeitig zu erkennen, damit die internationale Gemeinschaft rechtzeitig Präventionsmaßnahmen ergreifen kann.
Was unterscheidet qualitative von quantitativer Frühwarnung?
Quantitative Frühwarnung basiert auf statistischen Daten und Indikatoren. Qualitative Frühwarnung setzt auf Expertenanalysen vor Ort, Berichte und die Interpretation politischer Dynamiken.
Warum gilt die International Crisis Group (ICG) als erfolgreich?
Die ICG ist durch ihre Vor-Ort-Analysen und starke Vernetzung in politische Entscheidungsebenen weltweit etabliert. Sie liefert konkrete Handlungsempfehlungen, die von Regierungen und Organisationen direkt genutzt werden können.
Was war das System FAST und warum wurde es eingestellt?
FAST war ein schweizerisches Frühwarnsystem. Es scheiterte unter anderem an der Schwierigkeit, die erhobenen Daten effektiv in politische Handlungen umzusetzen und die langfristige Finanzierung sowie Akzeptanz zu sichern.
Welches Beispiel wurde zum Vergleich der Systeme herangezogen?
Der Vergleich basiert auf Analysen zum Bürgerkrieg in Somalia aus den Jahren 2005 bis 2007, an denen beide Systeme zeitgleich arbeiteten.
- Quote paper
- Hannes Kaupert (Author), 2015, Frühwarnsysteme im Vergleich. Warum hat die International Crisis Group mehr Erfolg als FAST?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342406