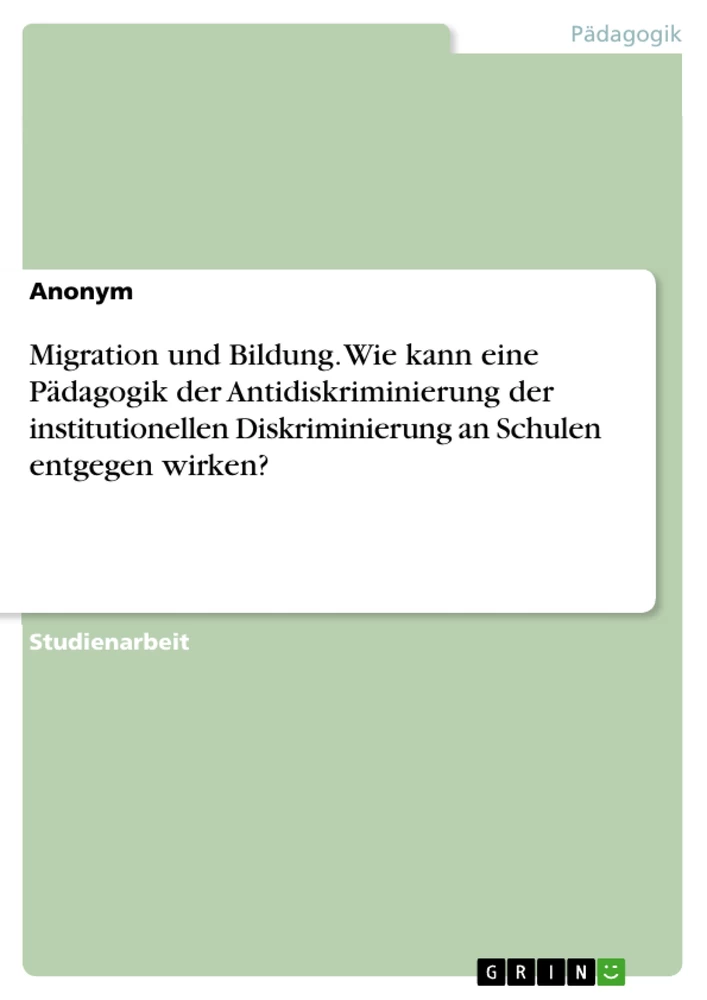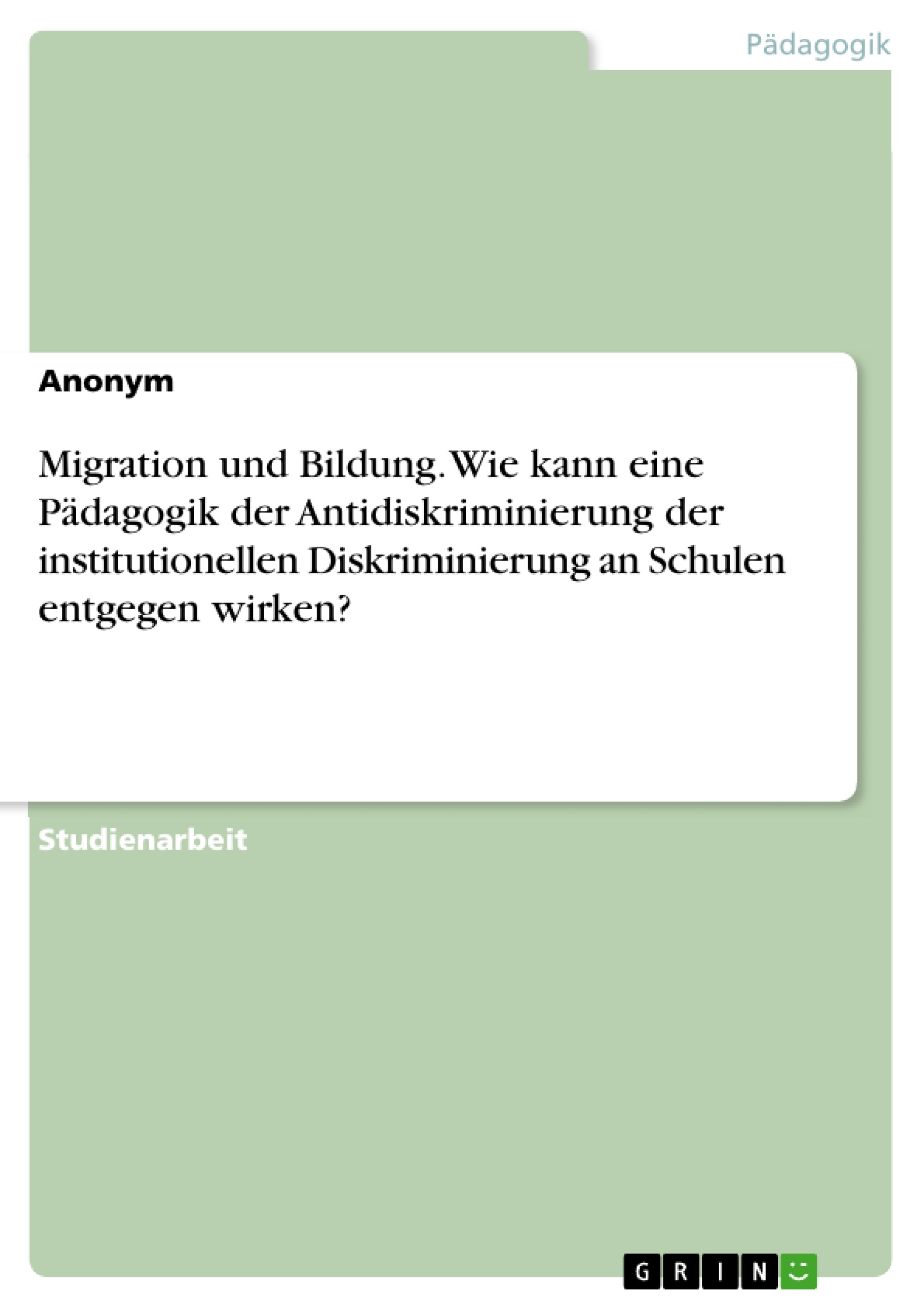Im breiten Feld der Diskriminierung findet diese Arbeit ihren Schwerpunkt innerhalb der institutionellen Diskriminierung an Schulen und den Möglichkeiten der Antidiskriminierungspädagogik, dieser besonderen Form der Diskriminierung entgegen zu wirken. Angesichts der immer größer werdenden Herausforderung, die Pädagog/Innen mit der wachsenden Heterogenität von beispielsweise Schulklassen oder Kita-Gruppen auf der einen Seite und einem „nicht der aktuellen Lage entsprechendem Bildungssystem“ auf der anderen Seite bevorsteht, ist es notwendig sich mit einhergehenden Chancen und Risiken zu befassen und diese objektiv zu beleuchten und konstruktiv zu bearbeiten.
Ausgerichtet an der Praxis soll das Fazit die Ausgangsfrage beantworten und einen kleinen Ausblick geben, wie Schule zukünftig aussehen kann und soll.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Migration und Bildung. Wie kann eine Pädagogik der Antidiskriminierung der institutionellen Diskriminierung an Schulen entgegen wirken?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342442