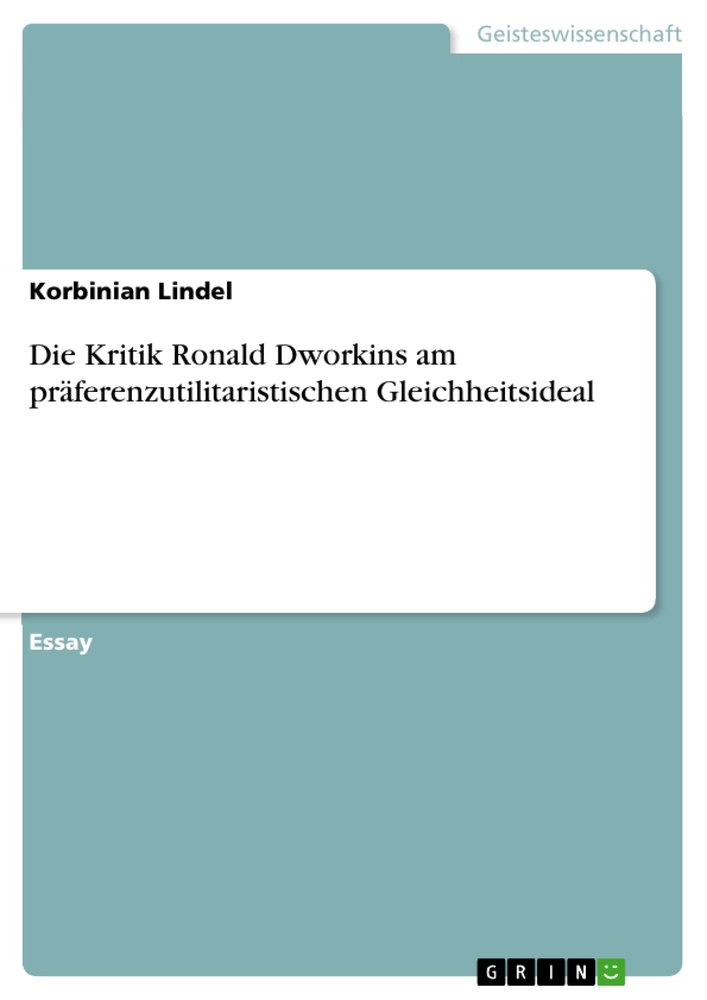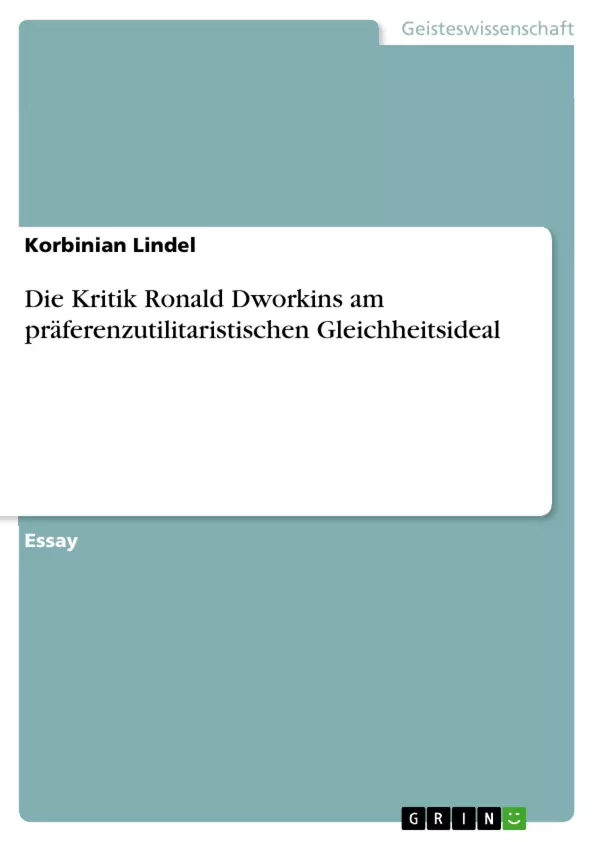Seit der Antike wird die Gerechtigkeit kulturübergreifend als ein gesellschaftlicher Grundwert angesehen und stellt im "common sense" ein elementares, nicht weiter ableitbares Prinzip zur Herstellung einer funktionierenden sozialen Ordnung dar. Über kulturelle und Epochengrenzen hinweg wurde und wird der Gerechtigkeitsbegriff auf verschiedenste Weise interpretiert. Nach David Hume gelten jedoch grundlegend zwei Faktoren, welche die Bedingungen festsetzen, unter denen das Ideal der Gerechtigkeit in der Praxis umgesetzt werden muss. Zum Einen ist die Gesamtmenge an Gütern, auf die eine Gesellschaft zurückgreifen kann, begrenzt und zum Anderen bestehen um dieselben Güter konkurrierende Interessen der einzelnen Individuen. Moderate Knappheit einerseits und konfligierende Besitzansprüche andererseits bilden somit den Hintergrund, vor dem jedes Gerechtigkeitskonzept seine Tragfähigkeit zu beweisen hat.
In unserem modernen demokratischen Verständnis ist die Idee der Gerechtigkeit eng an das Ideal der Gleichheit gekoppelt. Nach Ronald Dworkin existieren zwei miteinander konkurrierende Theoriekomplexe, die zu bestimmen versuchen, auf welche Weise die knappen Güter innerhalb einer Gesellschaft zu verteilen sind, um einen Zustand der Gleichheit herzustellen. Der Ansatz der Ressourcengleichheit, den Dworkin selbst in einer modifizierten Form vertritt, fordert, dass sämtliche Ressourcen, über die eine Gesellschaft verfügt, allen Bürgern zu gleichen Teilen übereignet werden. Dieser Ansatz sieht also in einer gleichmäßigen Güterverteilung die Grundlage für gerechte gesellschaftliche Verhältnisse.
Der Konzeption der Ressourcengleichheit kann jedoch vorgeworfen werden, durch die ausschließliche Orientierung an den materiellen Mitteln das angestrebte Ideal der Gleichheit zu verfehlen. So räumt Dworkin selbst ein, dass die zu verteilenden Güter keinen intrinsischen Wert besitzen, sondern lediglich dafür zu instrumentalisieren sind, das Wohlergehen der Menschen zu befördern. Man könnte daraus naheliegenderweise die Forderung ableiten, die Mitglieder einer Gesellschaft in ihrem Wohlergehen und nicht in Hinblick auf ihre materiellen Besitztümer gleichzustellen. Einen Versuch, die Ressourcengleichheit gegen dieses Modell einer Wohlergehensgleichheit zu behaupten, unternimmt Dworkin in seinem Aufsatz "Equality of welfare".
Inhaltsverzeichnis
- I. Gerechtigkeit und Gleichheit
- II. Methodische Zweifel am Konzept der Erfolgsgleichheit
- 1. Das Problem der empirischen Messbarkeit von Wohlergehen
- 2. Beschränkung auf die Bereitstellung von Ressourcen
- 3. Verwechslung von Mitteln und Zwecken
- III. Systematische Zweifel am Konzept der Erfolgsgleichheit
- 1. Fehlen normativer Gerechtigkeitsvorstellungen
- 2. Ungerechtfertigte Kompensationsansprüche
- IV. Fazit
- V. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit Ronald Dworkins Kritik am präferenzutilitaristischen Gleichheitsideal. Dworkin argumentiert, dass die Gleichstellung von Individuen in ihrem Wohlergehen, basierend auf der Befriedigung von Präferenzen, methodische und systematische Schwächen aufweist. Die Arbeit untersucht diese Kritikpunkte und beleuchtet die Grenzen des präferenzutilitaristischen Ansatzes.
- Methodische Zweifel an der Messbarkeit von Wohlergehen und der Realisierbarkeit des präferenzutilitaristischen Modells in der Praxis
- Die Beschränkung des präferenzutilitaristischen Ansatzes auf die Bereitstellung von Ressourcen, ohne die Verantwortung für die erfolgreiche Verwirklichung von Individualzielen zu übernehmen
- Die Verwechslung von Mitteln und Zwecken im präferenzutilitaristischen Ansatz, die die Frage nach dem Wesen der Präferenzen und ihrem Beitrag zu einem erfüllten Leben aufwirft
- Systematische Zweifel an der Schlüssigkeit des Wohlergehenskonzepts als Grundlage für eine gerechte Gesellschaftsordnung
- Die Kritik an ungerechtfertigten Kompensationsansprüchen, die durch das präferenzutilitaristische Modell entstehen könnten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die grundlegenden Begriffe von Gerechtigkeit und Gleichheit und stellt die beiden konkurrierenden Konzepte der Ressourcengleichheit und Wohlergehensgleichheit vor. Dworkin argumentiert, dass die Ressourcen nur Mittel zum Zweck sind, um das Wohlergehen der Menschen zu fördern. Das zweite Kapitel widmet sich Dworkins methodischen Einwänden gegen die Wohlergehensgleichheit. Dworkin kritisiert die Messbarkeit von Wohlergehen, die Beschränkung auf Ressourcenbereitstellung und die Verwechslung von Mitteln und Zwecken. Das dritte Kapitel behandelt Dworkins systematische Kritik an der Wohlergehensgleichheit, die sich auf das Fehlen normativer Gerechtigkeitsvorstellungen und die Ungerechtfertigte Kompensationsansprüche konzentriert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Gleichheit, Gerechtigkeit, Präferenzutilitarismus, Wohlergehensgleichheit, Ressourcenverteilung, methodische Kritik, systematische Kritik, normative Gerechtigkeitsvorstellungen, Kompensationsansprüche.
Häufig gestellte Fragen
Was kritisiert Ronald Dworkin am Präferenzutilitarismus?
Dworkin kritisiert, dass die Gleichstellung von Individuen basierend auf ihrem Wohlergehen (Befriedigung von Präferenzen) methodisch und systematisch unschlüssig ist.
Was ist der Unterschied zwischen Ressourcen- und Wohlergehensgleichheit?
Ressourcengleichheit fordert die gleiche Verteilung materieller Mittel, während Wohlergehensgleichheit fordert, alle Menschen im Hinblick auf ihre Lebenszufriedenheit gleichzustellen.
Warum ist die Messung von Wohlergehen problematisch?
Dworkin führt methodische Zweifel an, da Wohlergehen subjektiv und empirisch schwer messbar ist, was eine gerechte Verteilung in der Praxis fast unmöglich macht.
Was meint Dworkin mit der „Verwechslung von Mitteln und Zwecken“?
Er argumentiert, dass Ressourcen nur Mittel sind, um Zwecke zu erreichen. Der Präferenzutilitarismus vernachlässigt jedoch die Eigenverantwortung für die Wahl dieser Zwecke.
Führt Wohlergehensgleichheit zu ungerechtfertigten Kompensationsansprüchen?
Ja, Dworkin warnt davor, dass Menschen mit extrem teuren oder schwer zu befriedigenden Präferenzen („expensive tastes“) unfaire Ansprüche an die Gemeinschaft stellen könnten.
Welche Rolle spielt die Knappheit von Gütern für die Gerechtigkeit?
Nach David Hume ist moderate Knappheit bei gleichzeitig konkurrierenden Interessen die Bedingung, unter der jedes Gerechtigkeitskonzept seine Tragfähigkeit beweisen muss.
- Quote paper
- Korbinian Lindel (Author), 2016, Die Kritik Ronald Dworkins am präferenzutilitaristischen Gleichheitsideal, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342454