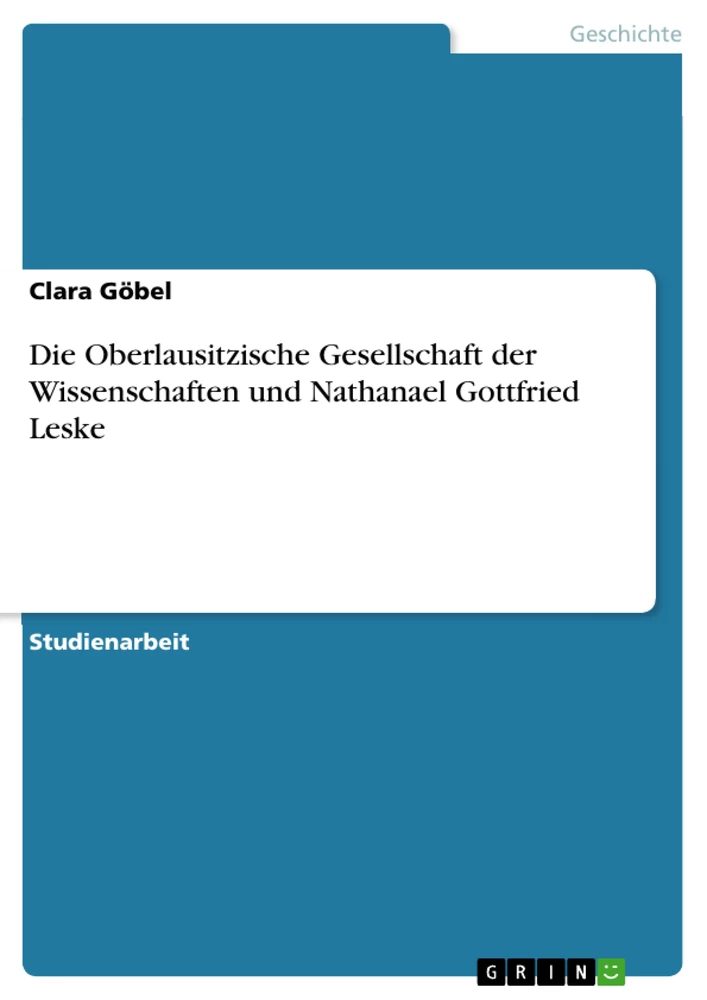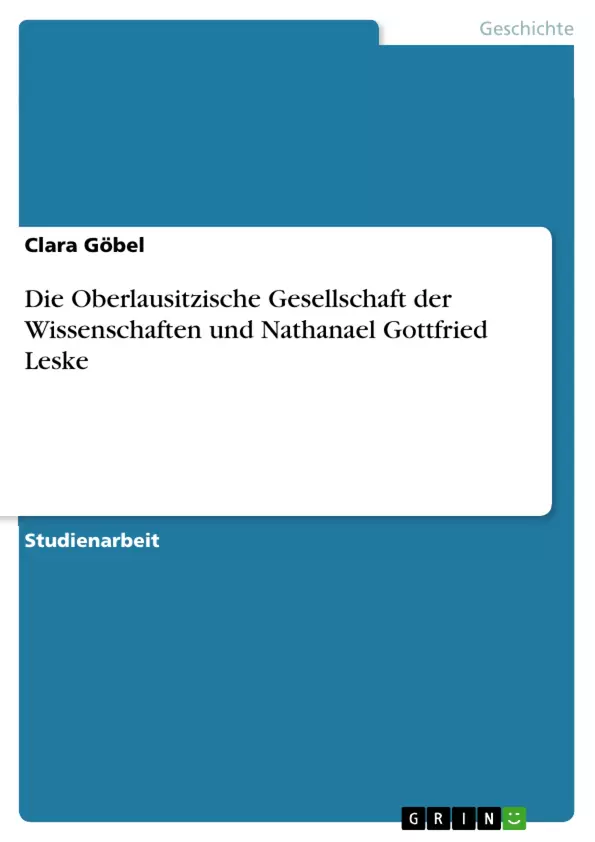Obwohl auch der Raum um Görlitz zur Zeit der Aufklärung neue Erkenntnisse hervorbrachte, galt dies als eher ungewöhnlich, da die Oberlausitz zu jener Zeit weder über eine Universität verfügte, noch als politisches oder kulturelles Zentrum anerkannt war.
Des Weiteren war sie eine an das sächsische Kurfürstentum angeschlossen Markgrafschaft, die kaum über Mitspracherechte verfügte und in ihrer politischen Abhängigkeit den „Erfolgen wie Niederlagen“ ausgeliefert
Dennoch fungierte hier ab 1738 eine literarische Gesellschaft und wenige Jahre später wurde eine Einrichtung, die ähnliche Ziele verfolgte in Lauban gegründet. „Der Gedankenaustausch in dieser Zeit überwand nicht nur immer mehr das soziale Umfeld, sondern auch die Grenzen des von vielen Zeitgenossen als rückständig empfundenen Markgrafentum“.
Wie es für viele der im 18. Jahrhundert gegründeten Sozietäten der Wissenschaft üblich war, verfolgte auch die „Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften“ zunächst das Ziel der Gemeinnützigkeit.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Die Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften
- Gründung mit Motiv und Programm der Gesellschaft
- Mitglieder und Mitgliedschaft
- Aktivitäten der Gesellschaft
- Fortführung und Einstellung
- Dokumentation
- Welche Dokumente sind recherchierbar?
- Wo sind diese Dokumente zu finden?
- Haben die Gesellschaften eigene Archivbestände und wenn ja, an welchem Standort sind sie zu finden?
- Wie ist die Bestandsüberlieferung?
- Figuren
- Angaben zur Familie
- Lebenslauf, Leistungen, kritische Würdigung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die „Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften“ wurde 1779 gegründet und hatte das Ziel, die Wissenschaften in der Oberlausitz zu fördern. Die Gesellschaft zielte darauf ab, die Forschung in der Region voranzutreiben, den Austausch von Wissen zu fördern und die wissenschaftliche Gemeinschaft zu stärken.
- Die Geschichte der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften
- Die Entwicklung der Gesellschaft und ihre Rolle in der wissenschaftlichen Landschaft der Oberlausitz
- Die Mitglieder der Gesellschaft und ihre Beiträge zur Wissenschaft
- Die Bedeutung der Gesellschaft für die kulturelle Entwicklung der Oberlausitz
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel beleuchtet die Gründung der "Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften" im Kontext der Aufklärung in der Oberlausitz. Es wird die Motivation für die Gründung der Gesellschaft, ihre Ziele und ihr ursprüngliches Programm erörtert.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Mitgliedern und der Mitgliedschaft in der Gesellschaft. Es werden wichtige Persönlichkeiten, ihre Beiträge und die Entwicklung der Mitgliedschaft im Laufe der Zeit dargestellt.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Aktivitäten der Gesellschaft, darunter ihre Publikationen, Veranstaltungen, Forschungen und die Rolle, die sie in der Förderung wissenschaftlicher Erkenntnisse spielte.
Schlüsselwörter (Keywords)
Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften, Aufklärung, Natur- und Geschichtskunde, Gelehrte Gesellschaften, Mitglieder, Aktivitäten, Forschung, Bibliothek, Archiv, Regionalgeschichte, wissenschaftlicher Austausch, Kultur, Bildung, Sachsen
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde die Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften gegründet?
Die Gesellschaft wurde im Jahr 1779 in Görlitz gegründet, inmitten der Zeit der Aufklärung.
Welche Ziele verfolgte die Gesellschaft?
Primäres Ziel war die Förderung der Wissenschaften (Natur- und Geschichtskunde) in der Oberlausitz sowie die Gemeinnützigkeit.
Wer war Nathanael Gottfried Leske?
Leske war eine zentrale Figur der Gesellschaft; die Arbeit beleuchtet seinen Lebenslauf, seine wissenschaftlichen Leistungen und seine familiären Hintergründe.
Warum war Görlitz ein ungewöhnlicher Standort für eine solche Sozietät?
Die Oberlausitz verfügte damals weder über eine Universität noch war sie ein anerkanntes politisches Zentrum, dennoch blühte der wissenschaftliche Austausch.
Wo findet man heute Dokumente dieser Gesellschaft?
Die Arbeit gibt Hinweise zur Recherche in Archivbeständen und Bibliotheken, die die Aktivitäten und Dokumentationen der Gesellschaft bewahren.
- Quote paper
- Clara Göbel (Author), 2010, Die Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften und Nathanael Gottfried Leske, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342466