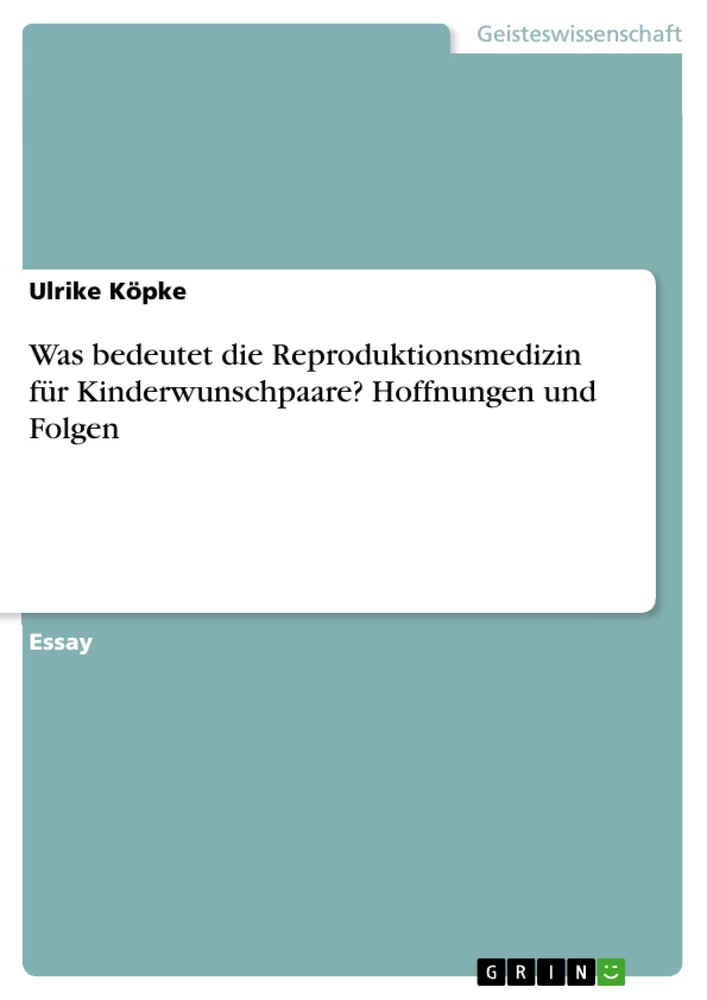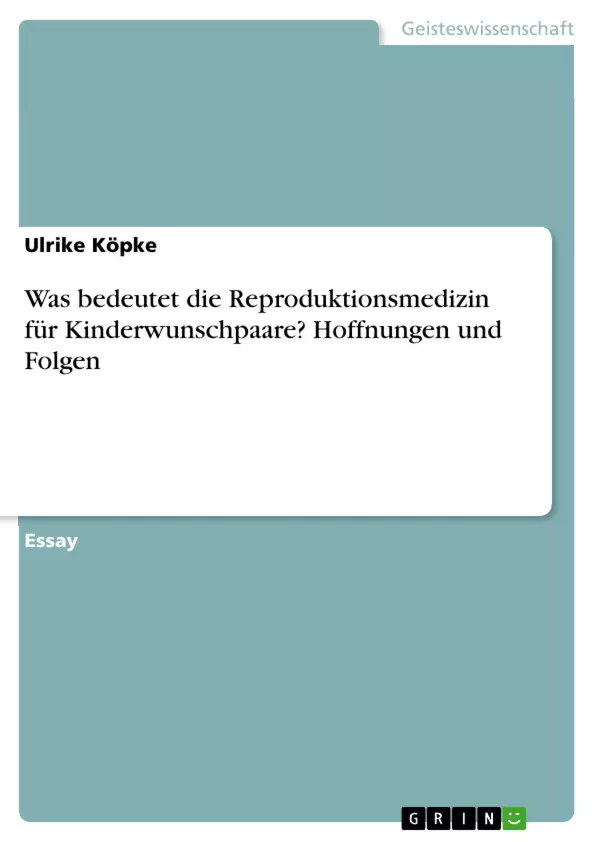Da die Inanspruchnahme der Reproduktionsmedizin immer weiter zunimmt, beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der zentralen Frage, welche Hoffnungen und Folgen mit der Reproduktionsmedizin für die Kinderwunschpaare einhergehen.
Dass das Alter bei Geburt des ersten Kindes immer weiter ansteigt, wird in vielen Medien immer wieder dargestellt. Ob und wann sich für ein Kind entschieden wird, ist abhängig von den äußerlichen Rahmenbedingungen sowie von den persönlichen Lebensvorstellungen. Besonders wichtig ist dabei, dass der richtige Partner bereits Teil des Lebens ist.
Doch bereits da tritt häufig die erste Schwierigkeit auf: Umfragen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung zeigen, dass den 30- bis 39-jährigen Frauen und Männern oftmals der richtige Lebenspartner fehlt, mit dem der Kinderwunsch realisiert werden kann. Ein weiterer Grund für das Aufschieben des Kinderkriegens ist, dass besonders für junge Frauen und Männer die Ausbildung beziehungsweise der Berufseinstieg eine große Rolle in der jungen Lebensphase spielt. Somit stehen ein sicherer Job und ein gutes Einkommen hauptsächlich im Vordergrund. Für viele die Voraussetzung, um sich für die Familienplanung zu entscheiden.
Insbesondere hochgebildete Frauen entscheiden sich oft gegen oder sehr spät für ein Kind. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung liegt das durchschnittliche Erstgebäralter heute bei über 30 Jahren. Ebenso ist der Anteil der Spätgebärenden (Frauen über 34 Jahre) in den letzten zwei Jahren deutlich gestiegen (von 1,3% auf 22%). Da die Fertilität in einem großen Zusammenhang zum Alter steht, müssen sich Paare, die sich im höheren Alter doch für ein Kind entscheiden, häufiger der reproduktionsmedizinischen Behandlung unterziehen. Aber auch infertile Paare nutzen diese Möglichkeit. 20 bis 30% der Paare werden innerhalb eines Jahres bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr nicht schwanger, leiden also an einer verminderten Fertilität. Circa 3% sind sogar dauerhaft ungewollt kinderlos.
Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass ungewollte Kinderlosigkeit in Deutschland weiter zunehmen wird, da das Durchschnittsalter bei Geburt des ersten Kindes weiter ansteigt.
Inhaltsverzeichnis
- Folgen der Reproduktionsmedizin für die Kinderwunschpaare
- Welche Hoffnungen verbinden Kinderwunschpaare mit der Reproduktionsmedizin und welche Folgen gehen damit einher?
- Kinderwunschpaare als infertil - Fakten der Reproduktionsmedizin
- Das Kinderwunschzentrum
- Die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin - überschätzte Erwartungen?
- Gründe für die Entscheidung der reproduktionsmedizinischen Behandlung
- Finanzielle Belastung und die Frage der staatlichen Unterstützung
- Die psychische Belastung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Hoffnungen und Folgen, die mit der Reproduktionsmedizin für Kinderwunschpaare einhergehen. Sie untersucht die Erwartungen, die Paare an die Reproduktionsmedizin stellen, sowie die potenziellen psychischen und finanziellen Belastungen, die mit der Behandlung verbunden sind.
- Die steigende Inanspruchnahme der Reproduktionsmedizin im Kontext des zunehmenden Alters bei der Geburt des ersten Kindes
- Die Überbewertung der Erfolgschancen der Reproduktionsmedizin durch die Medien und Kinderwunschzentren
- Die psychische Belastung, die mit der Reproduktionsmedizin verbunden ist, insbesondere durch wiederholte erfolglose Behandlungszyklen
- Die Frage der finanziellen Unterstützung durch den Staat und die Notwendigkeit einer umfassenden Beratung der Paare
- Die ethischen und gesellschaftlichen Implikationen der Reproduktionsmedizin
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet die wachsende Inanspruchnahme der Reproduktionsmedizin, insbesondere im Zusammenhang mit dem zunehmenden Alter bei der Geburt des ersten Kindes. Es werden die Gründe für das Aufschieben der Familienplanung und die damit verbundenen Herausforderungen für die Kinderwunschpaare erläutert.
- Das zweite Kapitel befasst sich mit den Erwartungen, die Kinderwunschpaare an die Reproduktionsmedizin haben. Es wird auf die Überbewertung der Erfolgschancen durch die Medien und Kinderwunschzentren hingewiesen.
- Das dritte Kapitel analysiert die psychische Belastung, die mit der Reproduktionsmedizin verbunden ist. Es werden die emotionalen Herausforderungen und die potentiellen Folgen von wiederholten erfolglosen Behandlungszyklen beleuchtet.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit der Frage der finanziellen Unterstützung durch den Staat und der Notwendigkeit einer umfassenden Beratung für die Paare.
- Das fünfte Kapitel thematisiert die ethischen und gesellschaftlichen Implikationen der Reproduktionsmedizin.
Schlüsselwörter
Reproduktionsmedizin, Kinderwunsch, Infertilität, assistierte Reproduktion, IVF, ICSI, psychische Belastung, finanzielle Belastung, staatliche Unterstützung, ethische Implikationen, gesellschaftliche Folgen.
Häufig gestellte Fragen
Warum nimmt die Inanspruchnahme der Reproduktionsmedizin zu?
Ein Hauptgrund ist das steigende Durchschnittsalter bei der Geburt des ersten Kindes (oft über 30 Jahre), da die natürliche Fertilität mit dem Alter abnimmt.
Welche psychischen Belastungen können entstehen?
Paare leiden oft unter dem emotionalen Druck wiederholter, erfolgloser Behandlungszyklen und der Diskrepanz zwischen Hoffnung und Realität.
Wie hoch ist der Anteil ungewollt kinderloser Paare?
Etwa 20 bis 30 % der Paare werden innerhalb eines Jahres nicht schwanger; ca. 3 % bleiben dauerhaft ungewollt kinderlos.
Werden die Erfolgschancen der Reproduktionsmedizin überschätzt?
Die Arbeit weist darauf hin, dass Medien und Kinderwunschzentren oft übersteigerte Erwartungen wecken, die nicht immer der medizinischen Realität entsprechen.
Welche Rolle spielt die finanzielle Belastung?
Reproduktionsmedizinische Behandlungen sind sehr kostspielig, weshalb die Frage nach staatlicher Unterstützung für betroffene Paare eine große Rolle spielt.
- Citar trabajo
- M.Sc. Ulrike Köpke (Autor), 2014, Was bedeutet die Reproduktionsmedizin für Kinderwunschpaare? Hoffnungen und Folgen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342589