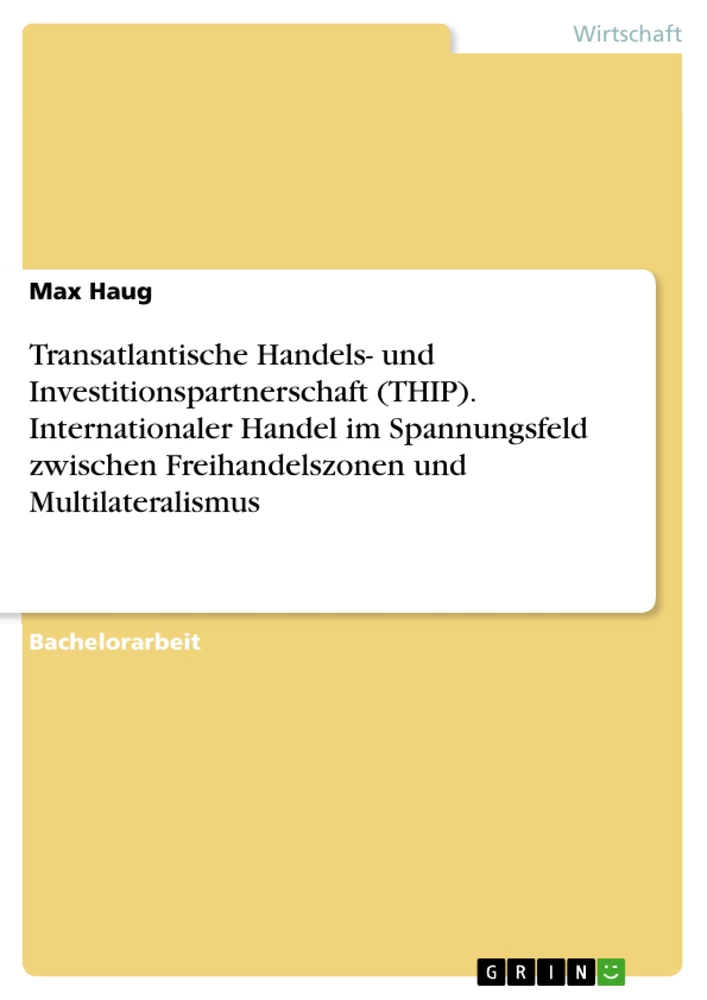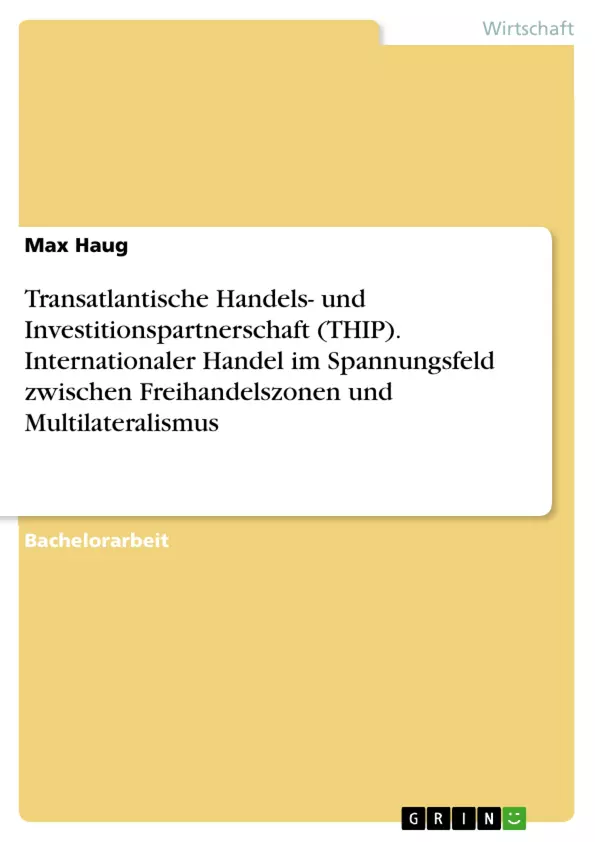Ziel der Arbeit soll es sein, eine pareto superiore Ausgestaltung der transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (THIP) zu präsentieren, die derzeit zwischen der Europäischen Union (EU) und den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) verhandelt wird.
Immer mehr Länder intensivieren durch präferentielle Handelsabkommen (PHA) ihren Handel untereinander. Häufig geschieht dies auf Kosten der Drittländer, die nicht Teil dieses Abkommens sind, da die Drittländer im Handel mit den Partnerländern höhere tarifäre und nicht-tarifäre Handelsbarrieren (NTB) haben, als die Partnerländer unter-einander. Das Modell von Panagariya/Krishna (2002) untersucht nun, wie Freihandelszonen (FTA) auszugestalten sind, damit Drittländer durch den Abschluss eines Freihandelsabkommens nicht schlechter gestellt werden. Dies geschieht, indem Panagariya/Krishna (2002) das ursprünglich für Zollunionen ausgearbeitete Kemp-Wan-Vanek-Ohyama Theorem auf Freihandelsabkommen anwenden. Die Analyse des Modells stellt den Kern dieser Arbeit dar und wird anschließend mit ökonometrischen Ergebnissen von Felbermayr et al. (2013) verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Teil A Motivation
- 1. Problemaufriss
- 2. Entwicklung
- 2.1 GATT als multilaterales Abkommen
- 2.2 Trend zu Handelsblöcken
- 2.3 Status quo des Handels zwischen Europa und den USA
- Teil B - Modelltheoretische Betrachtung
- 3. Ökonomische Grundlagen
- 3.1 Arten von Handelshemmnissen
- 3.2 Weitere Grundlagen
- 4. Modell nach Panagariya/Krishna (2002)
- 4.1 Modellaufbau
- 4.1.1 Idee des Kemp-Wan-Vanek-Ohyama Theorems
- 4.1.2 Die Bedeutung der Rules Of Origin
- 4.2 Analyse des Modells
- 4.2.1 Analyse ohne Produktion des Gutes innerhalb der FTA
- 4.2.2 Analyse mit Produktion des Gutes innerhalb der FTA
- 4.3 THIP im Kontext des Modells
- 4.4 Kritik des Modells
- Teil C - Ökonometrische Betrachtung
- 5. Studie von Felbermayr et al.
- 5.1 Untersuchungsaufbau
- 5.2 Zentrale Ergebnisse im Zollszenario
- 5.3 Evidenz/Kritik des Modells nach Panagariya/Krishna (2002)
- Teil D - Fazit
- 6. Bewertung und Handlungsempfehlung
- 6.1 Zusammenfassung
- 6.2 Politikimplikationen und Herausforderungen für die WTO
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (THIP) im Kontext des internationalen Handels und analysiert, wie Freihandelszonen (FTA) gestaltet werden können, um eine pareto-superiore Situation für alle beteiligten Länder zu schaffen.
- Die Auswirkungen von präferentiellen Handelsabkommen (PHA) auf Drittländer
- Die Bedeutung des Kemp-Wan-Vanek-Ohyama Theorems für die Gestaltung von Freihandelszonen
- Die Rolle von Regeln über die Ursprünge (Rules of Origin) im Rahmen von Freihandelsabkommen
- Die ökonometrische Analyse der THIP und ihre Auswirkungen auf den Handel zwischen der EU und den USA
- Politische Implikationen der THIP für die Welthandelsorganisation (WTO)
Zusammenfassung der Kapitel
Teil A: Motivation
Dieser Teil stellt die Problematik des internationalen Handels im Spannungsfeld zwischen Freihandelszonen und Multilateralismus vor und betrachtet die Entwicklung von Handelsabkommen im historischen Kontext.
Teil B: Modelltheoretische Betrachtung
Dieser Teil analysiert die ökonomischen Grundlagen von Handelshemmnissen und stellt das Modell von Panagariya/Krishna (2002) vor, welches untersucht, wie Freihandelsabkommen gestaltet werden können, um Drittländer nicht schlechter zu stellen.
Teil C: Ökonometrische Betrachtung
Dieser Teil präsentiert die Ergebnisse einer ökonometrischen Studie von Felbermayr et al. (2013), welche die Auswirkungen von Freihandelsabkommen auf den Handel zwischen der EU und den USA untersucht.
Teil D: Fazit
Dieser Teil fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und liefert eine Bewertung der THIP sowie Handlungsempfehlungen für die Gestaltung zukünftiger Freihandelsabkommen.
Schlüsselwörter
Freihandelszonen, Multilateralismus, Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (THIP), Präferentielle Handelsabkommen (PHA), Kemp-Wan-Vanek-Ohyama Theorem, Regeln über die Ursprünge (Rules of Origin), Drittländer, Welthandelsorganisation (WTO), ökonometrische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer "pareto superioren" Ausgestaltung der THIP?
Es soll eine Regelung gefunden werden, bei der die Handelspartner profitieren, ohne dass Drittländer durch den Abschluss des Abkommens schlechter gestellt werden.
Was besagt das Kemp-Wan-Vanek-Ohyama Theorem?
Dieses Theorem untersucht, wie Zollunionen und Freihandelszonen so gestaltet werden können, dass sie den Welthandel insgesamt fördern und Drittländer nicht benachteiligen.
Warum sind "Rules of Origin" (Ursprungsregeln) so wichtig?
Sie legen fest, welche Produkte als "heimisch" innerhalb der Freihandelszone gelten und somit zollfrei gehandelt werden dürfen, was entscheidend für die Wirksamkeit des Abkommens ist.
Wie beeinflusst die THIP Drittländer?
Präferentielle Handelsabkommen können dazu führen, dass Drittländer Handelsnachteile erleiden, da sie im Vergleich zu den Partnerländern höheren Barrieren gegenüberstehen.
Welche Rolle spielt die Welthandelsorganisation (WTO) in diesem Kontext?
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen, die bilaterale Abkommen wie die THIP für das multilaterale Handelssystem der WTO darstellen.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Studie von Felbermayr et al.?
Die ökonometrische Untersuchung analysiert die potenziellen Handelsgewinne und Auswirkungen eines Zollszenarios zwischen Europa und den USA.
- Citar trabajo
- Max Haug (Autor), 2014, Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (THIP). Internationaler Handel im Spannungsfeld zwischen Freihandelszonen und Multilateralismus, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342630